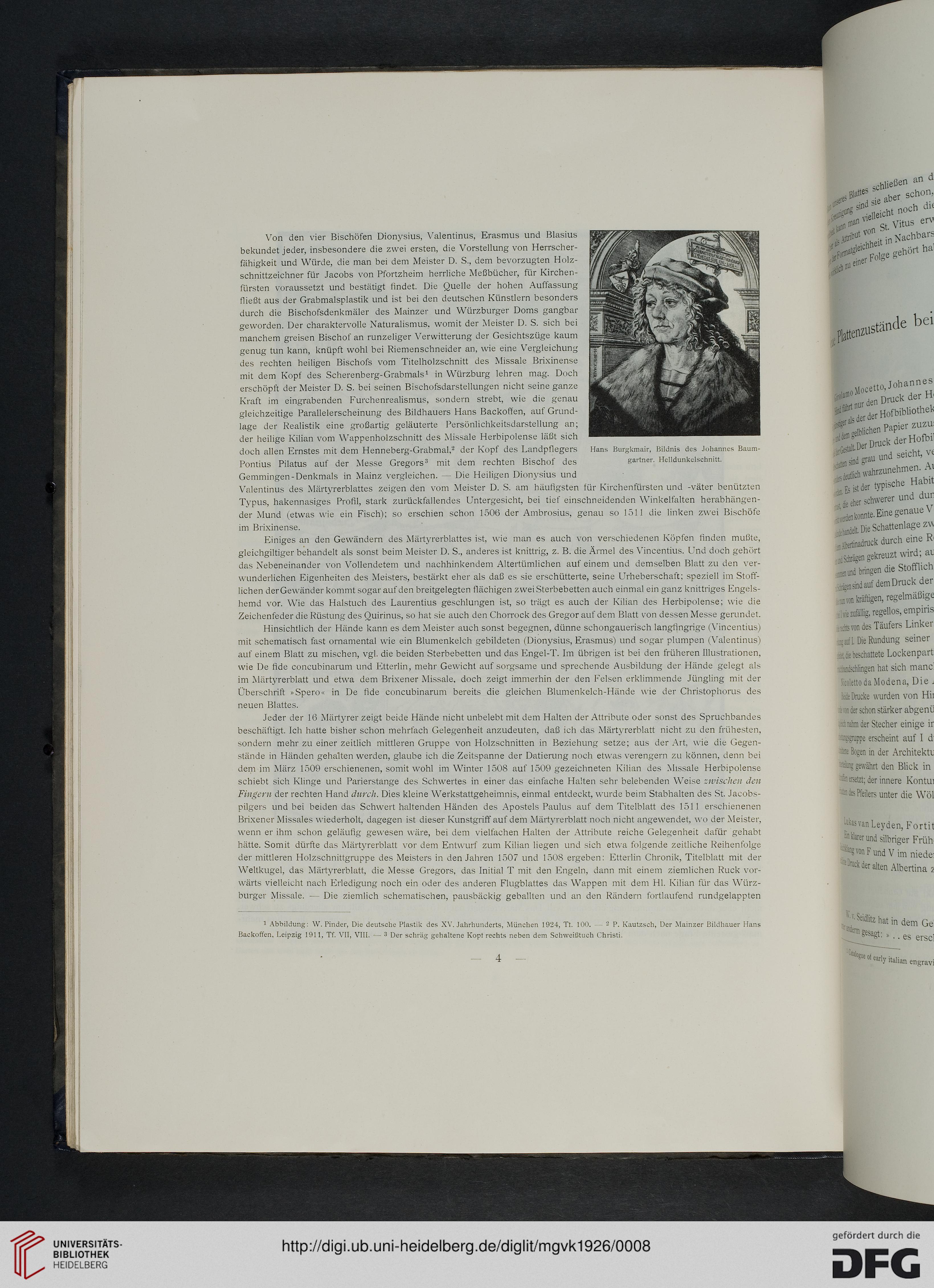fließen an
Blattes * h0n
.^ %ind sie aber s
^>eicWn er
.b»»"18 „ St Vitus er
Hans Burgkmair, Bildnis des Johannes Baum-
gartner. Helldunkelschnitt.
Von den vier Bischöfen Dionysius, Valentinus, Erasmus und Blasius
bekundet jeder, insbesondere die zwei ersten, die Vorstellung von Herrscher-
fähigkeit und Würde, die man bei dem Meister D. S., dem bevorzugten Holz-
schnittzeichner für Jacobs von Pfortzheim herrliche Meßbücher, für Kirchen-
fürsten voraussetzt und bestätigt findet. Die Quelle der hohen Auffassung
fließt aus der Grabmalsplastik und ist bei den deutschen Künstlern besonders
durch die Bischofsdenkmäler des Mainzer und Würzburger Doms gangbar
geworden. Der charaktervolle Naturalismus, womit der Meister D. S. sich bei
manchem greisen Bischof an runzeliger Verwitterung der Gesichtszüge kaum
genug tun kann, knüpft wohl bei Riemenschneider an, wie eine Vergleichung
des rechten heiligen Bischofs vom Titelholzschnitt des Missale Brixinense
mit dem Kopf des Scherenberg-Grabmals1 in Würzburg lehren mag. Doch
erschöpft der Meister D. S. bei seinen Bischofsdarstellungen nicht seine ganze
Kraft im eingrabenden Furchenrealismus, sondern strebt, wie die genau
gleichzeitige Parallelerscheinung des Bildhauers Hans Backoffen, auf Grund-
lage der Realistik eine großartig geläuterte Persönlichkeitsdarstellung an;
der heilige Kilian vom Wappenholzschnitt des Missale Herbipolense läßt sich
doch allen Ernstes mit dem Henneberg-Grabmal,2 der Kopf des Landpflegers
Pontius Pilatus auf der Messe Gregors3 mit dem rechten Bischof des
Gemmingen-Denkmals in Mainz vergleichen. — Die Heiligen Dionysius und
Valentinus des Märtyrerblattes zeigen den vom Meister D. S. am häufigsten für Kirchenfürsten und -väter benützten
Typus, hakennasiges Profil, stark zurückfallendes Untergesicht, bei tief einschneidenden Winkelfalten herabhängen-
der Mund (etwas wie ein Fisch); so erschien schon 1506 der Ambrosius, genau so 1511 die linken zwei Bischöfe
im Brixinense.
Einiges an den Gewändern des Märtyrerblattes ist, wie man es auch von verschiedenen Köpfen finden mußte,
gleichgiltiger behandelt als sonst beim Meister D. S., anderes ist knittrig, z. B. die Ärmel des Vincentius. Und doch gehört
das Nebeneinander von Vollendetem und nachhinkendem Altertümlichen auf einem und demselben Blatt zu den ver-
wunderlichen Eigenheiten des Meisters, bestärkt eher als daß es sie erschütterte, seine Urheberschaft; speziell im Stoff-
lichen derGewänder kommt sogar auf den breitgelegten flächigen zwei Sterbebetten auch einmal ein ganz knittriges Engels-
hemd vor. Wie das Halstuch des Laurentius geschlungen ist, so trägt es auch der Kilian des Herbipolense; wie die
Zeichenfeder die Rüstung des Quirinus, so hat sie auch den Chorrock des Gregor auf dem Blatt von dessen Messe gerundet.
Hinsichtlich der Hände kann es dem Meister auch sonst begegnen, dünne schongauerisch langfingrige (Vincentius)
mit .schematisch fast ornamental wie ein Blumenkelch gebildeten (Dionysius, Erasmus) und sogar plumpen (Valentinus)
auf einem Blatt zu mischen, vgl. die beiden Sterbebetten und das Engel-T. Im übrigen ist bei den früheren Illustrationen,
wie De fide coneubinarum und Etterlin, mehr Gewicht auf sorgsame und sprechende Ausbildung der Hände gelegt als
im Märtyrerblatt und etwa dem Brixener Missale, doch zeigt immerhin der den Felsen erklimmende Jüngling mit der
Überschrift »Spero« in De fide coneubinarum bereits die gleichen Blumenkelch-Hände wie der Christophorus des
neuen Blattes.
Jeder der 16 Märtyrer zeigt beide Hände nicht unbelebt mit dem Halten der Attribute oder sonst des Spruchbandes
beschäftigt. Ich hatte bisher schon mehrfach Gelegenheit anzudeuten, daß ich das .Märtyrerblatt nicht zu den frühesten,
sondern mehr zu einer zeitlich mittleren Gruppe von Holzschnitten in Beziehung setze; aus der Art, wie die Gegen-
stände in Händen gehalten werden, glaube ich die Zeitspanne der Datierung noch etwas verengern zu können, denn bei
dem im März 1509 erschienenen, somit wohl im Winter 1508 auf 1509 gezeichneten Kilian des Missale Herbipolense
schiebt sich Klinge und Parierstange des Schwertes in einer das einfache Halten sehr belebenden Weise zwischen Jeu
Fingern der rechten Hand durch. Dies kleine Werkstattgeheimnis, einmal entdeckt, wurde beim Stabhalten des St. Jacobs-
pilgers und bei beiden das Schwert haltenden Händen des Apostels Paulus auf dem Titelblatt des 1511 erschienenen
Brixener Missales wiederholt, dagegen ist dieser Kunstgriff auf dem Märtyrerblatt noch nicht angewendet, wo der Meister,
wenn er ihm schon geläufig gewesen wäre, bei dem vielfachen Halten der Attribute reiche Gelegenheit dafür gehabt
hätte. Somit dürfte das Märtyrerblatt vor dem Entwurf zum Kilian liegen und sich etwa folgende zeitliche Reihenfolge
der mittleren Holzschnittgruppe des Meisters in den Jahren 1507 und 1508 ergeben: Etterlin Chronik, Titelblatt mit der
Weltkugel, das Märtyrerblatt, die Messe Gregors, das Initial T mit den Engeln, dann mit einem ziemlichen Ruck vor-
wärts vielleicht nach Erledigung noch ein oder des anderen Flugblattes das Wappen mit dem Hl. Kilian für das Würz-
burger Missale. — Die ziemlich schematischen, pausbäckig geballten und an den Randern fortlaufend rundgelappten
1 Abbildung: W. Pinder, Die deutsche Plastik des XV. Jahrhunderts, München 1924, Tl. 100. - P. Kautzsch, Der Mainzer Bildhauer Hans
Baekoffen, Leipzig 1911, Tf. VII, VIII. — 3 Der schräg gehaltene Kopt rechts neben dem Schweißtuch Christi.
,>7st Vitus er
W,Ch te gehört h,
ände be
■riet
.piattenziista
I Mocetto,Johannes
i'*"0 d n Druck der H
# li ehen Papier zuzu
„•ahrzunehmen. Ai
fcistder typische Habit
^„schwerer und dur
KrJe„konnte.Eine genaue V
.„rft Die Schattenlage zu
'-fctaadruck durch eine R
,Sctoägen gekreuzt wird; aL
^Bd bringen die Stofflich
.^ensindaufdemDruck der
mm kräftigen, regelmäßige
Saffig, regellos, empiris
:-äitsvon des Täufers Linker
»ml Die Rundung seiner
I. -chattete Lockenpart
■Jadächlingen hat sich manc
ScolettodaModena, Die
säe Drucke wurden von Hii
schon stärker abgenü
der Stecher einige ir
•'-^gruppe erscheint auf I d
3K Bogen in der Architektv.
% gewährt den Blick in
besetzt; der innere Kontui
"«Pfeilers unter die Wöl
^asvanLeyden, Forti
3 fer und silbriger Früh
^vonFund V im niede
^Ueralten Albertina 2
^•v.Seidlitz hat
in dem Ge
es ersc
engravi
•rtj italian
Blattes * h0n
.^ %ind sie aber s
^>eicWn er
.b»»"18 „ St Vitus er
Hans Burgkmair, Bildnis des Johannes Baum-
gartner. Helldunkelschnitt.
Von den vier Bischöfen Dionysius, Valentinus, Erasmus und Blasius
bekundet jeder, insbesondere die zwei ersten, die Vorstellung von Herrscher-
fähigkeit und Würde, die man bei dem Meister D. S., dem bevorzugten Holz-
schnittzeichner für Jacobs von Pfortzheim herrliche Meßbücher, für Kirchen-
fürsten voraussetzt und bestätigt findet. Die Quelle der hohen Auffassung
fließt aus der Grabmalsplastik und ist bei den deutschen Künstlern besonders
durch die Bischofsdenkmäler des Mainzer und Würzburger Doms gangbar
geworden. Der charaktervolle Naturalismus, womit der Meister D. S. sich bei
manchem greisen Bischof an runzeliger Verwitterung der Gesichtszüge kaum
genug tun kann, knüpft wohl bei Riemenschneider an, wie eine Vergleichung
des rechten heiligen Bischofs vom Titelholzschnitt des Missale Brixinense
mit dem Kopf des Scherenberg-Grabmals1 in Würzburg lehren mag. Doch
erschöpft der Meister D. S. bei seinen Bischofsdarstellungen nicht seine ganze
Kraft im eingrabenden Furchenrealismus, sondern strebt, wie die genau
gleichzeitige Parallelerscheinung des Bildhauers Hans Backoffen, auf Grund-
lage der Realistik eine großartig geläuterte Persönlichkeitsdarstellung an;
der heilige Kilian vom Wappenholzschnitt des Missale Herbipolense läßt sich
doch allen Ernstes mit dem Henneberg-Grabmal,2 der Kopf des Landpflegers
Pontius Pilatus auf der Messe Gregors3 mit dem rechten Bischof des
Gemmingen-Denkmals in Mainz vergleichen. — Die Heiligen Dionysius und
Valentinus des Märtyrerblattes zeigen den vom Meister D. S. am häufigsten für Kirchenfürsten und -väter benützten
Typus, hakennasiges Profil, stark zurückfallendes Untergesicht, bei tief einschneidenden Winkelfalten herabhängen-
der Mund (etwas wie ein Fisch); so erschien schon 1506 der Ambrosius, genau so 1511 die linken zwei Bischöfe
im Brixinense.
Einiges an den Gewändern des Märtyrerblattes ist, wie man es auch von verschiedenen Köpfen finden mußte,
gleichgiltiger behandelt als sonst beim Meister D. S., anderes ist knittrig, z. B. die Ärmel des Vincentius. Und doch gehört
das Nebeneinander von Vollendetem und nachhinkendem Altertümlichen auf einem und demselben Blatt zu den ver-
wunderlichen Eigenheiten des Meisters, bestärkt eher als daß es sie erschütterte, seine Urheberschaft; speziell im Stoff-
lichen derGewänder kommt sogar auf den breitgelegten flächigen zwei Sterbebetten auch einmal ein ganz knittriges Engels-
hemd vor. Wie das Halstuch des Laurentius geschlungen ist, so trägt es auch der Kilian des Herbipolense; wie die
Zeichenfeder die Rüstung des Quirinus, so hat sie auch den Chorrock des Gregor auf dem Blatt von dessen Messe gerundet.
Hinsichtlich der Hände kann es dem Meister auch sonst begegnen, dünne schongauerisch langfingrige (Vincentius)
mit .schematisch fast ornamental wie ein Blumenkelch gebildeten (Dionysius, Erasmus) und sogar plumpen (Valentinus)
auf einem Blatt zu mischen, vgl. die beiden Sterbebetten und das Engel-T. Im übrigen ist bei den früheren Illustrationen,
wie De fide coneubinarum und Etterlin, mehr Gewicht auf sorgsame und sprechende Ausbildung der Hände gelegt als
im Märtyrerblatt und etwa dem Brixener Missale, doch zeigt immerhin der den Felsen erklimmende Jüngling mit der
Überschrift »Spero« in De fide coneubinarum bereits die gleichen Blumenkelch-Hände wie der Christophorus des
neuen Blattes.
Jeder der 16 Märtyrer zeigt beide Hände nicht unbelebt mit dem Halten der Attribute oder sonst des Spruchbandes
beschäftigt. Ich hatte bisher schon mehrfach Gelegenheit anzudeuten, daß ich das .Märtyrerblatt nicht zu den frühesten,
sondern mehr zu einer zeitlich mittleren Gruppe von Holzschnitten in Beziehung setze; aus der Art, wie die Gegen-
stände in Händen gehalten werden, glaube ich die Zeitspanne der Datierung noch etwas verengern zu können, denn bei
dem im März 1509 erschienenen, somit wohl im Winter 1508 auf 1509 gezeichneten Kilian des Missale Herbipolense
schiebt sich Klinge und Parierstange des Schwertes in einer das einfache Halten sehr belebenden Weise zwischen Jeu
Fingern der rechten Hand durch. Dies kleine Werkstattgeheimnis, einmal entdeckt, wurde beim Stabhalten des St. Jacobs-
pilgers und bei beiden das Schwert haltenden Händen des Apostels Paulus auf dem Titelblatt des 1511 erschienenen
Brixener Missales wiederholt, dagegen ist dieser Kunstgriff auf dem Märtyrerblatt noch nicht angewendet, wo der Meister,
wenn er ihm schon geläufig gewesen wäre, bei dem vielfachen Halten der Attribute reiche Gelegenheit dafür gehabt
hätte. Somit dürfte das Märtyrerblatt vor dem Entwurf zum Kilian liegen und sich etwa folgende zeitliche Reihenfolge
der mittleren Holzschnittgruppe des Meisters in den Jahren 1507 und 1508 ergeben: Etterlin Chronik, Titelblatt mit der
Weltkugel, das Märtyrerblatt, die Messe Gregors, das Initial T mit den Engeln, dann mit einem ziemlichen Ruck vor-
wärts vielleicht nach Erledigung noch ein oder des anderen Flugblattes das Wappen mit dem Hl. Kilian für das Würz-
burger Missale. — Die ziemlich schematischen, pausbäckig geballten und an den Randern fortlaufend rundgelappten
1 Abbildung: W. Pinder, Die deutsche Plastik des XV. Jahrhunderts, München 1924, Tl. 100. - P. Kautzsch, Der Mainzer Bildhauer Hans
Baekoffen, Leipzig 1911, Tf. VII, VIII. — 3 Der schräg gehaltene Kopt rechts neben dem Schweißtuch Christi.
,>7st Vitus er
W,Ch te gehört h,
ände be
■riet
.piattenziista
I Mocetto,Johannes
i'*"0 d n Druck der H
# li ehen Papier zuzu
„•ahrzunehmen. Ai
fcistder typische Habit
^„schwerer und dur
KrJe„konnte.Eine genaue V
.„rft Die Schattenlage zu
'-fctaadruck durch eine R
,Sctoägen gekreuzt wird; aL
^Bd bringen die Stofflich
.^ensindaufdemDruck der
mm kräftigen, regelmäßige
Saffig, regellos, empiris
:-äitsvon des Täufers Linker
»ml Die Rundung seiner
I. -chattete Lockenpart
■Jadächlingen hat sich manc
ScolettodaModena, Die
säe Drucke wurden von Hii
schon stärker abgenü
der Stecher einige ir
•'-^gruppe erscheint auf I d
3K Bogen in der Architektv.
% gewährt den Blick in
besetzt; der innere Kontui
"«Pfeilers unter die Wöl
^asvanLeyden, Forti
3 fer und silbriger Früh
^vonFund V im niede
^Ueralten Albertina 2
^•v.Seidlitz hat
in dem Ge
es ersc
engravi
•rtj italian