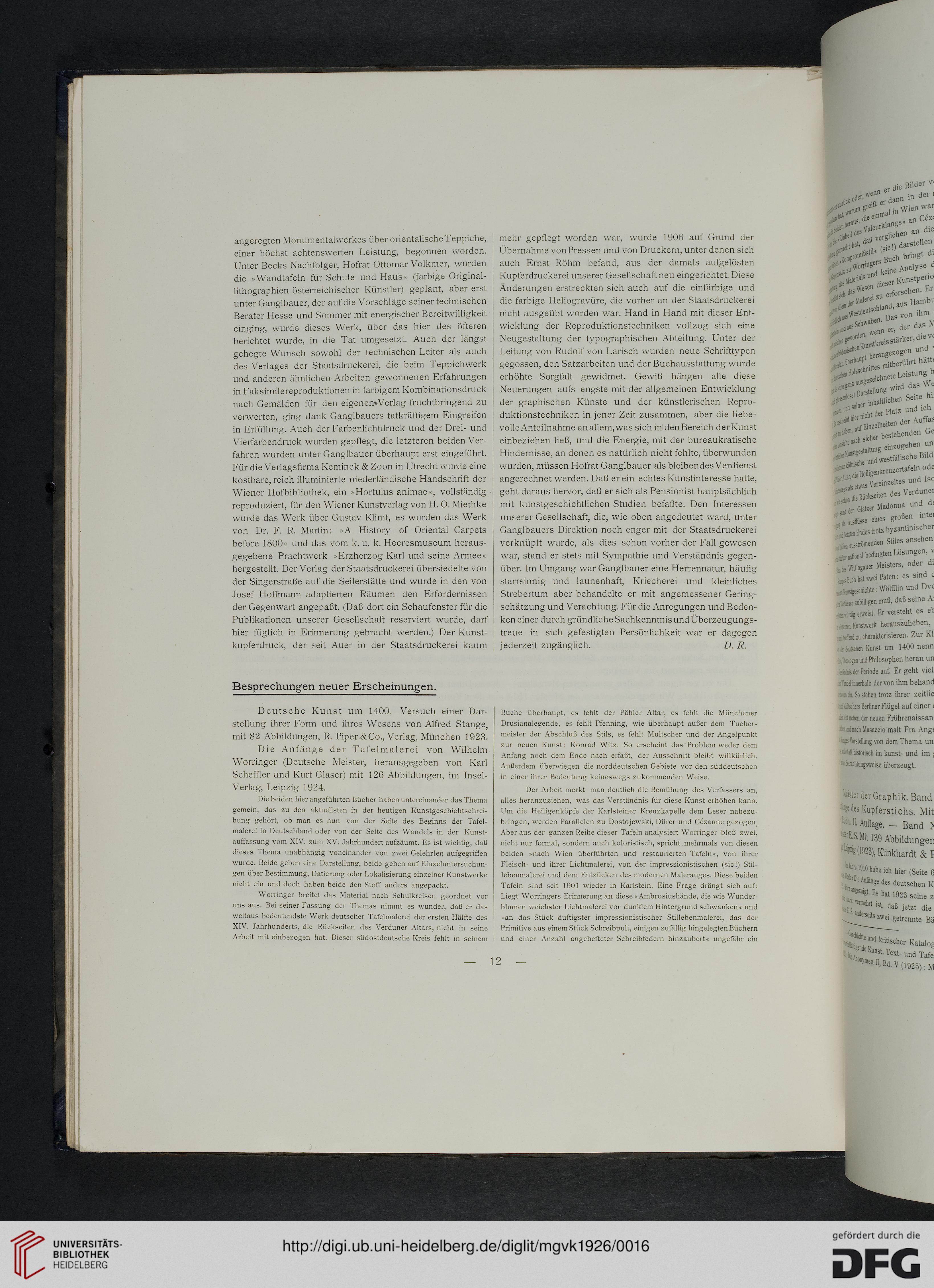angeregten Monumentalwerkes über orientalischeTeppiche,
einer höchst achtenswerten Leistung, begonnen worden.
Unter Becks Nachfolger, Hofrat Ottomar Volkmer, wurden
die »Wandtafeln für Schule und Haus« (farbige Original-
lithographien österreichischer Künstler) geplant, aber erst
unter Gangibauer, der auf die Vorschläge seiner technischen
Berater Hesse und Sommer mit energischer Bereitwilligkeit
einging, wurde dieses Werk, über das hier des öfteren
berichtet wurde, in die Tat umgesetzt. Auch der längst
gehegte Wunsch sowohl der technischen Leiter als auch
des Verlages der Staatsdruckerei, die beim Teppichwerk
und anderen ähnlichen Arbeiten gewonnenen Erfahrungen
in Faksimilereproduktionen in farbigem Kombinationsdruck
nach Gemälden für den eigenen»Verlag fruchtbringend zu
verwerten, ging dank Gangibauers tatkräftigem Eingreifen
in Erfüllung. Auch der Farbenlichtdruck und der Drei- und
Vierfarbendruck wurden gepflegt, die letzteren beiden Ver-
fahren wurden unter Gangibauer überhaupt erst eingeführt.
Für die Verlagsfirma Keminck & Zoon in Utrecht wurde eine
kostbare, reich illuminierte niederländische Handschrift der
Wiener Hofbibliothek, ein »Hortulus animae«, vollständig
reproduziert, für den Wiener Kunstverlag von H. O. Miethke
wurde das Werk über Gustav Klimt, es wurden das Werk
von Dr. F. R. Martin: »A History of Oriental Carpets
before 1800« und das vom k. u. k. Heeresmuseum heraus-
gegebene Prachtwerk »Erzherzog Karl und seine Armee«
hergestellt. Der Verlag der Staatsdruckerei übersiedelte von
der Singerstraße auf die Seilerstätte und wurde in den von
Josef Hoffmann adaptierten Räumen den Erfordernissen
der Gegenwart angepaßt. (Daß dort ein Schaufenster für die
Publikationen unserer Gesellschaft reserviert wurde, darf
hier füglich in Erinnerung gebracht werden.) Der Kunst-
kupferdruck, der seit Auer in der Staatsdruckerei kaum
mehr gepflegt worden war, wurde 1906 auf Grund der
Übernahme von Pressen und von Druckern, unter denen sich
auch Ernst Röhm befand, aus der damals aufgelösten
Kupferdruckerei unserer Gesellschaft neu eingerichtet. Diese
Änderungen erstreckten sich auch auf die einfärbige und
die farbige Heliogravüre, die vorher an der Staatsdruckerei
nicht ausgeübt worden war. Hand in Hand mit dieser Ent-
wicklung der Reproduktionstechniken vollzog sich eine
Neugestaltung der typographischen Abteilung. Unter der
Leitung von Rudolf von Larisch wurden neue Schrifttypen
gegossen, den Satzarbeiten und der Buchausstattung wurde
erhöhte Sorgfalt gewidmet. Gewiß hängen alle diese
Neuerungen aufs engste mit der allgemeinen Entwicklung
der graphischen Künste und der künstlerischen Repro-
duktionstechniken in jener Zeit zusammen, aber die liebe-
volle Anteilnahme an allem, was sich in den Bereich der Kunst
einbeziehen ließ, und die Energie, mit der bureaukratische
Hindernisse, an denen es natürlich nicht fehlte, überwunden
wurden, müssen Hofrat Gangibauer als bleibendes Verdienst
angerechnet werden. Daß er ein echtes Kunstinteresse hatte,
geht daraus hervor, daß er sich als Pensionist hauptsächlich
mit kunstgeschichtlichen Studien befaßte. Den Interessen
unserer Gesellschaft, die, wie oben angedeutet ward, unter
Gangibauers Direktion noch enger mit der Staatsdruckerei
verknüpft wurde, als dies schon vorher der Fall gewesen
war, stand er stets mit Sympathie und Verständnis gegen-
über. Im Umgang war Gangibauer eine Herrennatur, häufig
starrsinnig und launenhaft, Kriecherei und kleinliches
Strebertum aber behandelte er mit angemessener Gering-
schätzung und Verachtung. Für die Anregungen und Beden-
ken einer durch gründlicheSachkenntnisund Überzeugungs-
treue in sich gefestigten Persönlichkeit war er dagegen
jederzeit zugänglich. D. R.
Besprechungen neuer Erscheinungen.
Deutsche Kunst um 1400. Versuch einer Dar-
stellung ihrer Form und ihres Wesens von Alfred Stange,
mit 82 Abbildungen, R. Piper & Co., Verlag, München 1923.
Die Anfänge der Tafelmalerei von Wilhelm
Worringer (Deutsche Meister, herausgegeben von Karl
Scheffler und Kurt Glaser) mit 126 Abbildungen, im Insel-
Verlag, Leipzig 1924.
Diebeiden hier angeführten Bücher haben untereinander das Thema
gemein, das zu den aktuellsten in der heutigen Kunstgeschichtschrei-
bung gehört, ob man es nun von der Seite des Beginns der Tafel-
malerei in Deutschland oder von der Seite des Wandels in der Kunst-
auflassung vom XIV. zum XV. Jahrhundert aufzäumt. Es ist wichtig, daß
dieses Thema unabhängig voneinander von zwei Gelehrten aufgegriffen
wurde. Beide geben eine Darstellung, beide gehen auf Einzeluntersuchun-
gen über Bestimmung, Datierung oder Lokalisierung einzelner Kunstwerke
nicht ein und doch haben beide den Stoff anders angepackt.
Worringer breitet das Material nach Schulkreisen geordnet vor
uns aus. Bei seiner Fassung der Themas nimmt es wunder, daß er das
weitaus bedeutendste Werk deutscher Tafelmalerei der ersten Hälfte des
XIV. Jahrhunderts, die Rückseiten des Verduner Altars, nicht in seine
Arbeit mit einbezogen hat. Dieser südostdeutsche Kreis fehlt in seinem
Buche überhaupt, es fehlt der Pähler Altar, es fehlt die Münchener
Drusianalegende, es fehlt Pfenning, wie überhaupt außer dem Tucher-
meister der Abschluß des Stils, es fehlt Multscher und der Angelpunkt
zur neuen Kunst: Konrad Witz. So erscheint das Problem weder dem
Anfang noch dem Ende nach erfaßt, der Ausschnitt bleibt willkürlich.
Außerdem überwiegen die norddeutschen Gebiete vor den süddeutschen
in einer ihrer Bedeutung keineswegs zukommenden Weise.
Der Arbeit merkt man deutlich die Bemühung des Verfassers an,
alles heranzuziehen, was das Verständnis für diese Kunst erhöhen kann.
Um die Heiligenköpfe der Karlsteiner Kreuzkapelle dem Leser nahezu-
bringen, werden Parallelen zu Dostojewski, Dürer und Cezanne gezogen
Aber aus der ganzen Reihe dieser Tafeln analysiert Worringer bloß zwei,
nicht nur formal, sondern auch koloristisch, spricht mehrmals von diesen
beiden »nach Wien überführten und restaurierten Tafeln«, von ihrer
Fleisch- und ihrer Lichtmalerei, von der impressionistischen (sie!) Stil-
lebenmalerei und dem Entzücken des modernen Malerauges. Diese beiden
Tafeln sind seit 1901 wieder in Karlstein. Eine Frage drängt sich auf:
Liegt Worringers Erinnerung an diese »Ambrosiushände, die wie Wunder-
blumen weichster Lichtmalerei vor dunklem Hintergrund schwanken« und
»an das Stück duftigster impressionistischer Stillebenmalerei, das der
Primitive aus einem Stück Schreibpult, einigen zufällig hingelegten Büchern
und einer Anzahl angehefteter Schreibfedern hinzaubert« ungefähr ein
einer höchst achtenswerten Leistung, begonnen worden.
Unter Becks Nachfolger, Hofrat Ottomar Volkmer, wurden
die »Wandtafeln für Schule und Haus« (farbige Original-
lithographien österreichischer Künstler) geplant, aber erst
unter Gangibauer, der auf die Vorschläge seiner technischen
Berater Hesse und Sommer mit energischer Bereitwilligkeit
einging, wurde dieses Werk, über das hier des öfteren
berichtet wurde, in die Tat umgesetzt. Auch der längst
gehegte Wunsch sowohl der technischen Leiter als auch
des Verlages der Staatsdruckerei, die beim Teppichwerk
und anderen ähnlichen Arbeiten gewonnenen Erfahrungen
in Faksimilereproduktionen in farbigem Kombinationsdruck
nach Gemälden für den eigenen»Verlag fruchtbringend zu
verwerten, ging dank Gangibauers tatkräftigem Eingreifen
in Erfüllung. Auch der Farbenlichtdruck und der Drei- und
Vierfarbendruck wurden gepflegt, die letzteren beiden Ver-
fahren wurden unter Gangibauer überhaupt erst eingeführt.
Für die Verlagsfirma Keminck & Zoon in Utrecht wurde eine
kostbare, reich illuminierte niederländische Handschrift der
Wiener Hofbibliothek, ein »Hortulus animae«, vollständig
reproduziert, für den Wiener Kunstverlag von H. O. Miethke
wurde das Werk über Gustav Klimt, es wurden das Werk
von Dr. F. R. Martin: »A History of Oriental Carpets
before 1800« und das vom k. u. k. Heeresmuseum heraus-
gegebene Prachtwerk »Erzherzog Karl und seine Armee«
hergestellt. Der Verlag der Staatsdruckerei übersiedelte von
der Singerstraße auf die Seilerstätte und wurde in den von
Josef Hoffmann adaptierten Räumen den Erfordernissen
der Gegenwart angepaßt. (Daß dort ein Schaufenster für die
Publikationen unserer Gesellschaft reserviert wurde, darf
hier füglich in Erinnerung gebracht werden.) Der Kunst-
kupferdruck, der seit Auer in der Staatsdruckerei kaum
mehr gepflegt worden war, wurde 1906 auf Grund der
Übernahme von Pressen und von Druckern, unter denen sich
auch Ernst Röhm befand, aus der damals aufgelösten
Kupferdruckerei unserer Gesellschaft neu eingerichtet. Diese
Änderungen erstreckten sich auch auf die einfärbige und
die farbige Heliogravüre, die vorher an der Staatsdruckerei
nicht ausgeübt worden war. Hand in Hand mit dieser Ent-
wicklung der Reproduktionstechniken vollzog sich eine
Neugestaltung der typographischen Abteilung. Unter der
Leitung von Rudolf von Larisch wurden neue Schrifttypen
gegossen, den Satzarbeiten und der Buchausstattung wurde
erhöhte Sorgfalt gewidmet. Gewiß hängen alle diese
Neuerungen aufs engste mit der allgemeinen Entwicklung
der graphischen Künste und der künstlerischen Repro-
duktionstechniken in jener Zeit zusammen, aber die liebe-
volle Anteilnahme an allem, was sich in den Bereich der Kunst
einbeziehen ließ, und die Energie, mit der bureaukratische
Hindernisse, an denen es natürlich nicht fehlte, überwunden
wurden, müssen Hofrat Gangibauer als bleibendes Verdienst
angerechnet werden. Daß er ein echtes Kunstinteresse hatte,
geht daraus hervor, daß er sich als Pensionist hauptsächlich
mit kunstgeschichtlichen Studien befaßte. Den Interessen
unserer Gesellschaft, die, wie oben angedeutet ward, unter
Gangibauers Direktion noch enger mit der Staatsdruckerei
verknüpft wurde, als dies schon vorher der Fall gewesen
war, stand er stets mit Sympathie und Verständnis gegen-
über. Im Umgang war Gangibauer eine Herrennatur, häufig
starrsinnig und launenhaft, Kriecherei und kleinliches
Strebertum aber behandelte er mit angemessener Gering-
schätzung und Verachtung. Für die Anregungen und Beden-
ken einer durch gründlicheSachkenntnisund Überzeugungs-
treue in sich gefestigten Persönlichkeit war er dagegen
jederzeit zugänglich. D. R.
Besprechungen neuer Erscheinungen.
Deutsche Kunst um 1400. Versuch einer Dar-
stellung ihrer Form und ihres Wesens von Alfred Stange,
mit 82 Abbildungen, R. Piper & Co., Verlag, München 1923.
Die Anfänge der Tafelmalerei von Wilhelm
Worringer (Deutsche Meister, herausgegeben von Karl
Scheffler und Kurt Glaser) mit 126 Abbildungen, im Insel-
Verlag, Leipzig 1924.
Diebeiden hier angeführten Bücher haben untereinander das Thema
gemein, das zu den aktuellsten in der heutigen Kunstgeschichtschrei-
bung gehört, ob man es nun von der Seite des Beginns der Tafel-
malerei in Deutschland oder von der Seite des Wandels in der Kunst-
auflassung vom XIV. zum XV. Jahrhundert aufzäumt. Es ist wichtig, daß
dieses Thema unabhängig voneinander von zwei Gelehrten aufgegriffen
wurde. Beide geben eine Darstellung, beide gehen auf Einzeluntersuchun-
gen über Bestimmung, Datierung oder Lokalisierung einzelner Kunstwerke
nicht ein und doch haben beide den Stoff anders angepackt.
Worringer breitet das Material nach Schulkreisen geordnet vor
uns aus. Bei seiner Fassung der Themas nimmt es wunder, daß er das
weitaus bedeutendste Werk deutscher Tafelmalerei der ersten Hälfte des
XIV. Jahrhunderts, die Rückseiten des Verduner Altars, nicht in seine
Arbeit mit einbezogen hat. Dieser südostdeutsche Kreis fehlt in seinem
Buche überhaupt, es fehlt der Pähler Altar, es fehlt die Münchener
Drusianalegende, es fehlt Pfenning, wie überhaupt außer dem Tucher-
meister der Abschluß des Stils, es fehlt Multscher und der Angelpunkt
zur neuen Kunst: Konrad Witz. So erscheint das Problem weder dem
Anfang noch dem Ende nach erfaßt, der Ausschnitt bleibt willkürlich.
Außerdem überwiegen die norddeutschen Gebiete vor den süddeutschen
in einer ihrer Bedeutung keineswegs zukommenden Weise.
Der Arbeit merkt man deutlich die Bemühung des Verfassers an,
alles heranzuziehen, was das Verständnis für diese Kunst erhöhen kann.
Um die Heiligenköpfe der Karlsteiner Kreuzkapelle dem Leser nahezu-
bringen, werden Parallelen zu Dostojewski, Dürer und Cezanne gezogen
Aber aus der ganzen Reihe dieser Tafeln analysiert Worringer bloß zwei,
nicht nur formal, sondern auch koloristisch, spricht mehrmals von diesen
beiden »nach Wien überführten und restaurierten Tafeln«, von ihrer
Fleisch- und ihrer Lichtmalerei, von der impressionistischen (sie!) Stil-
lebenmalerei und dem Entzücken des modernen Malerauges. Diese beiden
Tafeln sind seit 1901 wieder in Karlstein. Eine Frage drängt sich auf:
Liegt Worringers Erinnerung an diese »Ambrosiushände, die wie Wunder-
blumen weichster Lichtmalerei vor dunklem Hintergrund schwanken« und
»an das Stück duftigster impressionistischer Stillebenmalerei, das der
Primitive aus einem Stück Schreibpult, einigen zufällig hingelegten Büchern
und einer Anzahl angehefteter Schreibfedern hinzaubert« ungefähr ein