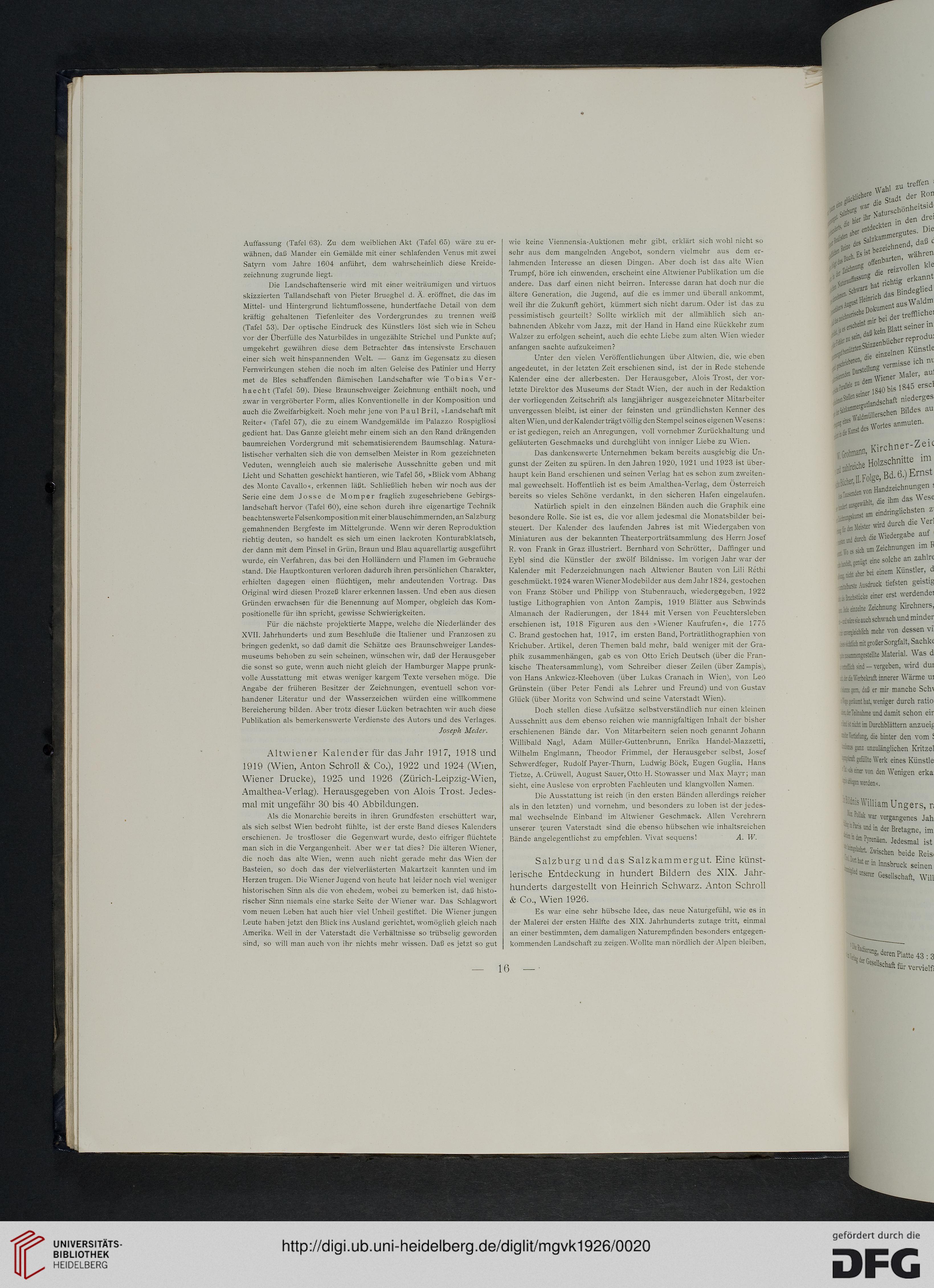Auffassung (Tafel G3). Zu dem weiblichen Akt (Tafel 65) wäre zu er-
wähnen, daß Mander ein Gemälde mit einer schlafenden Venus mit zwei
Satyrn vom Jahre 1604 anführt, dem wahrscheinlich diese Kreide-
zeichnung zugrunde liegt.
Die Landschaftenserie wird mit einer weiträumigen und virtuos
skizzierten Tallandschaft von Pieter Brueghel d. Ä. eröffnet, die das im
Mittel- und Hintergrund Hchtumflossene, hundertfache Detail von dem
kräftig gehaltenen Tiefenleiter des Vordergrundes zu trennen weiß
(Tafel 53). Der optische Eindruck des Künstlers löst sich wie in Scheu
vor der Überfülle des Xaturbildes in ungezählte Striche! und Punkte auf;
umgekehrt gewähren diese dem Betrachter das intensivste Erschauen
einer sich weit hinspannenden Welt. — Ganz im Gegensatz zu diesen
Femwirkungen stehen die noch im alten Geleise des Patinier und Herry
met de Bles schaffenden flämischen Landschafter wie Tobias Ver-
haecht (Tafel 59). Diese Braunschweiger Zeichnung enthält noch, und
zwar in vergröberter Form, alies Konventionelle in der Komposition und
auch die Zweifarbigkeit. Noch mehr jene von Paul Bril, >Landschaft mit
Reiter« (Tafel 57), die zu einem Wandgemälde im Palazzo Rospigliosi
gedient hat. Das Ganze gleicht mehr einem sich an den Rand drängenden
baumreichen Vordergrund mit schematisierendem Baumschlag. Natura-
listischer verhalten sich die von demselben Meister in Rom gezeichneten
Veduten, wenngleich auch sie malerische Ausschnitte geben und mit
Licht und Schatten geschickt hantieren, wie Tafel 56, »Blick vom Abhang
des Monte Cavallo«, erkennen läßt. Schließlich heben wir noch aus der
Serie eine dem Josse de Momper fraglich zugeschriebene Gebirgs-
landschaft hervor (Tafel 60), eine schon durch ihre eigenartige Technik
beachtenswerte Felsenkomposition mit einer blauschimmernden, an Salzburg
gemahnenden Bergfeste im Mittelgrunde. Wenn wir deren Reproduktion
richtig deuten, so handelt es sich um einen lackroten Konturabklatsch,
der dann mit dem Pinsel in Grün. Braun und Blau aquarellartig ausgeführt
wurde, ein Verfahren, das bei den Holländern und Flamen im Gebrauche
stand. Die Hauptkonturen verloren dadurch ihren persönlichen Charakter,
erhielten dagegen einen flüchtigen, mehr andeutenden Vortrag. Das
Original wird diesen Prozeß klarer erkennen lassen. Und eben aus diesen
Gründen erwachsen für die Benennung auf Momper, obgleich das Kom-
positionelle für ihn spricht, gewisse Schwierigkeiten.
Für die nächste projektierte Mappe, welche die Niederländer des
XVII. Jahrhunderts und zum Beschluße die Italiener und Franzosen zu
bringen gedenkt, so daß damit die Schätze des Braunschweiger Landes-
museums behoben zu sein scheinen, wünschen wir, daß der Herausgeber
die sonst so gute, wenn auch nicht gleich der Hamburger Mappe prunk-
volle Ausstattung mit etwas weniger kargem Texte versehen möge. Die
Angabe der früheren Besitzer der Zeichnungen, eventuell schon vor-
handener Literatur und der Wasserzeichen würden eine willkommene
Bereicherung bilden. Aber trotz dieser Lücken betrachten wir auch diese
Publikation als bemerkenswerte Verdienste des Autors und des Verlages.
Joseph Meder.
Altwiener Kalender für das Jahr 1917, 1918 und
1919 (Wien, Anton Schroll & Co.), 1922 und 1924 (Wien,
Wiener Drucke), 1925 und 1926 (Zürich-Leipzig-Wien,
Amalthea-Verlag). Herausgegeben von Alois Trost. Jedes-
mal mit ungefähr 30 bis 40 Abbildungen.
Als die Monarchie bereits in ihren Grundfesten erschüttert war,
als sich selbst Wien bedroht fühlte, ist der erste Band dieses Kalenders
erschienen. Je trostloser die Gegenwart wurde, desto eifriger flüchtete
man sich in die Vergangenheit. Aber wer tat dies? Die älteren Wiener,
die noch das alte Wien, wenn auch nicht gerade mehr das Wien der
Basteien, so doch das der vielverlästerten Makartzeit kannten und im
Herzen trugen. Die Wiener Jugend von heute hat leider noch viel weniger
historischen Sinn als die von ehedem, wobei zu bemerken ist. daß histo-
rischer Sinn niemals eine starke Seite der Wiener war. Das Schlagwort
vom neuen Leben hat auch hier viel Unheil gestiftet. Die Wiener jungen
Leute haben jetzt den Blick ins Ausland gerichtet, womöglich gleich nach
Amerika. Weil in der Vaterstadt die Verhältnisse so trübselig geworden
sind, so will man auch von ihr nichts mehr wissen. Daß es jetzt so gut
wie keine Viennensia-Auktionen mehr gibt, erklärt sich wohl nicht so
sehr aus dem mangelnden Angebot, sondern vielmehr aus dem er-
lahmenden Interesse an diesen Dingen. Aber doch ist das alte Wien
Trumpf, höre ich einwenden, erscheint eine Altwiener Publikation um die
andere. Das darf einen nicht beirren. Interesse daran hat doch nur die
ältere Generation, die Jugend, auf die es immer und überall ankommt,
weil ihr die Zukunft gehört, kümmert sich nicht darum. Oder ist das zu
pessimistisch geurteüt? Sollte wirklich mit der allmählich sich an-
bahnenden Abkehr vom Jazz, mit der Hand in Hand eine Rückkehr zum
Walzer zu erfolgen scheint, auch die echte Liebe zum alten Wien wieder
anfangen sachte aufzukeimen?
Unter den vielen Veröffentlichungen über Altwien, die. wie eben
angedeutet, in der letzten Zeit erschienen sind, ist der in Rede stehende
Kalender eine der allerbesten. Der Herausgeber, Alois Trost, der vor-
letzte Direktor des Museums der Stadt Wien, der auch in der Redaktion
der vorliegenden Zeitschrift als langjähriger ausgezeichneter Mitarbeiter
unvergessen bleibt, ist einer der feinsten und gründlichsten Kenner des
alten Wien, und der Kalender trägt völlig den Stempel seines eigenen Wesens:
er ist gediegen, reich an Anregungen, voll vornehmer Zurückhaltung und
geläuterten Geschmacks und durchglüht von inniger Liebe zu Wien.
Das dankenswerte Unternehmen bekam bereits ausgiebig die Un-
gunst der Zeiten zu spüren. In den Jahren 1920, 1921 und 1923 ist über-
haupt kein Band erschienen und seinen Verlag hat es schon zum zweiten-
mal gewechselt. Hoffentlich ist es beim Amalthea-Verlag, dem Österreich
bereits so vieles Schöne verdankt, in den sicheren Hafen eingelaufen.
Natürlich spielt in den einzelnen Bänden auch die Graphik eine
besondere Rolle. Sie ist es, die vor allem jedesmal die Monatsbilder bei-
steuert. Der Kalender des laufenden Jahres ist mit Wiedergaben von
Miniaturen aus der bekannten Theaterporträtsammlung des Herrn Josef
R. von Frank in Graz illustriert. Bernhard von Schrütter, Daffinger und
Eybl sind die Künstler der zwölf Bildnisse. Im vorigen Jahr war der
Kalender mit Federzeichnungen nach Altwiener Bauten von Lili Rethi
geschmückt. 1924 waren Wiener Modebilder aus dem Jahr 1824, gestochen
von Franz Stöber und Philipp von Stubenrauch, wiedergegeben, 1922
lustige Lithographien von Anton Zampis, 1919 Blätter aus Schwinds
Almanach der Radierungen, der 1844 mit Versen von Feuchtersieben
erschienen ist, 1918 Figuren aus den »Wiener Kaufrufen«, die 1775
C- Brand gestochen hat, 1917, im ersten Band, Porträtlithographien von
Kriehuber. Artikel, deren Themen bald mehr, bald weniger mit der Gra-
phik zusammenhängen, gab es von Otto Erich Deutsch (über die Fran-
kische Theatersammlung), vom Schreiber dieser Zeilen (über Zampis),
von Hans Ankwicz-Kleehoven (über Lukas Cranach in Wien), von Leo
Grünstein (über Peter Fendi als Lehrer und Freund) und von Gustav
Glück (über Moritz von Schwind und seine Vaterstadt Wien).
Doch stellen diese Aufsätze selbstverständlich nur einen kleinen
Ausschnitt aus dem ebenso reichen wie mannigfaltigen Inhalt der bisher
erschienenen Bände dar. Von Mitarbeitern seien noch genannt Johann
Willibald Nagl, Adam Müller-Guttenbrunn, Enrika Handel-Mazzetti,
Wilhelm Englmann, Theodor Frimmel, der Herausgeber selbst, Josef
Schwerdfeger, Rudolf Payer-Thurn, Ludwig Böck, Eugen Guglia, Hans
Tietze, A.Crüwell, August Sauer,Otto H. Stowasser und Max Mayr; man
sieht, eine Auslese von erprobten Fachleuten und klangvollen Namen.
Die Ausstattung ist reich (in den ersten Bänden allerdings reicher
als in den letzten) und vornehm, und besonders zu loben ist der jedes-
mal wechselnde Einband im Altwiener Geschmack. Allen Verehrern
unserer teuren Vaterstadt sind die ebenso hübschen wie inhaltsreichen
Bände angelegentlichst zu empfehlen. Vivat sequens! A. W.
Salzburg und das Salzkammergut. Eine künst-
lerische Entdeckung in hundert Bildern des XIX. Jahr-
hunderts dargestellt von Heinrich Schwarz. Anton Schroll
& Co., Wien 1926.
Es war eine sehr hübsche Idee, das neue Naturgefühl, wie es in
der Malerei der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts zutage tritt, einmal
an einer bestimmten, dem damaligen Naturempfinden besonders entgegen-
kommenden Landschaft zu zeigen. Wollte man nördlich der Alpen bleiben.
^tS*w* ^r Natursch
daSkeinBla"
,*^5kiöe„bücher
^ n die
Müde* Wiener
r 1840 bis
indschaft
■VGrohmann, Kirch"
■Reiche Holzschn
,^r,n.Folge,Bd.b
von Handze.cl
^«ewäblt, die ibm
vfcosshuBt am ™drl
S im Meister wird durcr
^«1 durch die Wieder
-ITiiissicli umZeichnu
riÄge* eine solche
a ät aber bei einem
zäunte Ausdruck tiefst
^tahstücke einer erst
einzelne Zeichnimg
-rinesie auch schwachu
-3irjliichlich mehr von
■ ■.ii mit großer Sorgfalt-
.irjaieiigestellte Material
-dich sind - vergeben.
..sälabetaft innerer
^ jia daß er mir ma
weniger
und damit
:jkht im Durchblättern
: hinter
■33 ganz unzulänglichen
"-«gefüllte Werk eine
eiserner von den Wen
^%nwrden<.
William Ur
^ Pollak war vergans
-^'"isundinderBre
"a»ta Pyrenäen. Jedi
Zwischen
r'tah,t«rinlnnsbni
^-»er Gesellsc
16
, :nmS. deren PI;
^9 Schaft [-Ü,
wähnen, daß Mander ein Gemälde mit einer schlafenden Venus mit zwei
Satyrn vom Jahre 1604 anführt, dem wahrscheinlich diese Kreide-
zeichnung zugrunde liegt.
Die Landschaftenserie wird mit einer weiträumigen und virtuos
skizzierten Tallandschaft von Pieter Brueghel d. Ä. eröffnet, die das im
Mittel- und Hintergrund Hchtumflossene, hundertfache Detail von dem
kräftig gehaltenen Tiefenleiter des Vordergrundes zu trennen weiß
(Tafel 53). Der optische Eindruck des Künstlers löst sich wie in Scheu
vor der Überfülle des Xaturbildes in ungezählte Striche! und Punkte auf;
umgekehrt gewähren diese dem Betrachter das intensivste Erschauen
einer sich weit hinspannenden Welt. — Ganz im Gegensatz zu diesen
Femwirkungen stehen die noch im alten Geleise des Patinier und Herry
met de Bles schaffenden flämischen Landschafter wie Tobias Ver-
haecht (Tafel 59). Diese Braunschweiger Zeichnung enthält noch, und
zwar in vergröberter Form, alies Konventionelle in der Komposition und
auch die Zweifarbigkeit. Noch mehr jene von Paul Bril, >Landschaft mit
Reiter« (Tafel 57), die zu einem Wandgemälde im Palazzo Rospigliosi
gedient hat. Das Ganze gleicht mehr einem sich an den Rand drängenden
baumreichen Vordergrund mit schematisierendem Baumschlag. Natura-
listischer verhalten sich die von demselben Meister in Rom gezeichneten
Veduten, wenngleich auch sie malerische Ausschnitte geben und mit
Licht und Schatten geschickt hantieren, wie Tafel 56, »Blick vom Abhang
des Monte Cavallo«, erkennen läßt. Schließlich heben wir noch aus der
Serie eine dem Josse de Momper fraglich zugeschriebene Gebirgs-
landschaft hervor (Tafel 60), eine schon durch ihre eigenartige Technik
beachtenswerte Felsenkomposition mit einer blauschimmernden, an Salzburg
gemahnenden Bergfeste im Mittelgrunde. Wenn wir deren Reproduktion
richtig deuten, so handelt es sich um einen lackroten Konturabklatsch,
der dann mit dem Pinsel in Grün. Braun und Blau aquarellartig ausgeführt
wurde, ein Verfahren, das bei den Holländern und Flamen im Gebrauche
stand. Die Hauptkonturen verloren dadurch ihren persönlichen Charakter,
erhielten dagegen einen flüchtigen, mehr andeutenden Vortrag. Das
Original wird diesen Prozeß klarer erkennen lassen. Und eben aus diesen
Gründen erwachsen für die Benennung auf Momper, obgleich das Kom-
positionelle für ihn spricht, gewisse Schwierigkeiten.
Für die nächste projektierte Mappe, welche die Niederländer des
XVII. Jahrhunderts und zum Beschluße die Italiener und Franzosen zu
bringen gedenkt, so daß damit die Schätze des Braunschweiger Landes-
museums behoben zu sein scheinen, wünschen wir, daß der Herausgeber
die sonst so gute, wenn auch nicht gleich der Hamburger Mappe prunk-
volle Ausstattung mit etwas weniger kargem Texte versehen möge. Die
Angabe der früheren Besitzer der Zeichnungen, eventuell schon vor-
handener Literatur und der Wasserzeichen würden eine willkommene
Bereicherung bilden. Aber trotz dieser Lücken betrachten wir auch diese
Publikation als bemerkenswerte Verdienste des Autors und des Verlages.
Joseph Meder.
Altwiener Kalender für das Jahr 1917, 1918 und
1919 (Wien, Anton Schroll & Co.), 1922 und 1924 (Wien,
Wiener Drucke), 1925 und 1926 (Zürich-Leipzig-Wien,
Amalthea-Verlag). Herausgegeben von Alois Trost. Jedes-
mal mit ungefähr 30 bis 40 Abbildungen.
Als die Monarchie bereits in ihren Grundfesten erschüttert war,
als sich selbst Wien bedroht fühlte, ist der erste Band dieses Kalenders
erschienen. Je trostloser die Gegenwart wurde, desto eifriger flüchtete
man sich in die Vergangenheit. Aber wer tat dies? Die älteren Wiener,
die noch das alte Wien, wenn auch nicht gerade mehr das Wien der
Basteien, so doch das der vielverlästerten Makartzeit kannten und im
Herzen trugen. Die Wiener Jugend von heute hat leider noch viel weniger
historischen Sinn als die von ehedem, wobei zu bemerken ist. daß histo-
rischer Sinn niemals eine starke Seite der Wiener war. Das Schlagwort
vom neuen Leben hat auch hier viel Unheil gestiftet. Die Wiener jungen
Leute haben jetzt den Blick ins Ausland gerichtet, womöglich gleich nach
Amerika. Weil in der Vaterstadt die Verhältnisse so trübselig geworden
sind, so will man auch von ihr nichts mehr wissen. Daß es jetzt so gut
wie keine Viennensia-Auktionen mehr gibt, erklärt sich wohl nicht so
sehr aus dem mangelnden Angebot, sondern vielmehr aus dem er-
lahmenden Interesse an diesen Dingen. Aber doch ist das alte Wien
Trumpf, höre ich einwenden, erscheint eine Altwiener Publikation um die
andere. Das darf einen nicht beirren. Interesse daran hat doch nur die
ältere Generation, die Jugend, auf die es immer und überall ankommt,
weil ihr die Zukunft gehört, kümmert sich nicht darum. Oder ist das zu
pessimistisch geurteüt? Sollte wirklich mit der allmählich sich an-
bahnenden Abkehr vom Jazz, mit der Hand in Hand eine Rückkehr zum
Walzer zu erfolgen scheint, auch die echte Liebe zum alten Wien wieder
anfangen sachte aufzukeimen?
Unter den vielen Veröffentlichungen über Altwien, die. wie eben
angedeutet, in der letzten Zeit erschienen sind, ist der in Rede stehende
Kalender eine der allerbesten. Der Herausgeber, Alois Trost, der vor-
letzte Direktor des Museums der Stadt Wien, der auch in der Redaktion
der vorliegenden Zeitschrift als langjähriger ausgezeichneter Mitarbeiter
unvergessen bleibt, ist einer der feinsten und gründlichsten Kenner des
alten Wien, und der Kalender trägt völlig den Stempel seines eigenen Wesens:
er ist gediegen, reich an Anregungen, voll vornehmer Zurückhaltung und
geläuterten Geschmacks und durchglüht von inniger Liebe zu Wien.
Das dankenswerte Unternehmen bekam bereits ausgiebig die Un-
gunst der Zeiten zu spüren. In den Jahren 1920, 1921 und 1923 ist über-
haupt kein Band erschienen und seinen Verlag hat es schon zum zweiten-
mal gewechselt. Hoffentlich ist es beim Amalthea-Verlag, dem Österreich
bereits so vieles Schöne verdankt, in den sicheren Hafen eingelaufen.
Natürlich spielt in den einzelnen Bänden auch die Graphik eine
besondere Rolle. Sie ist es, die vor allem jedesmal die Monatsbilder bei-
steuert. Der Kalender des laufenden Jahres ist mit Wiedergaben von
Miniaturen aus der bekannten Theaterporträtsammlung des Herrn Josef
R. von Frank in Graz illustriert. Bernhard von Schrütter, Daffinger und
Eybl sind die Künstler der zwölf Bildnisse. Im vorigen Jahr war der
Kalender mit Federzeichnungen nach Altwiener Bauten von Lili Rethi
geschmückt. 1924 waren Wiener Modebilder aus dem Jahr 1824, gestochen
von Franz Stöber und Philipp von Stubenrauch, wiedergegeben, 1922
lustige Lithographien von Anton Zampis, 1919 Blätter aus Schwinds
Almanach der Radierungen, der 1844 mit Versen von Feuchtersieben
erschienen ist, 1918 Figuren aus den »Wiener Kaufrufen«, die 1775
C- Brand gestochen hat, 1917, im ersten Band, Porträtlithographien von
Kriehuber. Artikel, deren Themen bald mehr, bald weniger mit der Gra-
phik zusammenhängen, gab es von Otto Erich Deutsch (über die Fran-
kische Theatersammlung), vom Schreiber dieser Zeilen (über Zampis),
von Hans Ankwicz-Kleehoven (über Lukas Cranach in Wien), von Leo
Grünstein (über Peter Fendi als Lehrer und Freund) und von Gustav
Glück (über Moritz von Schwind und seine Vaterstadt Wien).
Doch stellen diese Aufsätze selbstverständlich nur einen kleinen
Ausschnitt aus dem ebenso reichen wie mannigfaltigen Inhalt der bisher
erschienenen Bände dar. Von Mitarbeitern seien noch genannt Johann
Willibald Nagl, Adam Müller-Guttenbrunn, Enrika Handel-Mazzetti,
Wilhelm Englmann, Theodor Frimmel, der Herausgeber selbst, Josef
Schwerdfeger, Rudolf Payer-Thurn, Ludwig Böck, Eugen Guglia, Hans
Tietze, A.Crüwell, August Sauer,Otto H. Stowasser und Max Mayr; man
sieht, eine Auslese von erprobten Fachleuten und klangvollen Namen.
Die Ausstattung ist reich (in den ersten Bänden allerdings reicher
als in den letzten) und vornehm, und besonders zu loben ist der jedes-
mal wechselnde Einband im Altwiener Geschmack. Allen Verehrern
unserer teuren Vaterstadt sind die ebenso hübschen wie inhaltsreichen
Bände angelegentlichst zu empfehlen. Vivat sequens! A. W.
Salzburg und das Salzkammergut. Eine künst-
lerische Entdeckung in hundert Bildern des XIX. Jahr-
hunderts dargestellt von Heinrich Schwarz. Anton Schroll
& Co., Wien 1926.
Es war eine sehr hübsche Idee, das neue Naturgefühl, wie es in
der Malerei der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts zutage tritt, einmal
an einer bestimmten, dem damaligen Naturempfinden besonders entgegen-
kommenden Landschaft zu zeigen. Wollte man nördlich der Alpen bleiben.
^tS*w* ^r Natursch
daSkeinBla"
,*^5kiöe„bücher
^ n die
Müde* Wiener
r 1840 bis
indschaft
■VGrohmann, Kirch"
■Reiche Holzschn
,^r,n.Folge,Bd.b
von Handze.cl
^«ewäblt, die ibm
vfcosshuBt am ™drl
S im Meister wird durcr
^«1 durch die Wieder
-ITiiissicli umZeichnu
riÄge* eine solche
a ät aber bei einem
zäunte Ausdruck tiefst
^tahstücke einer erst
einzelne Zeichnimg
-rinesie auch schwachu
-3irjliichlich mehr von
■ ■.ii mit großer Sorgfalt-
.irjaieiigestellte Material
-dich sind - vergeben.
..sälabetaft innerer
^ jia daß er mir ma
weniger
und damit
:jkht im Durchblättern
: hinter
■33 ganz unzulänglichen
"-«gefüllte Werk eine
eiserner von den Wen
^%nwrden<.
William Ur
^ Pollak war vergans
-^'"isundinderBre
"a»ta Pyrenäen. Jedi
Zwischen
r'tah,t«rinlnnsbni
^-»er Gesellsc
16
, :nmS. deren PI;
^9 Schaft [-Ü,