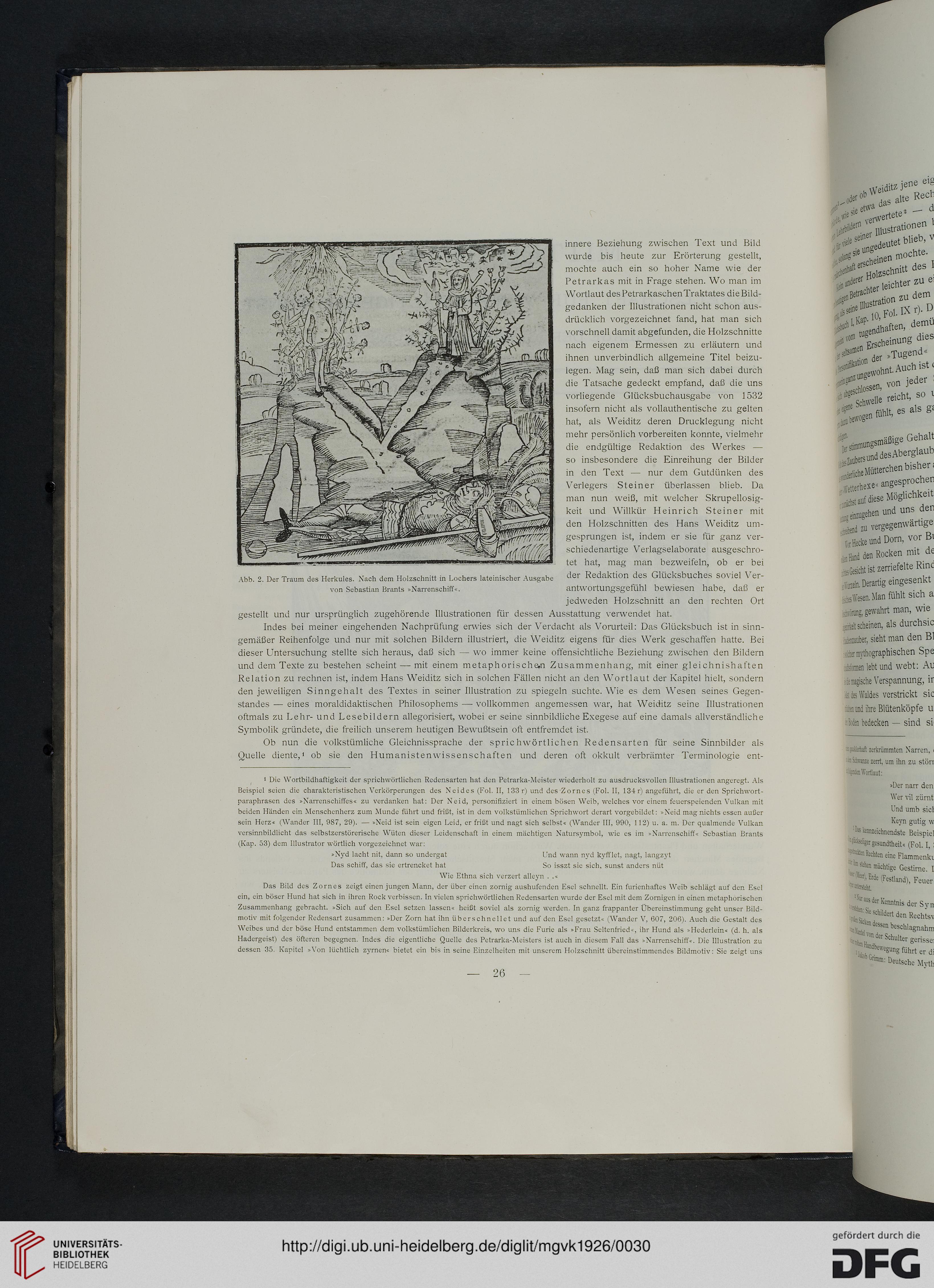innere Beziehung zwischen Text und Bild
wurde bis heute zur Erörterung gestellt,
mochte auch ein so hoher Name wie der
Petrarkas mit in Frage stehen. Wo man im
Wortlaut desPetrarkaschenTraktat.es dieBild-
gedanken der Illustrationen nicht schon aus-
drücklich vorgezeichnet fand, hat man sich
vorschnell damit abgefunden, die Holzschnitte
nach eigenem Ermessen zu erläutern und
ihnen unverbindlich allgemeine Titel beizu-
legen. Mag sein, daß man sich dabei durch
die Tatsache gedeckt empfand, daß die uns
vorliegende Glücksbuchausgabe von 1532
insofern nicht als vollauthentische zu gelten
hat, als Weiditz deren Drucklegung nicht
mehr persönlich vorbereiten konnte, vielmehr
die endgültige Redaktion des Werkes —
so insbesondere die Einreihung der Bilder
in den Text — nur dem Gutdünken des
Verlegers Steiner überlassen blieb. Da
man nun weiß, mit welcher Skrupellosig-
keit und Willkür Heinrich Steiner mit
den Holzschnitten des Hans Weiditz um-
gesprungen ist, indem er sie für ganz ver-
schiedenartige Verlagselaborate ausgeschro-
tet hat, mag man bezweifeln, ob er bei
der Redaktion des Glücksbuches soviel Ver-
antwortungsgefühl bewiesen habe, daß er
jedweden Holzschnitt an den rechten Ort
gestellt und nur ursprünglich zugehörende Illustrationen für dessen Ausstattung verwendet hat.
Indes bei meiner eingehenden Nachprüfung erwies sich der Verdacht als Vorurteil: Das Glücksbuch ist in sinn-
gemäßer Reihenfolge und nur mit solchen Bildern illustriert, die Weiditz eigens für dies Werk geschaffen hatte. Bei
dieser Untersuchung stellte sich heraus, daß sich — wo immer keine offensichtliche Beziehung zwischen den Bildern
und dem Texte zu bestehen scheint — mit einem metaphorischen Zusammenhang, mit einer gleichnishaften
Relation zu rechnen ist, indem Hans Weiditz sich in solchen Fällen nicht an den Wortlaut der Kapitel hielt, sondern
den jeweiligen Sinngehalt des Textes in seiner Illustration zu spiegeln suchte. Wie es dem Wesen seines Gegen-
standes — eines moraldidaktischen Philosophems — vollkommen angemessen war, hat Weiditz seine Illustrationen
oftmals zu Lehr- und Lesebildern allegorisiert, wobei er seine sinnbildliche Exegese auf eine damals allverständliche
Symbolik gründete, die freilich unserem heutigen Bewußtsein oft entfremdet ist.
Ob nun die volkstümliche Gleichnissprache der sprichwörtlichen Redensarten für seine Sinnbilder als
Quelle diente,' ob sie den Humanistenwissenschaften und deren oft okkult verbrämter Terminologie ent-
Abb. 2. Der Traum des Herkules. Nach dem Holzschnitt in Lochers lateinischer Ausgabe
von Sebastian Brants »Narrenschiff«.
1 Die Wortbildhaftigkeit der sprichwörtlichen Redensarten hat den Petrarka-Meister wiederholt zu ausdrucksvollen Illustrationen angeregt. Als
Beispiel seien die charakteristischen Verkörperungen des Neides (Fol. II, 133 r) und des-Zornes (Fol. II, 134 r) angeführt, die er den Sprichwort-
paraphrasen des »Narrenschiffes« zu verdanken hat: Der Neid, personifiziert in einem bösen Weib, welches vor einem feuerspeienden Vulkan mit
beiden Händen ein Menschenherz zum Munde führt und frißt, ist in dem volkstümlichen Sprichwort derart vorgebildet: »Neid mag nichts essen außer
sein Herz« (Wander III, 987, 29). — »Neid ist sein eigen Leid, er frißt und nagt sich selbst« (Wander III, 990, 112) u. a. m. Der qualmende Vulkan
versinnbildlicht das selbstzerstörerische Wüten dieser Leidenschaft in einem mächtigen Natursymbol, wie es im »Narrenschiff« Sebastian Brants
(Kap. 53) dem Illustrator wörtlich vorgezeichnet war:
»Nyd lacht nit, dann so undergat Und wann nyd kyfflet, nagt, langzyt
Das schiff, das sie ertrencket hat So isszt sie sich, sunst anders nüt
Wie Ethna sich verzert alleyn . .«
Das Bild des Zornes zeigt einen jungen Mann, der über einen zornig aushufenden Esel schnellt. Ein furienhaftes Weib schlägt auf den Esel
ein, ein böser Hund hat sich in ihren Rock verbissen. In vielen sprichwörtlichen Redensarten wurde der Esel mit dem Zornigen in einen metaphorischen
Zusammenhang gebracht. »Sich auf den Esel setzen lassen« heißt soviel als zornig werden. In ganz frappanter Obereinstimmung geht unser Bild-
motiv mit folgender Redensart zusammen: »Der Zorn hat ihn überschnellet und auf den Esel gesetzt« (Wander V, 607, 206). Auch die Gestalt des
Weibes und der böse Hund entstammen dem volkstümlichen Bilderkreis, wo uns die Furie als »Frau Seltenfried«, ihr Hund als »Hederlein« (d. h. als
Hadergeist) des öfteren begegnen. Indes die eigentliche Quelle des Petrarka-Meisters ist auch in diesem Fall das »Narrenschiff«. Die Illustration zu
dessen 35. Kapitel »Von lüchtlich zyrnen« bietet ein bis in seine Einzelheiten mit unserem Holzschnitt übereinstimmendes Bildmotiv: Sie zeigt uns
wurde bis heute zur Erörterung gestellt,
mochte auch ein so hoher Name wie der
Petrarkas mit in Frage stehen. Wo man im
Wortlaut desPetrarkaschenTraktat.es dieBild-
gedanken der Illustrationen nicht schon aus-
drücklich vorgezeichnet fand, hat man sich
vorschnell damit abgefunden, die Holzschnitte
nach eigenem Ermessen zu erläutern und
ihnen unverbindlich allgemeine Titel beizu-
legen. Mag sein, daß man sich dabei durch
die Tatsache gedeckt empfand, daß die uns
vorliegende Glücksbuchausgabe von 1532
insofern nicht als vollauthentische zu gelten
hat, als Weiditz deren Drucklegung nicht
mehr persönlich vorbereiten konnte, vielmehr
die endgültige Redaktion des Werkes —
so insbesondere die Einreihung der Bilder
in den Text — nur dem Gutdünken des
Verlegers Steiner überlassen blieb. Da
man nun weiß, mit welcher Skrupellosig-
keit und Willkür Heinrich Steiner mit
den Holzschnitten des Hans Weiditz um-
gesprungen ist, indem er sie für ganz ver-
schiedenartige Verlagselaborate ausgeschro-
tet hat, mag man bezweifeln, ob er bei
der Redaktion des Glücksbuches soviel Ver-
antwortungsgefühl bewiesen habe, daß er
jedweden Holzschnitt an den rechten Ort
gestellt und nur ursprünglich zugehörende Illustrationen für dessen Ausstattung verwendet hat.
Indes bei meiner eingehenden Nachprüfung erwies sich der Verdacht als Vorurteil: Das Glücksbuch ist in sinn-
gemäßer Reihenfolge und nur mit solchen Bildern illustriert, die Weiditz eigens für dies Werk geschaffen hatte. Bei
dieser Untersuchung stellte sich heraus, daß sich — wo immer keine offensichtliche Beziehung zwischen den Bildern
und dem Texte zu bestehen scheint — mit einem metaphorischen Zusammenhang, mit einer gleichnishaften
Relation zu rechnen ist, indem Hans Weiditz sich in solchen Fällen nicht an den Wortlaut der Kapitel hielt, sondern
den jeweiligen Sinngehalt des Textes in seiner Illustration zu spiegeln suchte. Wie es dem Wesen seines Gegen-
standes — eines moraldidaktischen Philosophems — vollkommen angemessen war, hat Weiditz seine Illustrationen
oftmals zu Lehr- und Lesebildern allegorisiert, wobei er seine sinnbildliche Exegese auf eine damals allverständliche
Symbolik gründete, die freilich unserem heutigen Bewußtsein oft entfremdet ist.
Ob nun die volkstümliche Gleichnissprache der sprichwörtlichen Redensarten für seine Sinnbilder als
Quelle diente,' ob sie den Humanistenwissenschaften und deren oft okkult verbrämter Terminologie ent-
Abb. 2. Der Traum des Herkules. Nach dem Holzschnitt in Lochers lateinischer Ausgabe
von Sebastian Brants »Narrenschiff«.
1 Die Wortbildhaftigkeit der sprichwörtlichen Redensarten hat den Petrarka-Meister wiederholt zu ausdrucksvollen Illustrationen angeregt. Als
Beispiel seien die charakteristischen Verkörperungen des Neides (Fol. II, 133 r) und des-Zornes (Fol. II, 134 r) angeführt, die er den Sprichwort-
paraphrasen des »Narrenschiffes« zu verdanken hat: Der Neid, personifiziert in einem bösen Weib, welches vor einem feuerspeienden Vulkan mit
beiden Händen ein Menschenherz zum Munde führt und frißt, ist in dem volkstümlichen Sprichwort derart vorgebildet: »Neid mag nichts essen außer
sein Herz« (Wander III, 987, 29). — »Neid ist sein eigen Leid, er frißt und nagt sich selbst« (Wander III, 990, 112) u. a. m. Der qualmende Vulkan
versinnbildlicht das selbstzerstörerische Wüten dieser Leidenschaft in einem mächtigen Natursymbol, wie es im »Narrenschiff« Sebastian Brants
(Kap. 53) dem Illustrator wörtlich vorgezeichnet war:
»Nyd lacht nit, dann so undergat Und wann nyd kyfflet, nagt, langzyt
Das schiff, das sie ertrencket hat So isszt sie sich, sunst anders nüt
Wie Ethna sich verzert alleyn . .«
Das Bild des Zornes zeigt einen jungen Mann, der über einen zornig aushufenden Esel schnellt. Ein furienhaftes Weib schlägt auf den Esel
ein, ein böser Hund hat sich in ihren Rock verbissen. In vielen sprichwörtlichen Redensarten wurde der Esel mit dem Zornigen in einen metaphorischen
Zusammenhang gebracht. »Sich auf den Esel setzen lassen« heißt soviel als zornig werden. In ganz frappanter Obereinstimmung geht unser Bild-
motiv mit folgender Redensart zusammen: »Der Zorn hat ihn überschnellet und auf den Esel gesetzt« (Wander V, 607, 206). Auch die Gestalt des
Weibes und der böse Hund entstammen dem volkstümlichen Bilderkreis, wo uns die Furie als »Frau Seltenfried«, ihr Hund als »Hederlein« (d. h. als
Hadergeist) des öfteren begegnen. Indes die eigentliche Quelle des Petrarka-Meisters ist auch in diesem Fall das »Narrenschiff«. Die Illustration zu
dessen 35. Kapitel »Von lüchtlich zyrnen« bietet ein bis in seine Einzelheiten mit unserem Holzschnitt übereinstimmendes Bildmotiv: Sie zeigt uns