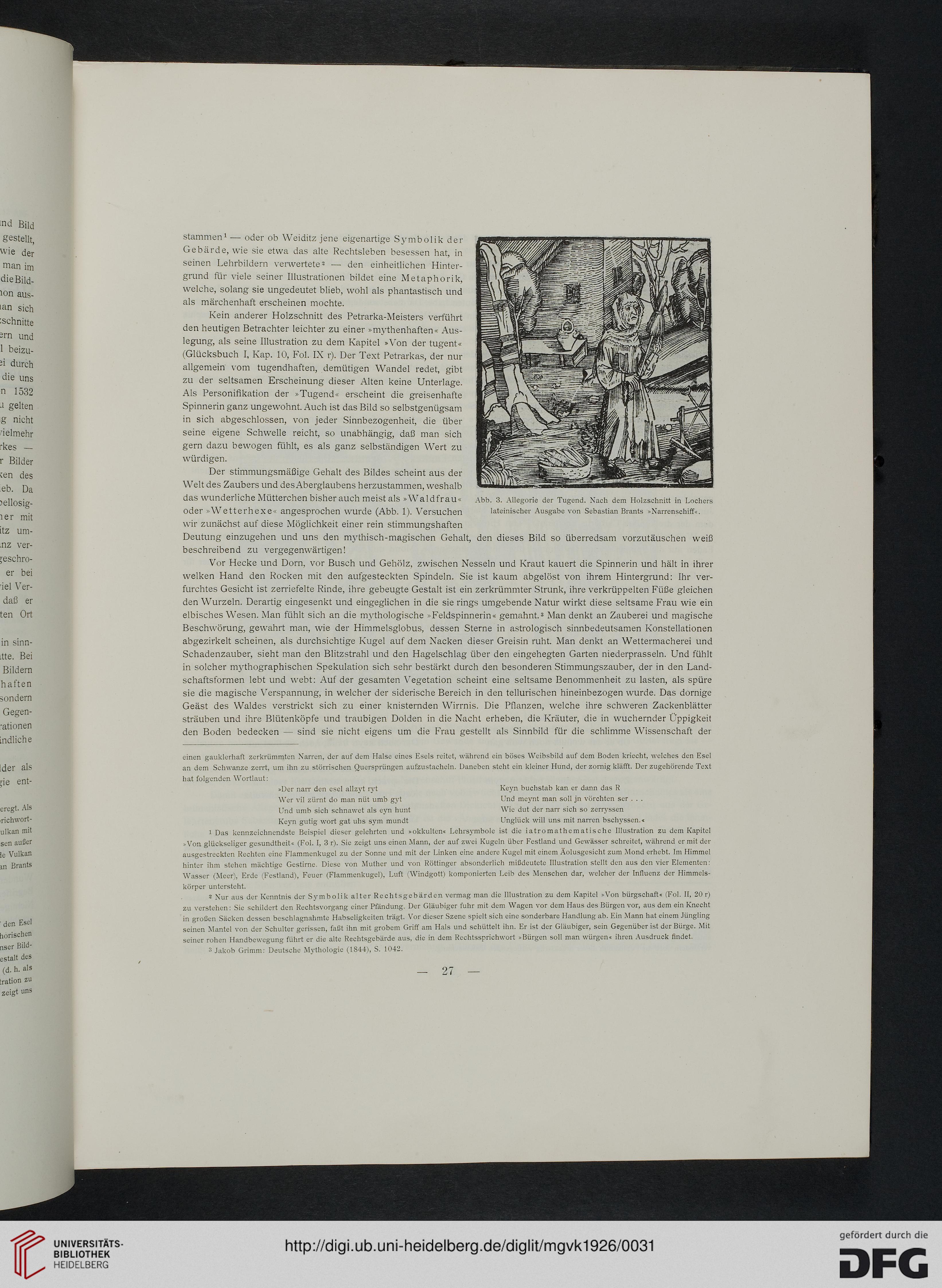stammen1 — oder ob Weiditz jene eigenartige Symbolik der
Gebärde, wie sie etwa das alte Rechtsleben besessen hat, in
seinen Lehrbildern verwertete2 — den einheitlichen Hinter-
grund für viele seiner Illustrationen bildet eine Metaphorik,
welche, solang sie ungedeutet blieb, wohl als phantastisch und
als märchenhaft erscheinen mochte.
Kein anderer Holzschnitt des Petrarka-Meisters verführt
den heutigen Betrachter leichter zu einer »mythenhaften« Aus-
legung, als seine Illustration zu dem Kapitel »Von der tugent«
(Glücksbuch I, Kap. 10, Fol. IX r). Der Text Petrarkas, der nur
allgemein vom tugendhaften, demütigen Wandel redet, gibt
zu der seltsamen Erscheinung dieser Alten keine Unterlage.
Als Personifikation der »Tugend« erscheint die greisenhafte
Spinnerin ganz ungewohnt. Auch ist das Bild so selbstgenügsam
in sich abgeschlossen, von jeder Sinnbezogenheit, die über
seine eigene Schwelle reicht, so unabhängig, daß man sich
gern dazu bewogen fühlt, es als ganz selbständigen Wert zu
würdigen.
Der stimmungsmäßige Gehalt des Bildes scheint aus der
Welt des Zaubers und des Aberglaubens herzustammen, weshalb
das wunderliche Mütterchen bisher auch meist als »Waldfrau«
oder »Wetterhexe« angesprochen wurde (Abb. 1). Versuchen
wir zunächst auf diese Möglichkeit einer rein Stimmungshaften
Deutung einzugehen und uns den mythisch-magischen Gehalt, den dieses Bild so überredsam vorzutäuschen weiß
beschreibend zu vergegenwärtigen!
Vor Hecke und Dorn, vor Busch und Gehölz, zwischen Nesseln und Kraut kauert die Spinnerin und hält in ihrer
welken Hand den Rocken mit den aufgesteckten Spindeln. Sie ist kaum abgelöst von ihrem Hintergrund: Ihr ver-
furchtes Gesicht ist zerriefelte Rinde, ihre gebeugte Gestalt ist ein zerkrümmter Strunk, ihre verkrüppelten Füße gleichen
den Wurzeln. Derartig eingesenkt und eingeglichen in die sie rings umgebende Natur wirkt diese seltsame Frau wie ein
elbisches Wesen. Man fühlt sich an die mythologische »Feldspinnerin« gemahnt.3 Man denkt an Zauberei und magische
Beschwörung, gewahrt man, wie der Himmelsglobus, dessen Sterne in astrologisch sinnbedeutsamen Konstellationen
abgezirkelt scheinen, als durchsichtige Kugel auf dem Nacken dieser Greisin ruht. Man denkt an Wettermacherei und
Schadenzauber, sieht man den Blitzstrahl und den Hagelschlag über den eingehegten Garten niederprasseln. Und fühlt
in solcher mythographischen Spekulation sich sehr bestärkt durch den besonderen Stimmungszauber, der in den Land-
schaftsformen lebt und webt: Auf der gesamten Vegetation scheint eine seltsame Benommenheit zu lasten, als spüre
sie die magische Verspannung, in welcher der siderische Bereich in den tellurischen hineinbezogen wurde. Das dornige
Geäst des Waldes verstrickt sich zu einer knisternden Wirrnis. Die Pflanzen, welche ihre schweren Zackenblätter
sträuben und ihre Blütenköpfe und traubigen Dolden in die Nacht erheben, die Kräuter, die in wuchernder Üppigkeit
den Boden bedecken — sind sie nicht eigens um die Frau gestellt als Sinnbild für die schlimme Wissenschaft der
einen gauklerhaft zerkrümraten Narren, der auf dem Halse eines Esels reitet, während ein böses Weibsbild auf dem Boden kriecht, welches den Esel
an dem Schwänze zerrt, um ihn zu störrischen Quersprüngen aufzustacheln. Daneben steht ein kleiner Hund, der zornig kläfft. Der zugehörende Text
hat folgenden Wortlaut:
»Der narr den esel allzj't ryt Keyn buchstab kan er dann das R
Wer vil zürnt do man nüt umb gyt Und meynt man soll jn vörchten ser . . .
Und umb sich schnawet als eyn hunt Wie dut der narr sich so zerryssen
Keyn gutig wort gat uhs sym mundt Unglück will uns mit narren bsehyssen.«
1 Das kennzeichnendste Beispiel dieser gelehrten und »okkulten« Lehrsymbole ist die iatromathematische Illustration zu dem Kapitel
»Von glückseliger gesundtheit« (Fol. I, 3 r). Sie zeigt uns einen Mann, der auf zwei Kugeln Uber Festland und Gewässer schreitet, während er mit der
ausgestreckten Rechten eine Flammenkugel zu der Sonne und mit der Linken eine andere Kugel mit einem Äolusgesicht zum Mond erhebt. Im Himmel
hinter ihm stehen mächtige Gestirne. Diese von Muther und von Röttinger absonderlich mißdeutete Illustration stellt den aus den vier Elementen:
Wasser (Meer), Erde (Festland), Feuer (Flammenkugel), Luft (Windgott) komponierten Leib des Menschen dar, welcher der Influenz der Himmels-
körper untersteht.
2 Nur aus der Kenntnis der Symbolik alter Rechtsgebärden vermag man die Illustration zu dem Kapitel »Von bürgschaft« (Fol. II, 20 r)
zu verstehen: Sie schildert den Rechtsvorgang einer Pfändung. Der Gläubiger fuhr mit dem Wagen vor dem Haus des Bürgen vor, aus dem ein Knecht
in großen Säcken dessen beschlagnahmte Habseligkeiten trägt. Vor dieser Szene spielt sich eine sonderbare Handlung ab. Ein Mann hat einem Jüngling
seinen Mantel von der Schulter gerissen, faßt ihn mit grobem Griff am Hals und schüttelt ihn. Er ist der Gläubiger, sein Gegenüber ist der Bürge. Mit
seiner rohen Handbewegung führt er die alte Rechtsgebärde aus. die in dem Rechtssprichwort »Bürgen soll man würgen« ihren Ausdruck findet.
3 Jakob Grimm: Deutsche Mythologie (1844), S. 1042.
Abb. 3. Allegorie der Tugend. Nach dem Holzschnitt in Lochers
lateinischer Ausgabe von Sebastian Brants »Narrenschiff«.
— 27 —
Gebärde, wie sie etwa das alte Rechtsleben besessen hat, in
seinen Lehrbildern verwertete2 — den einheitlichen Hinter-
grund für viele seiner Illustrationen bildet eine Metaphorik,
welche, solang sie ungedeutet blieb, wohl als phantastisch und
als märchenhaft erscheinen mochte.
Kein anderer Holzschnitt des Petrarka-Meisters verführt
den heutigen Betrachter leichter zu einer »mythenhaften« Aus-
legung, als seine Illustration zu dem Kapitel »Von der tugent«
(Glücksbuch I, Kap. 10, Fol. IX r). Der Text Petrarkas, der nur
allgemein vom tugendhaften, demütigen Wandel redet, gibt
zu der seltsamen Erscheinung dieser Alten keine Unterlage.
Als Personifikation der »Tugend« erscheint die greisenhafte
Spinnerin ganz ungewohnt. Auch ist das Bild so selbstgenügsam
in sich abgeschlossen, von jeder Sinnbezogenheit, die über
seine eigene Schwelle reicht, so unabhängig, daß man sich
gern dazu bewogen fühlt, es als ganz selbständigen Wert zu
würdigen.
Der stimmungsmäßige Gehalt des Bildes scheint aus der
Welt des Zaubers und des Aberglaubens herzustammen, weshalb
das wunderliche Mütterchen bisher auch meist als »Waldfrau«
oder »Wetterhexe« angesprochen wurde (Abb. 1). Versuchen
wir zunächst auf diese Möglichkeit einer rein Stimmungshaften
Deutung einzugehen und uns den mythisch-magischen Gehalt, den dieses Bild so überredsam vorzutäuschen weiß
beschreibend zu vergegenwärtigen!
Vor Hecke und Dorn, vor Busch und Gehölz, zwischen Nesseln und Kraut kauert die Spinnerin und hält in ihrer
welken Hand den Rocken mit den aufgesteckten Spindeln. Sie ist kaum abgelöst von ihrem Hintergrund: Ihr ver-
furchtes Gesicht ist zerriefelte Rinde, ihre gebeugte Gestalt ist ein zerkrümmter Strunk, ihre verkrüppelten Füße gleichen
den Wurzeln. Derartig eingesenkt und eingeglichen in die sie rings umgebende Natur wirkt diese seltsame Frau wie ein
elbisches Wesen. Man fühlt sich an die mythologische »Feldspinnerin« gemahnt.3 Man denkt an Zauberei und magische
Beschwörung, gewahrt man, wie der Himmelsglobus, dessen Sterne in astrologisch sinnbedeutsamen Konstellationen
abgezirkelt scheinen, als durchsichtige Kugel auf dem Nacken dieser Greisin ruht. Man denkt an Wettermacherei und
Schadenzauber, sieht man den Blitzstrahl und den Hagelschlag über den eingehegten Garten niederprasseln. Und fühlt
in solcher mythographischen Spekulation sich sehr bestärkt durch den besonderen Stimmungszauber, der in den Land-
schaftsformen lebt und webt: Auf der gesamten Vegetation scheint eine seltsame Benommenheit zu lasten, als spüre
sie die magische Verspannung, in welcher der siderische Bereich in den tellurischen hineinbezogen wurde. Das dornige
Geäst des Waldes verstrickt sich zu einer knisternden Wirrnis. Die Pflanzen, welche ihre schweren Zackenblätter
sträuben und ihre Blütenköpfe und traubigen Dolden in die Nacht erheben, die Kräuter, die in wuchernder Üppigkeit
den Boden bedecken — sind sie nicht eigens um die Frau gestellt als Sinnbild für die schlimme Wissenschaft der
einen gauklerhaft zerkrümraten Narren, der auf dem Halse eines Esels reitet, während ein böses Weibsbild auf dem Boden kriecht, welches den Esel
an dem Schwänze zerrt, um ihn zu störrischen Quersprüngen aufzustacheln. Daneben steht ein kleiner Hund, der zornig kläfft. Der zugehörende Text
hat folgenden Wortlaut:
»Der narr den esel allzj't ryt Keyn buchstab kan er dann das R
Wer vil zürnt do man nüt umb gyt Und meynt man soll jn vörchten ser . . .
Und umb sich schnawet als eyn hunt Wie dut der narr sich so zerryssen
Keyn gutig wort gat uhs sym mundt Unglück will uns mit narren bsehyssen.«
1 Das kennzeichnendste Beispiel dieser gelehrten und »okkulten« Lehrsymbole ist die iatromathematische Illustration zu dem Kapitel
»Von glückseliger gesundtheit« (Fol. I, 3 r). Sie zeigt uns einen Mann, der auf zwei Kugeln Uber Festland und Gewässer schreitet, während er mit der
ausgestreckten Rechten eine Flammenkugel zu der Sonne und mit der Linken eine andere Kugel mit einem Äolusgesicht zum Mond erhebt. Im Himmel
hinter ihm stehen mächtige Gestirne. Diese von Muther und von Röttinger absonderlich mißdeutete Illustration stellt den aus den vier Elementen:
Wasser (Meer), Erde (Festland), Feuer (Flammenkugel), Luft (Windgott) komponierten Leib des Menschen dar, welcher der Influenz der Himmels-
körper untersteht.
2 Nur aus der Kenntnis der Symbolik alter Rechtsgebärden vermag man die Illustration zu dem Kapitel »Von bürgschaft« (Fol. II, 20 r)
zu verstehen: Sie schildert den Rechtsvorgang einer Pfändung. Der Gläubiger fuhr mit dem Wagen vor dem Haus des Bürgen vor, aus dem ein Knecht
in großen Säcken dessen beschlagnahmte Habseligkeiten trägt. Vor dieser Szene spielt sich eine sonderbare Handlung ab. Ein Mann hat einem Jüngling
seinen Mantel von der Schulter gerissen, faßt ihn mit grobem Griff am Hals und schüttelt ihn. Er ist der Gläubiger, sein Gegenüber ist der Bürge. Mit
seiner rohen Handbewegung führt er die alte Rechtsgebärde aus. die in dem Rechtssprichwort »Bürgen soll man würgen« ihren Ausdruck findet.
3 Jakob Grimm: Deutsche Mythologie (1844), S. 1042.
Abb. 3. Allegorie der Tugend. Nach dem Holzschnitt in Lochers
lateinischer Ausgabe von Sebastian Brants »Narrenschiff«.
— 27 —