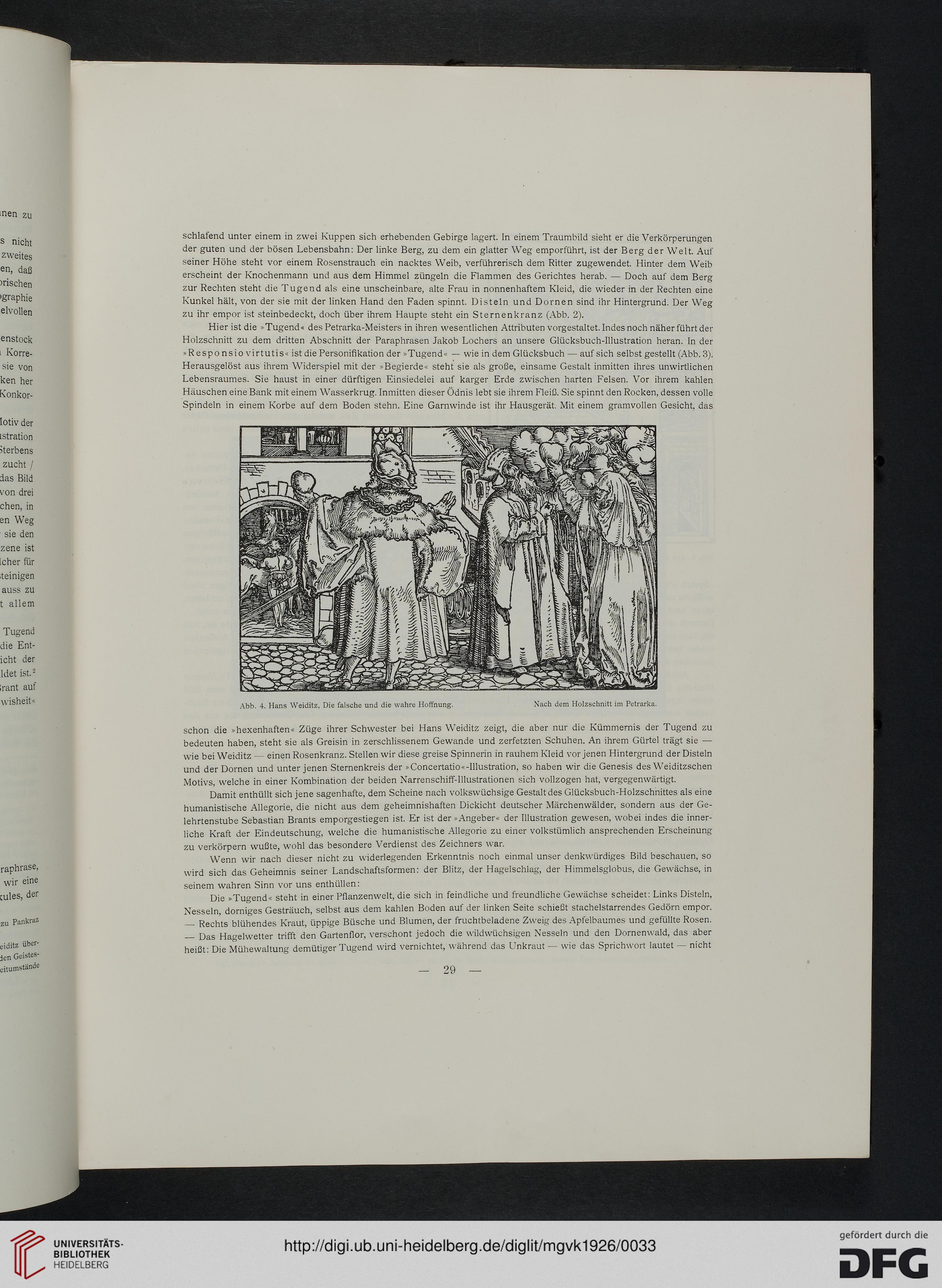nen zu
s nicht
zweites
en, daß
tischen
»graphie
elvollen
enstock
i Korre-
sie von
ken her
Konkor-
lotiv der
istration
Sterbens
zucht /
das Bild
von drei
chen, in
en Weg
sie den
zene ist
Icher für
iteinigen
auss zu
t allem
Tugend
die Ent-
icht der
ldet ist.2
irant auf
wisheit«
schlafend unter einem in zwei Kuppen sich erhebenden Gebirge lagert. In einem Traumbild sieht er die Verkörperungen
der guten und der bösen Lebensbahn: Der linke Berg, zu dem ein glatter Weg emporführt, ist der Berg der Welt. Auf
seiner Höhe steht vor einem Rosenstrauch ein nacktes Weib, verführerisch dem Ritter zugewendet. Hinter dem Weib
erscheint der Knochenmann und aus dem Himmel züngeln die Flammen des Gerichtes herab. — Doch auf dem Berg
zur Rechten steht die Tugend als eine unscheinbare, alte Frau in nonnenhaftem Kleid, die wieder in der Rechten eine
Kunkel hält, von der sie mit der linken Hand den Faden spinnt. Disteln und Dornen sind ihr Hintergrund. Der Weg
zu ihr empor ist steinbedeckt, doch über ihrem Haupte steht ein Sternenkranz (Abb. 2).
Hier ist die »Tugend« des Petrarka-Meisters in ihren wesentlichen Attributen vorgestaltet. Indes noch näher führt der
Holzschnitt zu dem dritten Abschnitt der Paraphrasen Jakob Lochers an unsere Glücksbuch-Illustration heran. In der
»Respo nsio virtutis« ist die Personifikation der »Tugend« — wie in dem Glücksbuch — auf sich selbst gestellt (Abb. 3).
Herausgelöst aus ihrem Widerspiel mit der »Begierde« steht sie als große, einsame Gestalt inmitten ihres unwirtlichen
Lebensraumes. Sie haust in einer dürftigen Einsiedelei auf karger Erde zwischen harten Felsen. Vor ihrem kahlen
Häuschen eine Bank mit einem Wasserkrug. Inmitten dieser Ödnis lebt sie ihrem Fleiß. Sie spinnt den Rocken, dessen volle
Spindeln in einem Korbe auf dem Boden Stenn. Eine Garnwinde ist ihr Hausgerät. Mit einem gramvollen Gesicht, das
Abb. 4. Hans Weiditz, Die falsche und die wahre Hoffnung.
Nach dem Holzschnitt im Petrarka
raphrase,
wir eine
cules, der
zu Pankraz
eiditz Über-
jen Geistes-
eitumstände
schon die »hexenhaften« Züge ihrer Schwester bei Hans Weiditz zeigt, die aber nur die Kümmernis der Tugend zu
bedeuten haben, steht sie als Greisin in zerschlissenem Gewände und zerfetzten Schuhen. An ihrem Gürtel trägt sie —
wie bei Weiditz — einen Rosenkranz. Stellen wir diese greise Spinnerin in rauhem Kleid vor jenen Hintergrund der Disteln
und der Dornen und unter jenen Sternenkreis der »Concertatio«-Illustration, so haben wir die Genesis des Weiditzschen
Motivs, welche in einer Kombination der beiden Narrenschiff-Illustrationen sich vollzogen hat, vergegenwärtigt.
Damit enthüllt sich jene sagenhafte, dem Scheine nach volkswüchsige Gestalt des Glücksbuch-Holzschnittes als eine
humanistische Allegorie, die nicht aus dem geheimnishaften Dickicht deutscher Märchenwälder, sondern aus der Ge-
lehrtenstube Sebastian Brants emporgestiegen ist. Er ist der »Angeber« der Illustration gewesen, wobei indes die inner-
liche Kraft der Eindeutschung, welche die humanistische Allegorie zu einer volkstümlich ansprechenden Erscheinung
zu verkörpern wußte, wohl das besondere Verdienst des Zeichners war.
Wenn wir nach dieser nicht zu widerlegenden Erkenntnis noch einmal unser denkwürdiges Bild beschauen, so
wird sich das Geheimnis seiner Landschaftsformen: der Blitz, der Hagelschlag, der Himmelsglobus, die Gewächse, in
seinem wahren Sinn vor uns enthüllen:
Die »Tugend« steht in einer Pflanzenwelt, die sich in feindliche und freundliche Gewächse scheidet: Links Disteln,
Nesseln, dorniges Gesträuch, selbst aus dem kahlen Boden auf der linken Seite schießt stachelstarrendes Gedörn empor.
_ Rechts blühendes Kraut, üppige Büsche und Blumen, der fruchtbeladene Zweig des Apfelbaumes und gefüllte Rosen.
_ rjas Hagelwetter trifft den Gartenflor, verschont jedoch die wildwüchsigen Nesseln und den Dornenwald, das aber
heißt: Die Mühewaltung demütiger Tugend wird vernichtet, während das Unkraut — wie das Sprichwort lautet — nicht
— 29 —
s nicht
zweites
en, daß
tischen
»graphie
elvollen
enstock
i Korre-
sie von
ken her
Konkor-
lotiv der
istration
Sterbens
zucht /
das Bild
von drei
chen, in
en Weg
sie den
zene ist
Icher für
iteinigen
auss zu
t allem
Tugend
die Ent-
icht der
ldet ist.2
irant auf
wisheit«
schlafend unter einem in zwei Kuppen sich erhebenden Gebirge lagert. In einem Traumbild sieht er die Verkörperungen
der guten und der bösen Lebensbahn: Der linke Berg, zu dem ein glatter Weg emporführt, ist der Berg der Welt. Auf
seiner Höhe steht vor einem Rosenstrauch ein nacktes Weib, verführerisch dem Ritter zugewendet. Hinter dem Weib
erscheint der Knochenmann und aus dem Himmel züngeln die Flammen des Gerichtes herab. — Doch auf dem Berg
zur Rechten steht die Tugend als eine unscheinbare, alte Frau in nonnenhaftem Kleid, die wieder in der Rechten eine
Kunkel hält, von der sie mit der linken Hand den Faden spinnt. Disteln und Dornen sind ihr Hintergrund. Der Weg
zu ihr empor ist steinbedeckt, doch über ihrem Haupte steht ein Sternenkranz (Abb. 2).
Hier ist die »Tugend« des Petrarka-Meisters in ihren wesentlichen Attributen vorgestaltet. Indes noch näher führt der
Holzschnitt zu dem dritten Abschnitt der Paraphrasen Jakob Lochers an unsere Glücksbuch-Illustration heran. In der
»Respo nsio virtutis« ist die Personifikation der »Tugend« — wie in dem Glücksbuch — auf sich selbst gestellt (Abb. 3).
Herausgelöst aus ihrem Widerspiel mit der »Begierde« steht sie als große, einsame Gestalt inmitten ihres unwirtlichen
Lebensraumes. Sie haust in einer dürftigen Einsiedelei auf karger Erde zwischen harten Felsen. Vor ihrem kahlen
Häuschen eine Bank mit einem Wasserkrug. Inmitten dieser Ödnis lebt sie ihrem Fleiß. Sie spinnt den Rocken, dessen volle
Spindeln in einem Korbe auf dem Boden Stenn. Eine Garnwinde ist ihr Hausgerät. Mit einem gramvollen Gesicht, das
Abb. 4. Hans Weiditz, Die falsche und die wahre Hoffnung.
Nach dem Holzschnitt im Petrarka
raphrase,
wir eine
cules, der
zu Pankraz
eiditz Über-
jen Geistes-
eitumstände
schon die »hexenhaften« Züge ihrer Schwester bei Hans Weiditz zeigt, die aber nur die Kümmernis der Tugend zu
bedeuten haben, steht sie als Greisin in zerschlissenem Gewände und zerfetzten Schuhen. An ihrem Gürtel trägt sie —
wie bei Weiditz — einen Rosenkranz. Stellen wir diese greise Spinnerin in rauhem Kleid vor jenen Hintergrund der Disteln
und der Dornen und unter jenen Sternenkreis der »Concertatio«-Illustration, so haben wir die Genesis des Weiditzschen
Motivs, welche in einer Kombination der beiden Narrenschiff-Illustrationen sich vollzogen hat, vergegenwärtigt.
Damit enthüllt sich jene sagenhafte, dem Scheine nach volkswüchsige Gestalt des Glücksbuch-Holzschnittes als eine
humanistische Allegorie, die nicht aus dem geheimnishaften Dickicht deutscher Märchenwälder, sondern aus der Ge-
lehrtenstube Sebastian Brants emporgestiegen ist. Er ist der »Angeber« der Illustration gewesen, wobei indes die inner-
liche Kraft der Eindeutschung, welche die humanistische Allegorie zu einer volkstümlich ansprechenden Erscheinung
zu verkörpern wußte, wohl das besondere Verdienst des Zeichners war.
Wenn wir nach dieser nicht zu widerlegenden Erkenntnis noch einmal unser denkwürdiges Bild beschauen, so
wird sich das Geheimnis seiner Landschaftsformen: der Blitz, der Hagelschlag, der Himmelsglobus, die Gewächse, in
seinem wahren Sinn vor uns enthüllen:
Die »Tugend« steht in einer Pflanzenwelt, die sich in feindliche und freundliche Gewächse scheidet: Links Disteln,
Nesseln, dorniges Gesträuch, selbst aus dem kahlen Boden auf der linken Seite schießt stachelstarrendes Gedörn empor.
_ Rechts blühendes Kraut, üppige Büsche und Blumen, der fruchtbeladene Zweig des Apfelbaumes und gefüllte Rosen.
_ rjas Hagelwetter trifft den Gartenflor, verschont jedoch die wildwüchsigen Nesseln und den Dornenwald, das aber
heißt: Die Mühewaltung demütiger Tugend wird vernichtet, während das Unkraut — wie das Sprichwort lautet — nicht
— 29 —