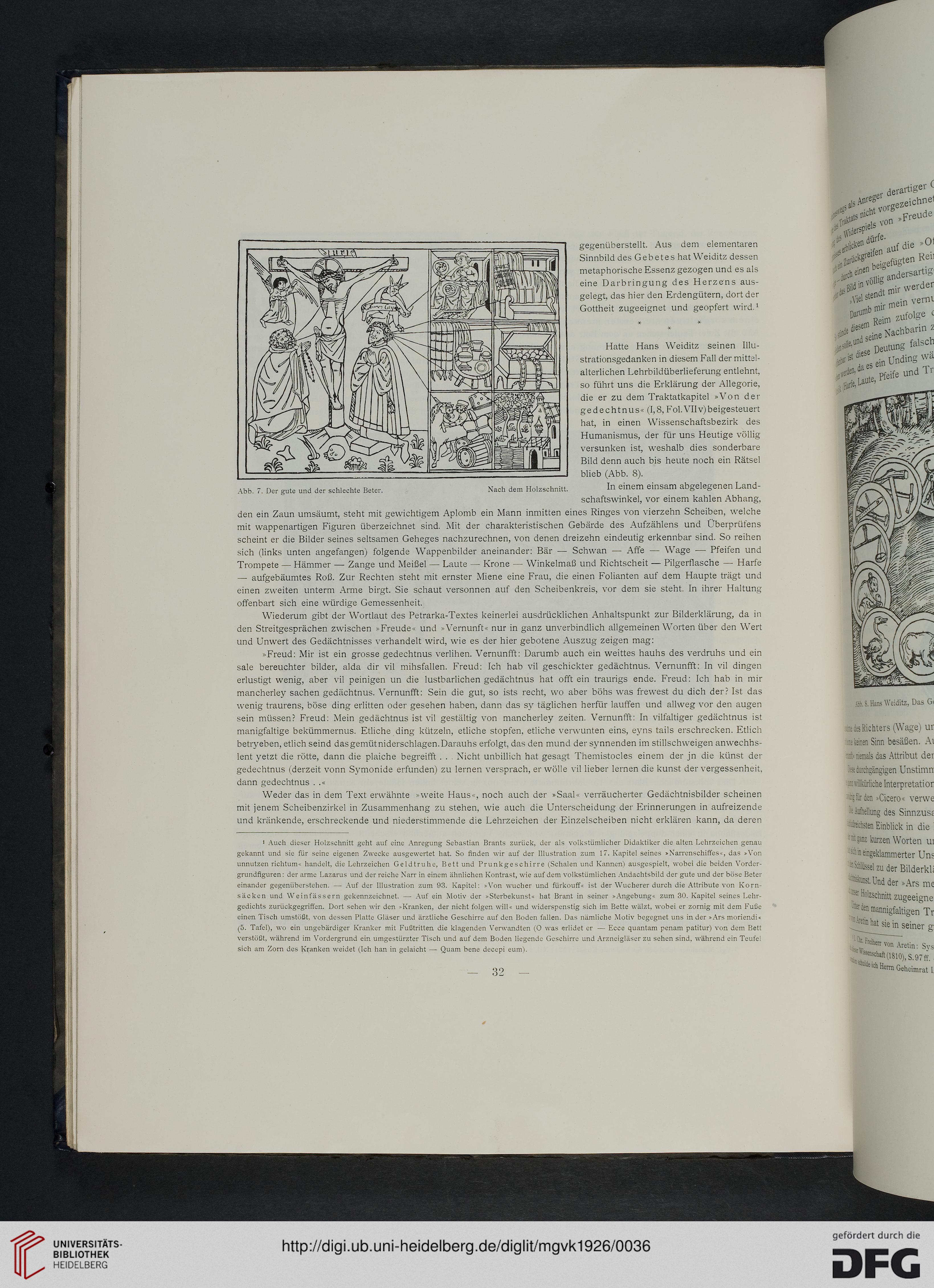gegenüberstellt. Aus dem elementaren
Sinnbild des Gebetes hat Weiditz dessen
metaphorische Essenz gezogen und es als
eine Darbringung des Herzens aus-
gelegt, das hier den Erdengütern, dort der
Gottheit zugeeignet und geopfert wird.1
Hatte Hans Weiditz seinen Illu-
strationsgedanken in diesem Fall der mittel-
alterlichen Lehrbildüberlieferung entlehnt,
so führt uns die Erklärung der Allegorie,
die er zu dem Traktatkapitel »Von der
gedechtnus« (1,8, Fol.VIIv)beigesteuert
hat, in einen Wissenschaftsbezirk des
Humanismus, der für uns Heutige völlig
versunken ist, weshalb dies sonderbare
Bild denn auch bis heute noch ein Rätsel
blieb (Abb. 8).
In einem einsam abgelegenen Land-
schaftswinkel, vor einem kahlen Abhang,
den ein Zaun umsäumt, steht mit gewichtigem Aplomb ein Mann inmitten eines Ringes von vierzehn Scheiben, welche
mit wappenartigen Figuren überzeichnet sind. Mit der charakteristischen Gebärde des Aufzählens und Überprüfens
scheint er die Bilder seines seltsamen Geheges nachzurechnen, von denen dreizehn eindeutig erkennbar sind. So reihen
sich (links unten angefangen) folgende Wappenbilder aneinander: Bär — Schwan — Affe — Wage — Pfeifen und
Trompete — Hämmer — Zange und Meißel — Laute — Krone — Winkelmaß und Richtscheit — Pilgerflasche — Harfe
— aufgebäumtes Roß. Zur Rechten steht mit ernster Miene eine Frau, die einen Folianten auf dem Haupte trägt und
einen zweiten unterm Arme birgt. Sie schaut versonnen auf den Scheibenkreis, vor dem sie steht. In ihrer Haltung
offenbart sich eine würdige Gemessenheit.
Wiederum gibt der Wortlaut des Petrarka-Textes keinerlei ausdrücklichen Anhaltspunkt zur Bilderklärung, da in
den Streitgesprächen zwischen »Freude« und »Vernunft« nur in ganz unverbindlich allgemeinen Worten über den Wert
und Unwert des Gedächtnisses verhandelt wird, wie es der hier gebotene Auszug zeigen mag:
»Freud: Mir ist ein grosse gedechtnus verlihen. Vernunfft: Darumb auch ein weittes hauhs des verdruhs und ein
sale bereuchter bilder, alda dir vil mihsfallen. Freud: Ich hab vil geschickter gedächtnus. Vernunfft: In vil dingen
erlustigt wenig, aber vil peinigen un die lustbarlichen gedächtnus hat offt ein traurigs ende. Freud: Ich hab in mir
mancherley sachen gedächtnus. Vernunfft: Sein die gut, so ists recht, wo aber böhs was frewest du dich der? Ist das
wenig traurens, böse ding erlitten oder gesehen haben, dann das sy täglichen herfür lauffen und allweg vor den äugen
sein müssen? Freud: Mein gedächtnus ist vil gestältig von mancherley Zeiten. Vernunfft: In vilfaltiger gedächtnus ist
manigfaltige bekümmernus. Etliche ding kützeln, etliche stopfen, etliche verwunten eins, eyns tails erschrecken. Etlich
betryeben, etlich seind dasgemütniderschlagen.Darauhs erfolgt, das den mund der synnenden im stillschweigen anwechhs-
lent yetzt die rotte, dann die plaiche begreifft . . . Nicht unbillich hat gesagt Themistocles einem der jn die künst der
gedechtnus (derzeit vonn S\'monide erfunden) zu lernen versprach, er wolle vil lieber lernen die kunst der Vergessenheit,
dann gedechtnus . .«
Weder das in dem Text erwähnte »weite Haus«, noch auch der »Saal« verräucherter Gedächtnisbilder scheinen
mit jenem Scheibenzirkel in Zusammenhang zu stehen, wie auch die Unterscheidung der Erinnerungen in aufreizende
und kränkende, erschreckende und niederstimmende die Lehrzeichen der Einzelscheiben nicht erklären kann, da deren
i Auch dieser Holzschnitt geht auf eine Anregung Sebastian Brants zurück, der als volkstümlicher Didaktiker die alten Lehrzeichen genau
gekannt und sie für seine eigenen Zwecke ausgewertet hat. So finden wir auf der Illustration zum 17. Kapitel seines »N'arrenschiffes«, das >Von
unnutzen richtum« handelt, die Lehrzeichen Geldtruhe, Bett und Prunkgeschirre (Schalen und Kannen) ausgespielt, wobei die beiden Vorder-
grundfiguren : der arme Lazarus und der reiche Narr in einem ähnlichen Kontrast, wie auf dem volkstümlichen Andachtsbild der gute und der bose Beter
einander gegenüberstehen. — Auf der Illustration zum 93. Kapitel: >Von wucher und fürkouff« ist der Wucherer durch die Attribute von Korn-
säcken und Weinfässern gekennzeichnet. — Auf ein Motiv der >Sterbekunst« hat Brant in seiner »Angebung« zum 30. Kapitel seines Lehr-
gedichts zurückgegriffen. Dort sehen wir den -Kranken, der nicht folgen will« und widerspenstig sich im Bette wälzt, wobei er zornig mit dem Fuße
einen Tisch umstößt, von dessen Platte Gläser und ärztliche Geschirre auf den Boden fallen. Das nämliche Motiv begegnet uns in der >Ars moriendi«
(5. Tafel), wo ein ungebärdiger Kranker mit Fußtritten die klagenden Verwandten (0 was erlidet er — Ecce quantam penam patitur) von dem Bett
verstoßt, während im Vordergrund ein umgestürzter Tisch und auf dem Boden liegende Geschirre und Arzneigläser zu sehen sind, während ein Teufel
sich am Zorn des Kranken weidet (Ich han in gelaicht — Quam bene decepi eumV
Abb. 7. Der gute und der schlechte Beter. Nach dem Holzschnitt.
— 32 —
Sinnbild des Gebetes hat Weiditz dessen
metaphorische Essenz gezogen und es als
eine Darbringung des Herzens aus-
gelegt, das hier den Erdengütern, dort der
Gottheit zugeeignet und geopfert wird.1
Hatte Hans Weiditz seinen Illu-
strationsgedanken in diesem Fall der mittel-
alterlichen Lehrbildüberlieferung entlehnt,
so führt uns die Erklärung der Allegorie,
die er zu dem Traktatkapitel »Von der
gedechtnus« (1,8, Fol.VIIv)beigesteuert
hat, in einen Wissenschaftsbezirk des
Humanismus, der für uns Heutige völlig
versunken ist, weshalb dies sonderbare
Bild denn auch bis heute noch ein Rätsel
blieb (Abb. 8).
In einem einsam abgelegenen Land-
schaftswinkel, vor einem kahlen Abhang,
den ein Zaun umsäumt, steht mit gewichtigem Aplomb ein Mann inmitten eines Ringes von vierzehn Scheiben, welche
mit wappenartigen Figuren überzeichnet sind. Mit der charakteristischen Gebärde des Aufzählens und Überprüfens
scheint er die Bilder seines seltsamen Geheges nachzurechnen, von denen dreizehn eindeutig erkennbar sind. So reihen
sich (links unten angefangen) folgende Wappenbilder aneinander: Bär — Schwan — Affe — Wage — Pfeifen und
Trompete — Hämmer — Zange und Meißel — Laute — Krone — Winkelmaß und Richtscheit — Pilgerflasche — Harfe
— aufgebäumtes Roß. Zur Rechten steht mit ernster Miene eine Frau, die einen Folianten auf dem Haupte trägt und
einen zweiten unterm Arme birgt. Sie schaut versonnen auf den Scheibenkreis, vor dem sie steht. In ihrer Haltung
offenbart sich eine würdige Gemessenheit.
Wiederum gibt der Wortlaut des Petrarka-Textes keinerlei ausdrücklichen Anhaltspunkt zur Bilderklärung, da in
den Streitgesprächen zwischen »Freude« und »Vernunft« nur in ganz unverbindlich allgemeinen Worten über den Wert
und Unwert des Gedächtnisses verhandelt wird, wie es der hier gebotene Auszug zeigen mag:
»Freud: Mir ist ein grosse gedechtnus verlihen. Vernunfft: Darumb auch ein weittes hauhs des verdruhs und ein
sale bereuchter bilder, alda dir vil mihsfallen. Freud: Ich hab vil geschickter gedächtnus. Vernunfft: In vil dingen
erlustigt wenig, aber vil peinigen un die lustbarlichen gedächtnus hat offt ein traurigs ende. Freud: Ich hab in mir
mancherley sachen gedächtnus. Vernunfft: Sein die gut, so ists recht, wo aber böhs was frewest du dich der? Ist das
wenig traurens, böse ding erlitten oder gesehen haben, dann das sy täglichen herfür lauffen und allweg vor den äugen
sein müssen? Freud: Mein gedächtnus ist vil gestältig von mancherley Zeiten. Vernunfft: In vilfaltiger gedächtnus ist
manigfaltige bekümmernus. Etliche ding kützeln, etliche stopfen, etliche verwunten eins, eyns tails erschrecken. Etlich
betryeben, etlich seind dasgemütniderschlagen.Darauhs erfolgt, das den mund der synnenden im stillschweigen anwechhs-
lent yetzt die rotte, dann die plaiche begreifft . . . Nicht unbillich hat gesagt Themistocles einem der jn die künst der
gedechtnus (derzeit vonn S\'monide erfunden) zu lernen versprach, er wolle vil lieber lernen die kunst der Vergessenheit,
dann gedechtnus . .«
Weder das in dem Text erwähnte »weite Haus«, noch auch der »Saal« verräucherter Gedächtnisbilder scheinen
mit jenem Scheibenzirkel in Zusammenhang zu stehen, wie auch die Unterscheidung der Erinnerungen in aufreizende
und kränkende, erschreckende und niederstimmende die Lehrzeichen der Einzelscheiben nicht erklären kann, da deren
i Auch dieser Holzschnitt geht auf eine Anregung Sebastian Brants zurück, der als volkstümlicher Didaktiker die alten Lehrzeichen genau
gekannt und sie für seine eigenen Zwecke ausgewertet hat. So finden wir auf der Illustration zum 17. Kapitel seines »N'arrenschiffes«, das >Von
unnutzen richtum« handelt, die Lehrzeichen Geldtruhe, Bett und Prunkgeschirre (Schalen und Kannen) ausgespielt, wobei die beiden Vorder-
grundfiguren : der arme Lazarus und der reiche Narr in einem ähnlichen Kontrast, wie auf dem volkstümlichen Andachtsbild der gute und der bose Beter
einander gegenüberstehen. — Auf der Illustration zum 93. Kapitel: >Von wucher und fürkouff« ist der Wucherer durch die Attribute von Korn-
säcken und Weinfässern gekennzeichnet. — Auf ein Motiv der >Sterbekunst« hat Brant in seiner »Angebung« zum 30. Kapitel seines Lehr-
gedichts zurückgegriffen. Dort sehen wir den -Kranken, der nicht folgen will« und widerspenstig sich im Bette wälzt, wobei er zornig mit dem Fuße
einen Tisch umstößt, von dessen Platte Gläser und ärztliche Geschirre auf den Boden fallen. Das nämliche Motiv begegnet uns in der >Ars moriendi«
(5. Tafel), wo ein ungebärdiger Kranker mit Fußtritten die klagenden Verwandten (0 was erlidet er — Ecce quantam penam patitur) von dem Bett
verstoßt, während im Vordergrund ein umgestürzter Tisch und auf dem Boden liegende Geschirre und Arzneigläser zu sehen sind, während ein Teufel
sich am Zorn des Kranken weidet (Ich han in gelaicht — Quam bene decepi eumV
Abb. 7. Der gute und der schlechte Beter. Nach dem Holzschnitt.
— 32 —