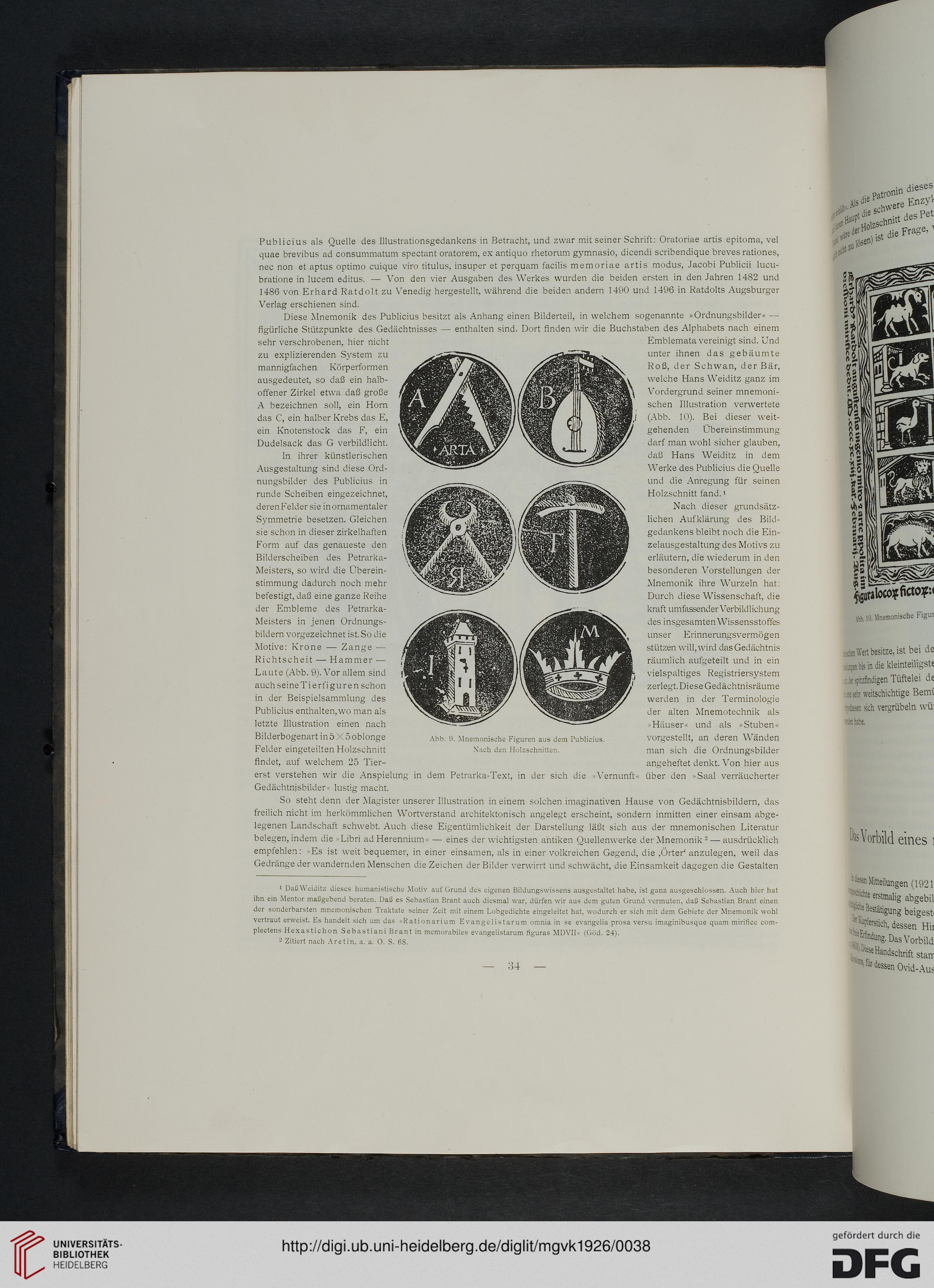Publicius als Quelle des Illustrationsgedankens in Betracht, und zwar mit seiner Schrift: Oratoriae artis epitoma, vel
quae brevibus ad consummatum spectant oratorem, ex antiquo rhetorum gymnasio, dicendi scribendique breves rationes,
nec non et aptus optimo cuique viro titulus, insuper et perquam facilis memoriae artis modus, Jacobi Publicii lucu-
bratione in lucem editus. — Von den vier Ausgaben des Werkes wurden die beiden ersten in den Jahren 1482 und
1486 von Erhard Ratdolt zu Venedig hergestellt, während die beiden andern 1490 und 1496 in Ratdolts Augsburger
Verlag erschienen sind.
Diese Mnemonik des Publicius besitzt als Anhang einen Bilderteil, in welchem sogenannte »Ordnungsbilder« —
figürliche Stützpunkte des Gedächtnisses — enthalten sind. Dort finden wir die Buchstaben des Alphabets nach einem
sehr verschrobenen, hier nicht
zu explizierenden System zu
mannigfachen Körperformen
ausgedeutet, so daß ein halb-
offener Zirkel etwa daß große
A bezeichnen soll, ein Horn
das C, ein halber Krebs das E,
ein Knotenstock das F, ein
Dudelsack das G verbildlicht.
In ihrer künstlerischen
Ausgestaltung sind diese Ord-
nungsbilder des Publicius in
runde Scheiben eingezeichnet,
deren Felder sie in ornamentaler
Symmetrie besetzen. Gleichen
sie schon in dieser zirkelhaften
Form auf das genaueste den
Bilderscheiben des Petrarka-
Meisters, so wird die Überein-
stimmung dadurch noch mehr
befestigt, daß eine ganze Reihe
der Embleme des Petrarka-
Meisters in jenen Ordnungs-
bildern vorgezeichnet ist. So die
Motive: Krone — Zange —
Richtscheit — Hammer —
Laute (Abb. 9). Vor allem sind
auchseineTierfiguren schon
in der Beispielsammlung des
Publicius enthalten, wo man als
letzte Illustration einen nach
Bilderbogenart in 5 X 5 oblonge
Felder eingeteilten Holzschnitt
Abb. 9. Mnemonische Figuren aus dem Publicius.
Nach den Holzschnitten.
Emblemata vereinigt sind. Und
unter ihnen das gebäumte
Roß, der Schwan, der Bär,
welche Hans Weiditz ganz im
Vordergrund seiner mnemoni-
schen Illustration verwertete
(Abb. 10). Bei dieser weit-
gehenden Übereinstimmung
darf man wohl sicher glauben,
daß Hans Weiditz in dem
Werke des Publicius die Quelle
und die Anregung für seinen
Holzschnitt fand, i
Nach dieser grundsätz-
lichen Aufklärung des Bild-
gedankens bleibt noch die Ein-
zelausgestaltung des Motivs zu
erläutern, die wiederum in den
besonderen Vorstellungen der
Mnemonik ihre Wurzeln hat:
Durch diese Wissenschaft, die
kraft umfassender Verbildlichung
des insgesamten Wissensstoffes
unser Erinnerungsvermögen
stützen will, wird das Gedächtnis
räumlich aufgeteilt und in ein
vielspaltiges Registriersystem
zerlegt. Diese Gedächtnisräume
werden in der Terminologie
der alten Mnemotechnik als
»Häuser« und als »Stuben«
vorgestellt, an deren Wänden
man sich die Ordnungsbilder
angeheftet denkt. Von hier aus
über den »Saal verräucherter
findet, auf welchem 25 Tier-
erst verstehen wir die Anspielung in dem Petrarka-Text, in der sich die »Vernunft
Gedächtnisbilder« lustig macht.
So steht denn der Magister unserer Illustration in einem solchen imaginativen Hause von Gedächtnisbildern, das
freilich nicht im herkömmlichen Wortverstand architektonisch angelegt erscheint, sondern inmitten einer einsam abge-
legenen Landschaft schwebt. Auch diese Eigentümlichkeit der Darstellung läßt sich aus der mnemonischen Literatur
belegen, indem die »Libri ad Herennium« — eines der wichtigsten antiken Quellenwerke der Mnemonik 2 — ausdrücklich
empfehlen: »Es ist weit bequemer, in einer einsamen, als in einer volkreichen Gegend, die ,Örter' anzulegen, weil das
Gedränge der wandernden Menschen die Zeichen der Bilder verwirrt und schwächt, die Einsamkeit dagegen die Gestalten
i Daß Weiditz dieses humanistische Motiv auf Grund des eigenen Bildungswissens ausgestaltet habe, ist ganz ausgeschlossen. Auch hier hat
ihn ein Mentor maßgebend beraten. Daß es Sebastian Brant auch diesmal war, dürfen wir aus dem guten Grund vermuten, daß Sebastian Brant einen
der sonderbarsten mnemonischen Traktate seiner Zeit mit einem Lobgedichte eingeleitet hat, wodurch er sich mit dem Gebiete der .Mnemonik wohl
vertraut erweist. Es handelt sich um das »Rationarium Evangelistarum omnia in se evangelia prosa versu imaginibusque quam mirifice com-
plectens Hexastichon Sebastiani Brant in memorabiles evangelistarum figuras MDVII« (Göd. 24).
- Zitiert nach Aretin, a. a. O. S. 68.
— 34 —
quae brevibus ad consummatum spectant oratorem, ex antiquo rhetorum gymnasio, dicendi scribendique breves rationes,
nec non et aptus optimo cuique viro titulus, insuper et perquam facilis memoriae artis modus, Jacobi Publicii lucu-
bratione in lucem editus. — Von den vier Ausgaben des Werkes wurden die beiden ersten in den Jahren 1482 und
1486 von Erhard Ratdolt zu Venedig hergestellt, während die beiden andern 1490 und 1496 in Ratdolts Augsburger
Verlag erschienen sind.
Diese Mnemonik des Publicius besitzt als Anhang einen Bilderteil, in welchem sogenannte »Ordnungsbilder« —
figürliche Stützpunkte des Gedächtnisses — enthalten sind. Dort finden wir die Buchstaben des Alphabets nach einem
sehr verschrobenen, hier nicht
zu explizierenden System zu
mannigfachen Körperformen
ausgedeutet, so daß ein halb-
offener Zirkel etwa daß große
A bezeichnen soll, ein Horn
das C, ein halber Krebs das E,
ein Knotenstock das F, ein
Dudelsack das G verbildlicht.
In ihrer künstlerischen
Ausgestaltung sind diese Ord-
nungsbilder des Publicius in
runde Scheiben eingezeichnet,
deren Felder sie in ornamentaler
Symmetrie besetzen. Gleichen
sie schon in dieser zirkelhaften
Form auf das genaueste den
Bilderscheiben des Petrarka-
Meisters, so wird die Überein-
stimmung dadurch noch mehr
befestigt, daß eine ganze Reihe
der Embleme des Petrarka-
Meisters in jenen Ordnungs-
bildern vorgezeichnet ist. So die
Motive: Krone — Zange —
Richtscheit — Hammer —
Laute (Abb. 9). Vor allem sind
auchseineTierfiguren schon
in der Beispielsammlung des
Publicius enthalten, wo man als
letzte Illustration einen nach
Bilderbogenart in 5 X 5 oblonge
Felder eingeteilten Holzschnitt
Abb. 9. Mnemonische Figuren aus dem Publicius.
Nach den Holzschnitten.
Emblemata vereinigt sind. Und
unter ihnen das gebäumte
Roß, der Schwan, der Bär,
welche Hans Weiditz ganz im
Vordergrund seiner mnemoni-
schen Illustration verwertete
(Abb. 10). Bei dieser weit-
gehenden Übereinstimmung
darf man wohl sicher glauben,
daß Hans Weiditz in dem
Werke des Publicius die Quelle
und die Anregung für seinen
Holzschnitt fand, i
Nach dieser grundsätz-
lichen Aufklärung des Bild-
gedankens bleibt noch die Ein-
zelausgestaltung des Motivs zu
erläutern, die wiederum in den
besonderen Vorstellungen der
Mnemonik ihre Wurzeln hat:
Durch diese Wissenschaft, die
kraft umfassender Verbildlichung
des insgesamten Wissensstoffes
unser Erinnerungsvermögen
stützen will, wird das Gedächtnis
räumlich aufgeteilt und in ein
vielspaltiges Registriersystem
zerlegt. Diese Gedächtnisräume
werden in der Terminologie
der alten Mnemotechnik als
»Häuser« und als »Stuben«
vorgestellt, an deren Wänden
man sich die Ordnungsbilder
angeheftet denkt. Von hier aus
über den »Saal verräucherter
findet, auf welchem 25 Tier-
erst verstehen wir die Anspielung in dem Petrarka-Text, in der sich die »Vernunft
Gedächtnisbilder« lustig macht.
So steht denn der Magister unserer Illustration in einem solchen imaginativen Hause von Gedächtnisbildern, das
freilich nicht im herkömmlichen Wortverstand architektonisch angelegt erscheint, sondern inmitten einer einsam abge-
legenen Landschaft schwebt. Auch diese Eigentümlichkeit der Darstellung läßt sich aus der mnemonischen Literatur
belegen, indem die »Libri ad Herennium« — eines der wichtigsten antiken Quellenwerke der Mnemonik 2 — ausdrücklich
empfehlen: »Es ist weit bequemer, in einer einsamen, als in einer volkreichen Gegend, die ,Örter' anzulegen, weil das
Gedränge der wandernden Menschen die Zeichen der Bilder verwirrt und schwächt, die Einsamkeit dagegen die Gestalten
i Daß Weiditz dieses humanistische Motiv auf Grund des eigenen Bildungswissens ausgestaltet habe, ist ganz ausgeschlossen. Auch hier hat
ihn ein Mentor maßgebend beraten. Daß es Sebastian Brant auch diesmal war, dürfen wir aus dem guten Grund vermuten, daß Sebastian Brant einen
der sonderbarsten mnemonischen Traktate seiner Zeit mit einem Lobgedichte eingeleitet hat, wodurch er sich mit dem Gebiete der .Mnemonik wohl
vertraut erweist. Es handelt sich um das »Rationarium Evangelistarum omnia in se evangelia prosa versu imaginibusque quam mirifice com-
plectens Hexastichon Sebastiani Brant in memorabiles evangelistarum figuras MDVII« (Göd. 24).
- Zitiert nach Aretin, a. a. O. S. 68.
— 34 —