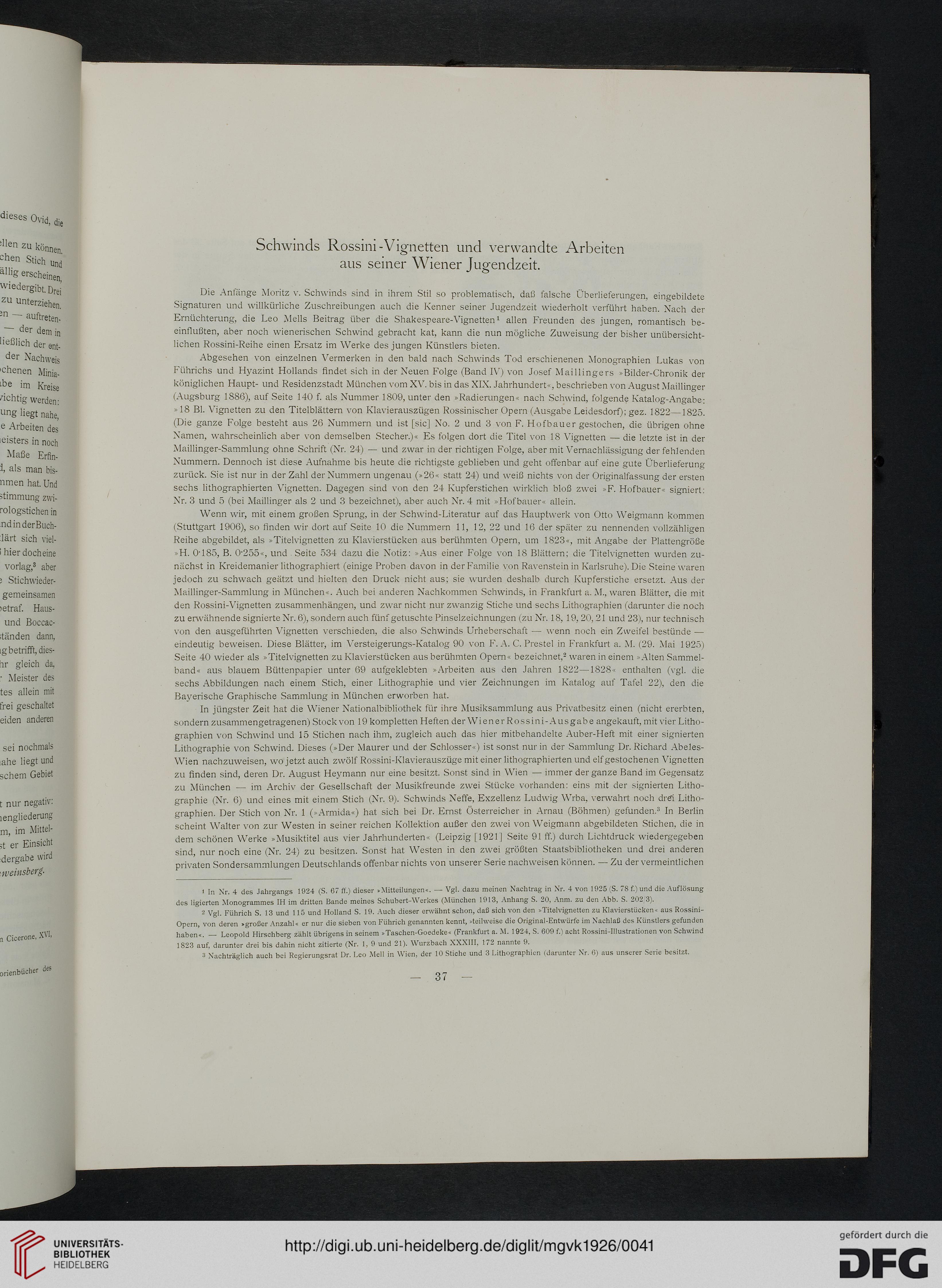Schwinds Rossini-Vignetten und verwandte Arbeiten
aus seiner Wiener Jugendzeit.
Die Anfänge Moritz v. Schwinds sind in ihrem Stil so problematisch, daß falsche Überlieferungen, eingebildete
Signaturen und willkürliche Zuschreibungen auch die Kenner seiner Jugendzeit wiederholt verführt haben. Nach der
Ernüchterung, die Leo Mells Beitrag über die Shakespeare-Vignetten1 allen Freunden des jungen, romantisch be-
einflußten, aber noch wienerischen Schwind gebracht kat, kann die nun mögliche Zuweisung der bisher unübersicht-
lichen Rossini-Reihe einen Ersatz im Werke des jungen Künstlers bieten.
Abgesehen von einzelnen Vermerken in den bald nach Schwinds Tod erschienenen Monographien Lukas von
Führichs und Hyazint Hollands findet sich in der Neuen Folge (Band IV) von Josef Maillingers »Bilder-Chronik der
königlichen Haupt- und Residenzstadt München vom XV. bis in das XIX. Jahrhundert«, beschrieben von August Maillinger
(Augsburg 1886), auf Seite 140 f. als Nummer 1809, unter den »Radierungen« nach Schwind, folgende Katalog-Angabe:
»18 Bl. Vignetten zu den Titelblättern von Klavierauszügen Rossinischer Opern (Ausgabe Leidesdorf); gez. 1822—1825.
(Die ganze Folge besteht aus 26 Nummern und ist [sie] No. 2 und 3 von F. Hofbauer gestochen, die übrigen ohne
Namen, wahrscheinlich aber von demselben Stecher.)« Es folgen dort die Titel von 18 Vignetten — die letzte ist in der
Maillinger-Sammlung ohne Schrift (Nr. 24) — und zwar in der richtigen Folge, aber mit Vernachlässigung der fehlenden
Nummern. Dennoch ist diese Aufnahme bis heute die richtigste geblieben und geht offenbar auf eine gute Überlieferung
zurück. Sie ist nur in der Zahl der Nummern ungenau (»26« statt 24) und weiß nichts von der Originalfassung der ersten
sechs lithographierten Vignetten. Dagegen sind von den 24 Kupferstichen wirklich bloß zwei »F. Hofbauer« signiert:
Nr. 3 und 5 (bei Maillinger als 2 und 3 bezeichnet), aber auch Nr. 4 mit »Hofbauer« allein.
Wenn wir, mit einem großen Sprung, in der Schwind-Literatur auf das Hauptwerk von Otto Weigmann kommen
(Stuttgart 1906), so finden wir dort auf Seite 10 die Nummern 11, 12, 22 und 16 der später zu nennenden vollzähligen
Reihe abgebildet, als »Titelvignetten zu Klavierstücken aus berühmten Opern, um 1823«, mit Angabe der Plattengröße
»H. 0485, B. 0'255«, und . Seite 534 dazu die Notiz: »Aus einer Folge von 18 Blättern; die Titelvignetten wurden zu-
nächst in Kreidemanier lithographiert (einige Proben davon in der Familie von Ravenstein in Karlsruhe). Die Steine waren
jedoch zu schwach geätzt und hielten den Druck nicht aus; sie wurden deshalb durch Kupferstiche ersetzt. Aus der
Maillinger-Sammlung in München«. Auch bei anderen Nachkommen Schwinds, in Frankfurt a. M., waren Blätter, die mit
den Rossini-Vignetten zusammenhängen, und zwar nicht nur zwanzig Stiche und sechs Lithographien (darunter die noch
zu erwähnende signierte Nr. 6), sondern auch fünf getuschte Pinselzeichnungen (zu Nr. 18, 19, 20,21 und 23), nur technisch
von den ausgeführten Vignetten verschieden, die also Schwinds Urheberschaft — wenn noch ein Zweifel bestünde —
eindeutig beweisen. Diese Blätter, im Versteigerungs-Katalog 90 von F. A. C. Prestel in Frankfurt a. M. (29. Mai 1925)
Seite 40 wieder als » Titel Vignetten zu Klavierstücken aus berühmten Opern« bezeichnet,2 waren in einem »Alten Sammel-
band« aus blauem Büttenpapier unter 69 aufgeklebten »Arbeiten aus den Jahren 1822—1828« enthalten (vgl. die
sechs Abbildungen nach einem Stich, einer Lithographie und vier Zeichnungen im Katalog auf Tafel 22), den die
Bayerische Graphische Sammlung in München erworben hat.
In jüngster Zeit hat die Wiener Nationalbibliothek für ihre Musiksammlung aus Privatbesitz einen (nicht ererbten,
sondern zusammengetragenen) Stock von 19 kompletten Heften der Wien er Ross ini-Aus gäbe angekauft, mit vier Litho-
graphien von Schwind und 15 Stichen nach ihm, zugleich auch das hier mitbehandelte Auber-Heft mit einer signierten
Lithographie von Schwind. Dieses (»Der Maurer und der Schlosser«) ist sonst nur in der Sammlung Dr. Richard Abeles-
Wien nachzuweisen, wo jetzt auch zwölf Rossini-Klavierauszüge mit einer lithographierten und elf gestochenen Vignetten
zu finden sind, deren Dr. August Heymann nur eine besitzt. Sonst sind in Wien — immer der ganze Band im Gegensatz
zu München — im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde zwei Stücke vorhanden: eins mit der signierten Litho-
graphie (Nr. 6) und eines mit einem Stich (Nr. 9). Schwinds Neffe, Exzellenz Ludwig Wrba, verwahrt noch drei Litho-
graphien. Der Stich von Nr. 1 (»Armida«) hat sich bei Dr. Ernst Österreicher in Arnau (Böhmen) gefunden.3 In Berlin
scheint Walter von zur Westen in seiner reichen Kollektion außer den zwei von Weigmann abgebildeten Stichen, die in
dem schönen Werke »Musiktitel aus vier Jahrhunderten« (Leipzig [1921] Seite 91 ff.) durch Lichtdruck wiedergegeben
sind, nur noch eine (Nr. 24) zu besitzen. Sonst hat Westen in den zwei größten Staatsbibliotheken und drei anderen
privaten Sondersammlungen Deutschlands offenbar nichts von unserer Serie nachweisen können. — Zu der vermeintlichen
1 In Nr. 4 des Jahrgangs 1024 (S. 67 ff.) dieser »Mitteilungen«. — Vgl. dazu meinen Nachtrag in Nr. 4 von 1925 (S. 78 f.) und die Auflösung
des ligierten Monogrammes IH im dritten Bande meines Schubert-Werkes (München 1913, Anhang S. 20, Anm. zu den Abb. S. 202 3).
2 Vgl. Führich S. 13 und 115 und Holland S. 19. Auch dieser erwähnt schon, daß sich von den »Titelvignetten zu Klavierstücken« aus Rossini-
Opern, von deren »großer Anzahl« er nur die sieben von Führich genannten kennt, »teilweise die Original-Entwürfe im Nachlaß des Künstlers gefunden
haben'«. — Leopold Hirschberg zählt übrigens in seinem »Taschen-Goedeke« (Frankfurt a. M. 1924, S. 609 f.) acht Rossini-Illustrationen von Schwind
1823 auf, darunter drei bis dahin nicht zitierte (Nr. 1, 9 und 21). Wurzbach XXXIII, 172 nannte 9.
3 Nachträglich auch bei Regierungsrat Dr. Leo Meli in Wien, der 10 Stiche und 3 Lithographien (darunter Nr. 6) aus unserer Serie besitzt.
aus seiner Wiener Jugendzeit.
Die Anfänge Moritz v. Schwinds sind in ihrem Stil so problematisch, daß falsche Überlieferungen, eingebildete
Signaturen und willkürliche Zuschreibungen auch die Kenner seiner Jugendzeit wiederholt verführt haben. Nach der
Ernüchterung, die Leo Mells Beitrag über die Shakespeare-Vignetten1 allen Freunden des jungen, romantisch be-
einflußten, aber noch wienerischen Schwind gebracht kat, kann die nun mögliche Zuweisung der bisher unübersicht-
lichen Rossini-Reihe einen Ersatz im Werke des jungen Künstlers bieten.
Abgesehen von einzelnen Vermerken in den bald nach Schwinds Tod erschienenen Monographien Lukas von
Führichs und Hyazint Hollands findet sich in der Neuen Folge (Band IV) von Josef Maillingers »Bilder-Chronik der
königlichen Haupt- und Residenzstadt München vom XV. bis in das XIX. Jahrhundert«, beschrieben von August Maillinger
(Augsburg 1886), auf Seite 140 f. als Nummer 1809, unter den »Radierungen« nach Schwind, folgende Katalog-Angabe:
»18 Bl. Vignetten zu den Titelblättern von Klavierauszügen Rossinischer Opern (Ausgabe Leidesdorf); gez. 1822—1825.
(Die ganze Folge besteht aus 26 Nummern und ist [sie] No. 2 und 3 von F. Hofbauer gestochen, die übrigen ohne
Namen, wahrscheinlich aber von demselben Stecher.)« Es folgen dort die Titel von 18 Vignetten — die letzte ist in der
Maillinger-Sammlung ohne Schrift (Nr. 24) — und zwar in der richtigen Folge, aber mit Vernachlässigung der fehlenden
Nummern. Dennoch ist diese Aufnahme bis heute die richtigste geblieben und geht offenbar auf eine gute Überlieferung
zurück. Sie ist nur in der Zahl der Nummern ungenau (»26« statt 24) und weiß nichts von der Originalfassung der ersten
sechs lithographierten Vignetten. Dagegen sind von den 24 Kupferstichen wirklich bloß zwei »F. Hofbauer« signiert:
Nr. 3 und 5 (bei Maillinger als 2 und 3 bezeichnet), aber auch Nr. 4 mit »Hofbauer« allein.
Wenn wir, mit einem großen Sprung, in der Schwind-Literatur auf das Hauptwerk von Otto Weigmann kommen
(Stuttgart 1906), so finden wir dort auf Seite 10 die Nummern 11, 12, 22 und 16 der später zu nennenden vollzähligen
Reihe abgebildet, als »Titelvignetten zu Klavierstücken aus berühmten Opern, um 1823«, mit Angabe der Plattengröße
»H. 0485, B. 0'255«, und . Seite 534 dazu die Notiz: »Aus einer Folge von 18 Blättern; die Titelvignetten wurden zu-
nächst in Kreidemanier lithographiert (einige Proben davon in der Familie von Ravenstein in Karlsruhe). Die Steine waren
jedoch zu schwach geätzt und hielten den Druck nicht aus; sie wurden deshalb durch Kupferstiche ersetzt. Aus der
Maillinger-Sammlung in München«. Auch bei anderen Nachkommen Schwinds, in Frankfurt a. M., waren Blätter, die mit
den Rossini-Vignetten zusammenhängen, und zwar nicht nur zwanzig Stiche und sechs Lithographien (darunter die noch
zu erwähnende signierte Nr. 6), sondern auch fünf getuschte Pinselzeichnungen (zu Nr. 18, 19, 20,21 und 23), nur technisch
von den ausgeführten Vignetten verschieden, die also Schwinds Urheberschaft — wenn noch ein Zweifel bestünde —
eindeutig beweisen. Diese Blätter, im Versteigerungs-Katalog 90 von F. A. C. Prestel in Frankfurt a. M. (29. Mai 1925)
Seite 40 wieder als » Titel Vignetten zu Klavierstücken aus berühmten Opern« bezeichnet,2 waren in einem »Alten Sammel-
band« aus blauem Büttenpapier unter 69 aufgeklebten »Arbeiten aus den Jahren 1822—1828« enthalten (vgl. die
sechs Abbildungen nach einem Stich, einer Lithographie und vier Zeichnungen im Katalog auf Tafel 22), den die
Bayerische Graphische Sammlung in München erworben hat.
In jüngster Zeit hat die Wiener Nationalbibliothek für ihre Musiksammlung aus Privatbesitz einen (nicht ererbten,
sondern zusammengetragenen) Stock von 19 kompletten Heften der Wien er Ross ini-Aus gäbe angekauft, mit vier Litho-
graphien von Schwind und 15 Stichen nach ihm, zugleich auch das hier mitbehandelte Auber-Heft mit einer signierten
Lithographie von Schwind. Dieses (»Der Maurer und der Schlosser«) ist sonst nur in der Sammlung Dr. Richard Abeles-
Wien nachzuweisen, wo jetzt auch zwölf Rossini-Klavierauszüge mit einer lithographierten und elf gestochenen Vignetten
zu finden sind, deren Dr. August Heymann nur eine besitzt. Sonst sind in Wien — immer der ganze Band im Gegensatz
zu München — im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde zwei Stücke vorhanden: eins mit der signierten Litho-
graphie (Nr. 6) und eines mit einem Stich (Nr. 9). Schwinds Neffe, Exzellenz Ludwig Wrba, verwahrt noch drei Litho-
graphien. Der Stich von Nr. 1 (»Armida«) hat sich bei Dr. Ernst Österreicher in Arnau (Böhmen) gefunden.3 In Berlin
scheint Walter von zur Westen in seiner reichen Kollektion außer den zwei von Weigmann abgebildeten Stichen, die in
dem schönen Werke »Musiktitel aus vier Jahrhunderten« (Leipzig [1921] Seite 91 ff.) durch Lichtdruck wiedergegeben
sind, nur noch eine (Nr. 24) zu besitzen. Sonst hat Westen in den zwei größten Staatsbibliotheken und drei anderen
privaten Sondersammlungen Deutschlands offenbar nichts von unserer Serie nachweisen können. — Zu der vermeintlichen
1 In Nr. 4 des Jahrgangs 1024 (S. 67 ff.) dieser »Mitteilungen«. — Vgl. dazu meinen Nachtrag in Nr. 4 von 1925 (S. 78 f.) und die Auflösung
des ligierten Monogrammes IH im dritten Bande meines Schubert-Werkes (München 1913, Anhang S. 20, Anm. zu den Abb. S. 202 3).
2 Vgl. Führich S. 13 und 115 und Holland S. 19. Auch dieser erwähnt schon, daß sich von den »Titelvignetten zu Klavierstücken« aus Rossini-
Opern, von deren »großer Anzahl« er nur die sieben von Führich genannten kennt, »teilweise die Original-Entwürfe im Nachlaß des Künstlers gefunden
haben'«. — Leopold Hirschberg zählt übrigens in seinem »Taschen-Goedeke« (Frankfurt a. M. 1924, S. 609 f.) acht Rossini-Illustrationen von Schwind
1823 auf, darunter drei bis dahin nicht zitierte (Nr. 1, 9 und 21). Wurzbach XXXIII, 172 nannte 9.
3 Nachträglich auch bei Regierungsrat Dr. Leo Meli in Wien, der 10 Stiche und 3 Lithographien (darunter Nr. 6) aus unserer Serie besitzt.