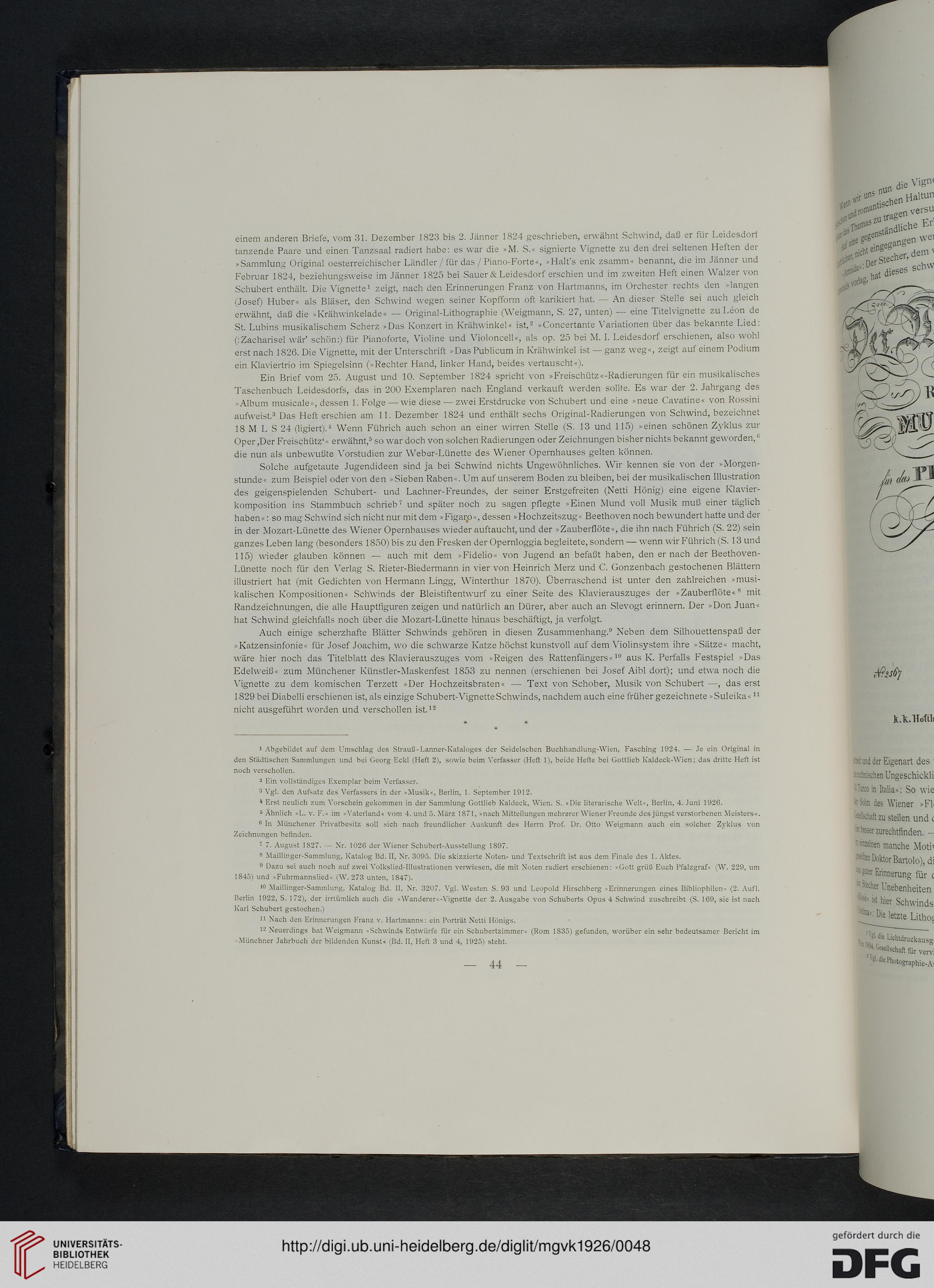einem anderen Briefe, vom 31. Dezember 1823 bis 2. Jänner 1824 geschrieben, erwähnt Schwind, daß er für Leidesdorf
tanzende Paare und einen Tanzsaal radiert habe: es war die »M. S.« signierte Vignette zu den drei seltenen Heften der
»Sammlung Original oesterreichischer Ländler / für das / Piano-Forte«, »Halt's enk zsamm« benannt, die im Jänner und
Februar 1824, beziehungsweise im Jänner 1825 bei Sauer 6t Leidesdorf erschien und im zweiten Heft einen Walzer von
Schubert enthält. Die Vignette1 zeigt, nach den Erinnerungen Franz von Hartmanns, im Orchester rechts den »langen
(Josef) Huber« als Bläser, den Schwind wegen seiner Kopfform oft karikiert hat. — An dieser Stelle sei auch gleich
erwähnt, daß die »Krähwinkelade« — Original-Lithographie (Weigmann, S. 27, unten) — eine Titelvignette zu Leon de
St. Lubins musikalischem Scherz »Das Konzeit in Krähwinke!« ist,'2 »Concertante Variationen über das bekannte Lied:
(:Zacharisel war' schön:) für Pianoforte, Violine und Violoncell«, als op. 25 bei M. I. Leidesdorf erschienen, also wohl
erst nach 1826. Die Vignette, mit der Unterschrift »Das Publicum in Krahwinkel ist — ganz weg«, zeigt auf einem Podium
ein Klaviertrio im Spiegelsinn (»Rechter Hand, linker Hand, beides vertauscht«).
Ein Brief vom 25. August und 10. September 1824 spricht von »Freischütz«-Radierungen für ein musikalisches
Taschenbuch Leidesdorfs, das in 200 Exemplaren nach England verkauft werden sollte. Es war der 2. Jahrgang des
»Album musicale«, dessen 1. Folge — wie diese — zwei Erstdrucke von Schubert und eine »neue Cavatine« von Rossini
aufweist.3 Das Heft erschien am 11. Dezember 1824 und enthält sechs Original-Radierungen von Schwind, bezeichnet
18 M L S 24 (ligiert).' Wenn Führich auch schon an einer wirren Stelle (S. 13 und 115) »einen schönen Zyklus zur
Oper,Der Freischütz'« erwähnt,5 so war doch von solchen Radierungen oder Zeichnungen bisher nichts bekannt geworden,i;
die nun als unbewußte Vorstudien zur Weber-Lünette des Wiener Opernhauses gelten können.
Solche aufgetaute Jugendideen sind ja bei Schwind nichts Ungewöhnliches. Wir kennen sie von der »Morgen-
stunde« zum Beispiel oder von den »Sieben Raben«. Um auf unserem Boden zu bleiben, bei der musikalischen Illustration
des geigenspielenden Schubert- und Lachner-Freundes, der seiner Erstgefreiten (Netti Honig) eine eigene Klavier-
komposition ins Stammbuch schrieb7 und später noch zu sagen pflegte »Einen Mund voll Musik muß einer täglich
haben«: so mag Schwind sich nicht nur mit dem »Figarp«, dessen »Hochzeitszug« Beethoven noch bewundert hatte und der
in der Mozart-Lünette des Wiener Opernhauses wieder auftaucht, und der »Zauberflöte«, die ihn nach Führich (S. 22) sein
ganzes Leben lang (besonders 1850) bis zu den Fresken der Opernloggia begleitete, sondern — wenn wir Führich (S. 13 und
115) wieder glauben können — auch mit dem »Fidelio« von Jugend an befaßt haben, den er nach der Beethoven-
Lünette noch für den Verlag S. Rieter-Biedermann in vier von Heinrich Merz und C. Gonzenbach gestochenen Blättern
illustriert hat (mit Gedichten von Hermann Lingg, Winterthur 1870). Überraschend ist unter den zahlreichen »musi-
kalischen Kompositionen« Schwinds der Bleistiftentwurf zu einer Seite des Klavierauszuges der »Zauberflöte«3 mit
Randzeichnungen, die alle Hauptfiguren zeigen und natürlich an Dürer, aber auch an Slevogt erinnern. Der »Don Juan«
hat Schwind gleichfalls noch über die Mozart-Lünette hinaus beschäftigt, ja verfolgt.
Auch einige scherzhafte Blätter Schwinds gehören in diesen Zusammenhang.9 Neben dem Silhouettenspaß der
> Katzensinfonie« für Josef Joachim, wo die schwarze Katze höchst kunstvoll auf dem Violinsystem ihre »Sätze« macht,
wäre hier noch das Titelblatt des Klavierauszuges vom »Reigen des Rattenfängers« 10 aus K. Perfalls Festspiel »Das
Edelweiß« zum Münchener Künstler-Maskenfest 1853 zu nennen (erschienen bei Josef Aibl dort); und etwa noch die
Vignette zu dem komischen Terzett »Der Hochzeitsbraten« — Text von Schober, Musik von Schubert —, das erst
1829 bei Diabelti erschienen ist, als einzige Schubert-Vignette Schwinds, nachdem auch eine früher gezeichnete »Suleika«11
nicht ausgeführt worden und verschollen ist.12
1 Abgebildet auf dem Umschlag des Strauß-Lanner-Kataloges der Seideischen Buchhandlung-Wien, Fasching 1924. — Je ein Original in
den Städtischen Sammlungen und bei Georg Eckl (Heft 2), sowie beim Verfasser (Heft 1), beide Hefte bei Gottlieb Kaldeck-Wien; das dritte Heft ist
noch verschollen.
2 Ein vollständiges Exemplar beim Verfasser.
3 Vgl. den Aufsatz des Verfassers in der »Musik«, Berlin, 1. September 1912.
4 Erst neulich zum Vorschein gekommen in der Sammlung Gottlieb Kaideck, Wien. S. »Die literarische Welt«, Berlin, 4. Juni 1926.
s Ähnlich »L. v. F.« im »Vaterland« vom 4. und 5. März 1871, »nach Mitteilungen mehrerer Wiener Freunde desjüngst verstorbenen Meisters«.
6 In Münehener Privatbesitz soll sich nach freundlicher Auskunft des Herrn Prof. Dr. Otto Weigmann auch ein solcher Zyklus von
Zeichnungen befinden.
; 7. August 1827. — Nr. 1026 der Wiener Schubert-Ausstellung 1897.
8 Maillingcr-Sammlung, Katalog Bd. II, Nr. 3095. Die skizzierte Koten- und Textschrift ist aus dem Finale des 1. Aktes.
9 Dazu sei auch noch auf zwei Volkslied-Illustrationen verwiesen, die mit Noten radiert erschienen: .Gott griitS Euch Pfalzgraf« (W. 229, um
1845) und »Fuhrmannslied« (W. 273 unten, 1847).
in Maillinger-Sammhmg, Katalog Bd. II, Nr. 3207. Vgl. Westen S. 93 und Leopold Hirschberg »Erinnerungen eines Bibliophilen« (2. Aufl.
Berlin 1922, S. 172), der irrtümlich auch die »Wanderer-Vignette der 2. Ausgabe von Schuberts Opus 4 Schwind zuschreibt (S. 169, sie ist nach
Karl Schubert gestochen.)
11 Nach den Erinnerungen Franz v. Hartmanns: ein Porträt Netti Honigs.
-- Neuerdings hat Weigmann »Schwinds Entwürfe für ein Schubertzimmer« (Rom 1835) gefunden, worüber ein sehr bedeutsamer Bericht im
Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst« (Bd. II, Heft 3 und 4, 1925) steht.
tanzende Paare und einen Tanzsaal radiert habe: es war die »M. S.« signierte Vignette zu den drei seltenen Heften der
»Sammlung Original oesterreichischer Ländler / für das / Piano-Forte«, »Halt's enk zsamm« benannt, die im Jänner und
Februar 1824, beziehungsweise im Jänner 1825 bei Sauer 6t Leidesdorf erschien und im zweiten Heft einen Walzer von
Schubert enthält. Die Vignette1 zeigt, nach den Erinnerungen Franz von Hartmanns, im Orchester rechts den »langen
(Josef) Huber« als Bläser, den Schwind wegen seiner Kopfform oft karikiert hat. — An dieser Stelle sei auch gleich
erwähnt, daß die »Krähwinkelade« — Original-Lithographie (Weigmann, S. 27, unten) — eine Titelvignette zu Leon de
St. Lubins musikalischem Scherz »Das Konzeit in Krähwinke!« ist,'2 »Concertante Variationen über das bekannte Lied:
(:Zacharisel war' schön:) für Pianoforte, Violine und Violoncell«, als op. 25 bei M. I. Leidesdorf erschienen, also wohl
erst nach 1826. Die Vignette, mit der Unterschrift »Das Publicum in Krahwinkel ist — ganz weg«, zeigt auf einem Podium
ein Klaviertrio im Spiegelsinn (»Rechter Hand, linker Hand, beides vertauscht«).
Ein Brief vom 25. August und 10. September 1824 spricht von »Freischütz«-Radierungen für ein musikalisches
Taschenbuch Leidesdorfs, das in 200 Exemplaren nach England verkauft werden sollte. Es war der 2. Jahrgang des
»Album musicale«, dessen 1. Folge — wie diese — zwei Erstdrucke von Schubert und eine »neue Cavatine« von Rossini
aufweist.3 Das Heft erschien am 11. Dezember 1824 und enthält sechs Original-Radierungen von Schwind, bezeichnet
18 M L S 24 (ligiert).' Wenn Führich auch schon an einer wirren Stelle (S. 13 und 115) »einen schönen Zyklus zur
Oper,Der Freischütz'« erwähnt,5 so war doch von solchen Radierungen oder Zeichnungen bisher nichts bekannt geworden,i;
die nun als unbewußte Vorstudien zur Weber-Lünette des Wiener Opernhauses gelten können.
Solche aufgetaute Jugendideen sind ja bei Schwind nichts Ungewöhnliches. Wir kennen sie von der »Morgen-
stunde« zum Beispiel oder von den »Sieben Raben«. Um auf unserem Boden zu bleiben, bei der musikalischen Illustration
des geigenspielenden Schubert- und Lachner-Freundes, der seiner Erstgefreiten (Netti Honig) eine eigene Klavier-
komposition ins Stammbuch schrieb7 und später noch zu sagen pflegte »Einen Mund voll Musik muß einer täglich
haben«: so mag Schwind sich nicht nur mit dem »Figarp«, dessen »Hochzeitszug« Beethoven noch bewundert hatte und der
in der Mozart-Lünette des Wiener Opernhauses wieder auftaucht, und der »Zauberflöte«, die ihn nach Führich (S. 22) sein
ganzes Leben lang (besonders 1850) bis zu den Fresken der Opernloggia begleitete, sondern — wenn wir Führich (S. 13 und
115) wieder glauben können — auch mit dem »Fidelio« von Jugend an befaßt haben, den er nach der Beethoven-
Lünette noch für den Verlag S. Rieter-Biedermann in vier von Heinrich Merz und C. Gonzenbach gestochenen Blättern
illustriert hat (mit Gedichten von Hermann Lingg, Winterthur 1870). Überraschend ist unter den zahlreichen »musi-
kalischen Kompositionen« Schwinds der Bleistiftentwurf zu einer Seite des Klavierauszuges der »Zauberflöte«3 mit
Randzeichnungen, die alle Hauptfiguren zeigen und natürlich an Dürer, aber auch an Slevogt erinnern. Der »Don Juan«
hat Schwind gleichfalls noch über die Mozart-Lünette hinaus beschäftigt, ja verfolgt.
Auch einige scherzhafte Blätter Schwinds gehören in diesen Zusammenhang.9 Neben dem Silhouettenspaß der
> Katzensinfonie« für Josef Joachim, wo die schwarze Katze höchst kunstvoll auf dem Violinsystem ihre »Sätze« macht,
wäre hier noch das Titelblatt des Klavierauszuges vom »Reigen des Rattenfängers« 10 aus K. Perfalls Festspiel »Das
Edelweiß« zum Münchener Künstler-Maskenfest 1853 zu nennen (erschienen bei Josef Aibl dort); und etwa noch die
Vignette zu dem komischen Terzett »Der Hochzeitsbraten« — Text von Schober, Musik von Schubert —, das erst
1829 bei Diabelti erschienen ist, als einzige Schubert-Vignette Schwinds, nachdem auch eine früher gezeichnete »Suleika«11
nicht ausgeführt worden und verschollen ist.12
1 Abgebildet auf dem Umschlag des Strauß-Lanner-Kataloges der Seideischen Buchhandlung-Wien, Fasching 1924. — Je ein Original in
den Städtischen Sammlungen und bei Georg Eckl (Heft 2), sowie beim Verfasser (Heft 1), beide Hefte bei Gottlieb Kaldeck-Wien; das dritte Heft ist
noch verschollen.
2 Ein vollständiges Exemplar beim Verfasser.
3 Vgl. den Aufsatz des Verfassers in der »Musik«, Berlin, 1. September 1912.
4 Erst neulich zum Vorschein gekommen in der Sammlung Gottlieb Kaideck, Wien. S. »Die literarische Welt«, Berlin, 4. Juni 1926.
s Ähnlich »L. v. F.« im »Vaterland« vom 4. und 5. März 1871, »nach Mitteilungen mehrerer Wiener Freunde desjüngst verstorbenen Meisters«.
6 In Münehener Privatbesitz soll sich nach freundlicher Auskunft des Herrn Prof. Dr. Otto Weigmann auch ein solcher Zyklus von
Zeichnungen befinden.
; 7. August 1827. — Nr. 1026 der Wiener Schubert-Ausstellung 1897.
8 Maillingcr-Sammlung, Katalog Bd. II, Nr. 3095. Die skizzierte Koten- und Textschrift ist aus dem Finale des 1. Aktes.
9 Dazu sei auch noch auf zwei Volkslied-Illustrationen verwiesen, die mit Noten radiert erschienen: .Gott griitS Euch Pfalzgraf« (W. 229, um
1845) und »Fuhrmannslied« (W. 273 unten, 1847).
in Maillinger-Sammhmg, Katalog Bd. II, Nr. 3207. Vgl. Westen S. 93 und Leopold Hirschberg »Erinnerungen eines Bibliophilen« (2. Aufl.
Berlin 1922, S. 172), der irrtümlich auch die »Wanderer-Vignette der 2. Ausgabe von Schuberts Opus 4 Schwind zuschreibt (S. 169, sie ist nach
Karl Schubert gestochen.)
11 Nach den Erinnerungen Franz v. Hartmanns: ein Porträt Netti Honigs.
-- Neuerdings hat Weigmann »Schwinds Entwürfe für ein Schubertzimmer« (Rom 1835) gefunden, worüber ein sehr bedeutsamer Bericht im
Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst« (Bd. II, Heft 3 und 4, 1925) steht.