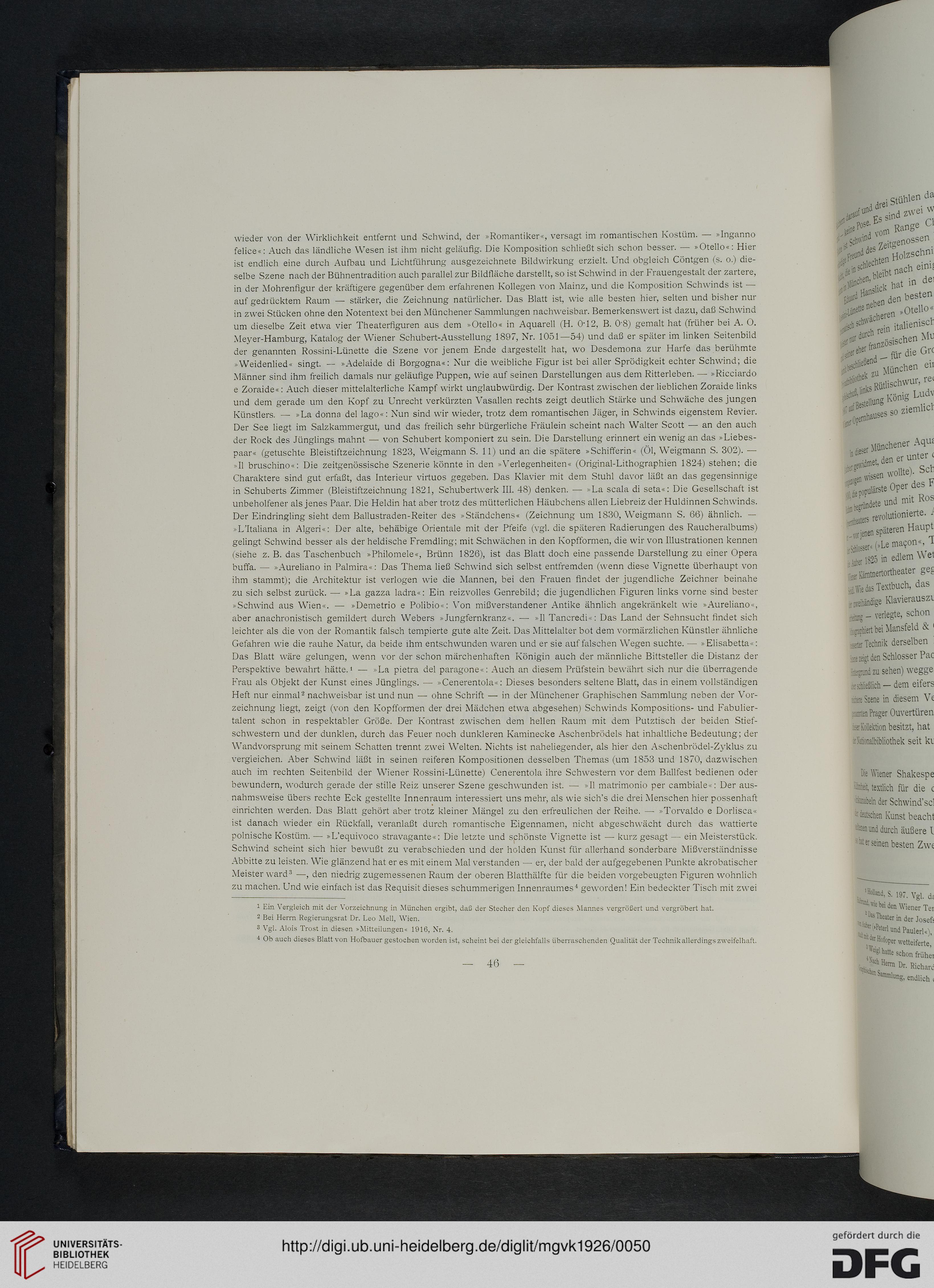wieder von der Wirklichkeit entfernt und Schwind, der »Romantiker«, versagt im romantischen Kostüm. — »Inganno
felice«: Auch das ländliche Wesen ist ihm nicht geläufig. Die Komposition schließt sich schon besser. — »Otello«: Hier
ist endlich eine durch Aufbau und Lichtführung ausgezeichnete Bildwirkung erzielt. Und obgleich Cöntgen (s. o.) die-
selbe Szene nach der Bühnentradition auch parallel zur Bildfläche darstellt, so ist Schwind in der Frauengestalt der zartere,
in der Mohrenfigur der kräftigere gegenüber dem erfahrenen Kollegen von Mainz, und die Komposition Schwinds ist —
auf gedrücktem Raum — stärker, die Zeichnung natürlicher. Das Blatt ist, wie alle besten hier, selten und bisher nur
in zwei Stücken ohne den Notentext bei den .Münchener Sammlungen nachweisbar. Bemerkenswert ist dazu, daß Schwind
um dieselbe Zeit etwa vier Theaterfiguren aus dem »Otello« in Aquarell (H. 0-12, B. 0-8) gemalt hat (früher bei A. O.
Meyer-Hamburg, Katalog der Wiener Schubert-Ausstellung 1897, Nr. 1051—54) und daß er später im linken Seitenbild
der genannten Rossini-Lünette die Szene vor jenem Ende dargestellt hat, wo Desdemona zur Harfe das berühmte
»Weidenlied« singt. — »Adelaide di Borgogna«: Nur die weibliche Figur ist bei aller Sprödigkeit echter Schwind; die
Männer sind ihm freilich damals nur geläufige Puppen, wie auf seinen Darstellungen aus dem Ritterleben. — »Ricciardo
e Zoraide«: Auch dieser mittelalterliche Kampf wirkt unglaubwürdig. Der Kontrast zwischen der lieblichen Zoraide links
und dem gerade um den Kopf zu Unrecht verkürzten Vasallen rechts zeigt deutlich Stärke und Schwäche des jungen
Künstlers. — »La donna del lago«: Nun sind wir wieder, trotz dem romantischen Jäger, in Schwinds eigenstem Revier.
Der See liegt im Salzkammergut, und das freilich sehr bürgerliche Fräulein scheint nach Walter Scott — an den auch
der Rock des Jünglings mahnt — von Schubert komponiert zu sein. Die Darstellung erinnert ein wenig an das »Liebes-
paar« (getuschte Bleistiftzeichnung 1823, Weigmann S. 11) und an die spätere »Schifferin« (Öl, Weigmann S. 302). —
»II bruschino«: Die zeitgenössische Szenerie könnte in den »Verlegenheiten« (Original-Lithographien 1824) stehen; die
Charaktere sind gut erfaßt, das Interieur virtuos gegeben. Das Klavier mit dem Stuhl davor läßt an das gegensinnige
in Schuberts Zimmer (Bleistiftzeichnung 1821, Schubertwerk III. 48) denken. — »La scala di seta«: Die Gesellschaft ist
unbeholfener als jenes Paar. Die Heldin hat aber trotz des mütterlichen Häubchens allen Liebreiz der Huldinnen Schwinds.
Der Eindringling sieht dem Ballustraden-Reiter des »Ständchens« (Zeichnung um 1830, Weigmann S. 66) ähnlich. —
»L'Italiana in Aigen«: Der alte, behäbige Orientale mit der Pfeife (vgl. die späteren Radierungen des Raucheralbums)
gelingt Schwind besser als der heldische Fremdling; mit Schwächen in den Kopfformen, die wir von Illustrationen kennen
(siehe z. B. das Taschenbuch »Philomele«, Brünn 1826), ist das Blatt doch eine passende Darstellung zu einer Opera
buffa. — »Aureliano in Palmira«: Das Thema ließ Schwind sich selbst entfremden (wenn diese Vignette überhaupt von
ihm stammt); die Architektur ist verlogen wie die Mannen, bei den Frauen findet der jugendliche Zeichner beinahe
zu sich selbst zurück. — »La gazza ladra«: Ein reizvolles Genrebild; die jugendlichen Figuren links vorne sind bester
»Schwind aus Wien«. — »Demetrio e Polibio«: Von mißverstandener Antike ähnlich angekränkelt wie »Aureliano«,
aber anachronistisch gemildert durch Webers »Jungfernkranz«. — »II Tancredi«: Das Land der Sehnsucht findet sich
leichter als die von der Romantik falsch tempierte gute alte Zeit. Das Mittelalter bot dem vormärzlichen Künstler ähnliche
Gefahren wie die rauhe Natur, da beide ihm entschwunden waren und er sie auf falschen Wegen suchte. — » Elisabetta«:
Das Blatt wäre gelungen, wenn vor der schon märchenhaften Königin auch der männliche Bittsteller die Distanz der
Perspektive bewahrt hätte.' — »La pietra del paragone«: Auch an diesem Prüfstein bewährt sich nur die überragende
Frau als Objekt der Kunst eines Jünglings. — »Cenerentola«: Dieses besonders seltene Blatt, das in einem vollständigen
Heft nur einmal2 nachweisbar ist und nun — ohne Schrift — in der Münchener Graphischen Sammlung neben der Vor-
zeichnung liegt, zeigt (von den Kopfformen der drei Mädchen etwa abgesehen) Schwinds Kompositions- und Fabulier-
talent schon in respektabler Größe. Der Kontrast zwischen dem hellen Raum mit dem Putztisch der beiden Stief-
schwestern und der dunklen, durch das Feuer noch dunkleren Kaminecke Aschenbrödels hat inhaltliche Bedeutung; der
Wandvorsprung mit seinem Schatten trennt zwei Welten. Nichts ist naheliegender, als hier den Aschenbrödel-Zyklus zu
vergleichen. Aber Schwind läßt in seinen reiferen Kompositionen desselben Themas (um 1853 und 1870, dazwischen
auch im rechten Seitenbild der Wiener Rossini-Lünette) Cenerentola ihre Schwestern vor dem Ballfest bedienen oder
bewundern, wodurch gerade der stille Reiz unserer Szene geschwunden ist. — »II matrimonio per cambiale«: Der aus-
nahmsweise übers rechte Eck gestellte Innenraum interessiert uns mehr, als wie sich's die drei Menschen hier possenhaft
einrichten werden. Das Blatt gehört aber trotz kleiner Mängel zu den erfreulichen der Reihe. — »Torvaldo e Dorlisca«
ist danach wieder ein Rückfall, veranlaßt durch romantische Eigennamen, nicht abgeschwächt durch das wattierte
polnische Kostüm. — »L'equivoco stravagante«: Die letzte und sphönste Vignette ist — kurz gesagt — ein Meisterstück.
Schwind scheint sich hier bewußt zu verabschieden und der holden Kunst für allerhand sonderbare Mißverständnisse
Abbitte zu leisten. Wie glänzend hat er es mit einem Mal verstanden — er, der bald der aufgegebenen Punkte akrobatischer
Meister w ard3 —, den niedrig zugemessenen Raum der oberen Blatthälfte für die beiden vorgebeugten Figuren wohnlich
zu machen. Und wie einfach ist das Requisit dieses schummerigen Innenraumes4 geworden! Ein bedeckter Tisch mit zwei
1 Ein Vergleich mit der Vorzeichnung in München ergibt, daß der Stecher den Kopf dieses Mannes vergrößert und vergröbert hat.
- Bei Herrn Regierungsrat Dr. Leo Meli, Wien.
3 Vgl. Alois Trost in diesen »Mitteilungen« 1916, Nr. 4.
* Ob auch dieses Blatt von Hofbauer gestochen worden ist, scheint bei der gleichfalls überraschenden Qualität der Technik allerdings zweifelhaft.
felice«: Auch das ländliche Wesen ist ihm nicht geläufig. Die Komposition schließt sich schon besser. — »Otello«: Hier
ist endlich eine durch Aufbau und Lichtführung ausgezeichnete Bildwirkung erzielt. Und obgleich Cöntgen (s. o.) die-
selbe Szene nach der Bühnentradition auch parallel zur Bildfläche darstellt, so ist Schwind in der Frauengestalt der zartere,
in der Mohrenfigur der kräftigere gegenüber dem erfahrenen Kollegen von Mainz, und die Komposition Schwinds ist —
auf gedrücktem Raum — stärker, die Zeichnung natürlicher. Das Blatt ist, wie alle besten hier, selten und bisher nur
in zwei Stücken ohne den Notentext bei den .Münchener Sammlungen nachweisbar. Bemerkenswert ist dazu, daß Schwind
um dieselbe Zeit etwa vier Theaterfiguren aus dem »Otello« in Aquarell (H. 0-12, B. 0-8) gemalt hat (früher bei A. O.
Meyer-Hamburg, Katalog der Wiener Schubert-Ausstellung 1897, Nr. 1051—54) und daß er später im linken Seitenbild
der genannten Rossini-Lünette die Szene vor jenem Ende dargestellt hat, wo Desdemona zur Harfe das berühmte
»Weidenlied« singt. — »Adelaide di Borgogna«: Nur die weibliche Figur ist bei aller Sprödigkeit echter Schwind; die
Männer sind ihm freilich damals nur geläufige Puppen, wie auf seinen Darstellungen aus dem Ritterleben. — »Ricciardo
e Zoraide«: Auch dieser mittelalterliche Kampf wirkt unglaubwürdig. Der Kontrast zwischen der lieblichen Zoraide links
und dem gerade um den Kopf zu Unrecht verkürzten Vasallen rechts zeigt deutlich Stärke und Schwäche des jungen
Künstlers. — »La donna del lago«: Nun sind wir wieder, trotz dem romantischen Jäger, in Schwinds eigenstem Revier.
Der See liegt im Salzkammergut, und das freilich sehr bürgerliche Fräulein scheint nach Walter Scott — an den auch
der Rock des Jünglings mahnt — von Schubert komponiert zu sein. Die Darstellung erinnert ein wenig an das »Liebes-
paar« (getuschte Bleistiftzeichnung 1823, Weigmann S. 11) und an die spätere »Schifferin« (Öl, Weigmann S. 302). —
»II bruschino«: Die zeitgenössische Szenerie könnte in den »Verlegenheiten« (Original-Lithographien 1824) stehen; die
Charaktere sind gut erfaßt, das Interieur virtuos gegeben. Das Klavier mit dem Stuhl davor läßt an das gegensinnige
in Schuberts Zimmer (Bleistiftzeichnung 1821, Schubertwerk III. 48) denken. — »La scala di seta«: Die Gesellschaft ist
unbeholfener als jenes Paar. Die Heldin hat aber trotz des mütterlichen Häubchens allen Liebreiz der Huldinnen Schwinds.
Der Eindringling sieht dem Ballustraden-Reiter des »Ständchens« (Zeichnung um 1830, Weigmann S. 66) ähnlich. —
»L'Italiana in Aigen«: Der alte, behäbige Orientale mit der Pfeife (vgl. die späteren Radierungen des Raucheralbums)
gelingt Schwind besser als der heldische Fremdling; mit Schwächen in den Kopfformen, die wir von Illustrationen kennen
(siehe z. B. das Taschenbuch »Philomele«, Brünn 1826), ist das Blatt doch eine passende Darstellung zu einer Opera
buffa. — »Aureliano in Palmira«: Das Thema ließ Schwind sich selbst entfremden (wenn diese Vignette überhaupt von
ihm stammt); die Architektur ist verlogen wie die Mannen, bei den Frauen findet der jugendliche Zeichner beinahe
zu sich selbst zurück. — »La gazza ladra«: Ein reizvolles Genrebild; die jugendlichen Figuren links vorne sind bester
»Schwind aus Wien«. — »Demetrio e Polibio«: Von mißverstandener Antike ähnlich angekränkelt wie »Aureliano«,
aber anachronistisch gemildert durch Webers »Jungfernkranz«. — »II Tancredi«: Das Land der Sehnsucht findet sich
leichter als die von der Romantik falsch tempierte gute alte Zeit. Das Mittelalter bot dem vormärzlichen Künstler ähnliche
Gefahren wie die rauhe Natur, da beide ihm entschwunden waren und er sie auf falschen Wegen suchte. — » Elisabetta«:
Das Blatt wäre gelungen, wenn vor der schon märchenhaften Königin auch der männliche Bittsteller die Distanz der
Perspektive bewahrt hätte.' — »La pietra del paragone«: Auch an diesem Prüfstein bewährt sich nur die überragende
Frau als Objekt der Kunst eines Jünglings. — »Cenerentola«: Dieses besonders seltene Blatt, das in einem vollständigen
Heft nur einmal2 nachweisbar ist und nun — ohne Schrift — in der Münchener Graphischen Sammlung neben der Vor-
zeichnung liegt, zeigt (von den Kopfformen der drei Mädchen etwa abgesehen) Schwinds Kompositions- und Fabulier-
talent schon in respektabler Größe. Der Kontrast zwischen dem hellen Raum mit dem Putztisch der beiden Stief-
schwestern und der dunklen, durch das Feuer noch dunkleren Kaminecke Aschenbrödels hat inhaltliche Bedeutung; der
Wandvorsprung mit seinem Schatten trennt zwei Welten. Nichts ist naheliegender, als hier den Aschenbrödel-Zyklus zu
vergleichen. Aber Schwind läßt in seinen reiferen Kompositionen desselben Themas (um 1853 und 1870, dazwischen
auch im rechten Seitenbild der Wiener Rossini-Lünette) Cenerentola ihre Schwestern vor dem Ballfest bedienen oder
bewundern, wodurch gerade der stille Reiz unserer Szene geschwunden ist. — »II matrimonio per cambiale«: Der aus-
nahmsweise übers rechte Eck gestellte Innenraum interessiert uns mehr, als wie sich's die drei Menschen hier possenhaft
einrichten werden. Das Blatt gehört aber trotz kleiner Mängel zu den erfreulichen der Reihe. — »Torvaldo e Dorlisca«
ist danach wieder ein Rückfall, veranlaßt durch romantische Eigennamen, nicht abgeschwächt durch das wattierte
polnische Kostüm. — »L'equivoco stravagante«: Die letzte und sphönste Vignette ist — kurz gesagt — ein Meisterstück.
Schwind scheint sich hier bewußt zu verabschieden und der holden Kunst für allerhand sonderbare Mißverständnisse
Abbitte zu leisten. Wie glänzend hat er es mit einem Mal verstanden — er, der bald der aufgegebenen Punkte akrobatischer
Meister w ard3 —, den niedrig zugemessenen Raum der oberen Blatthälfte für die beiden vorgebeugten Figuren wohnlich
zu machen. Und wie einfach ist das Requisit dieses schummerigen Innenraumes4 geworden! Ein bedeckter Tisch mit zwei
1 Ein Vergleich mit der Vorzeichnung in München ergibt, daß der Stecher den Kopf dieses Mannes vergrößert und vergröbert hat.
- Bei Herrn Regierungsrat Dr. Leo Meli, Wien.
3 Vgl. Alois Trost in diesen »Mitteilungen« 1916, Nr. 4.
* Ob auch dieses Blatt von Hofbauer gestochen worden ist, scheint bei der gleichfalls überraschenden Qualität der Technik allerdings zweifelhaft.