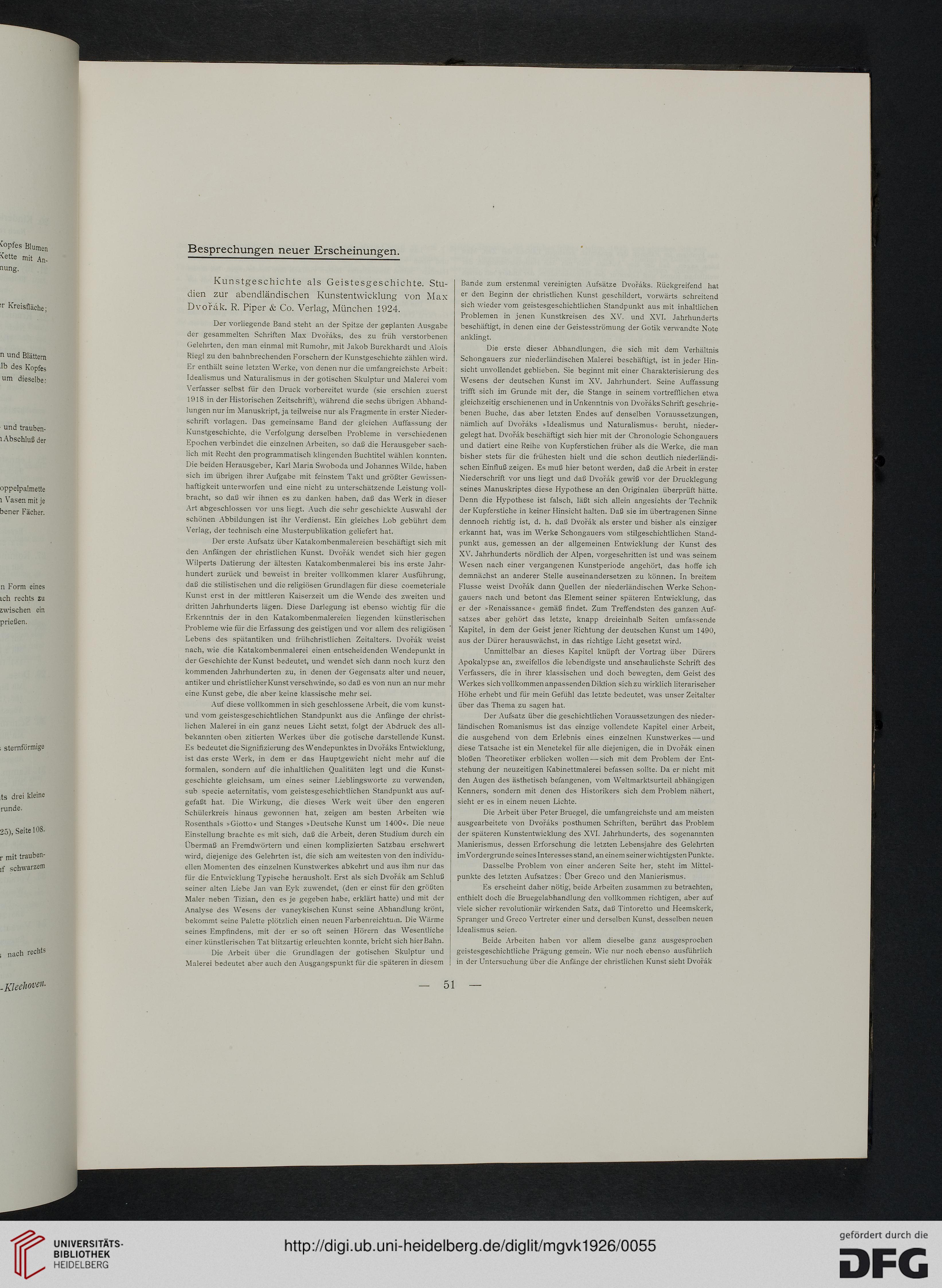Besprechungen neuer Erscheinungen.
Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Stu-
dien zur abendländischen Kunstentwicklung von Max
Dvorak. R. Piper & Co. Verlag, München 1924.
Der vorliegende Band steht an der Spitze der geplanten Ausgabe
der gesammelten Schriften Max Dvoraks, des zu früh verstorbenen
Gelehrten, den man einmal mit Rumohr, mit Jakob Burckhardt und Alois
Riegl zu den bahnbrechenden Forschern der Kunstgeschichte zählen wird.
Er enthält seine letzten Werke, von denen nur die umfangreichste Arbeit:
Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei vom
Verfasser selbst für den Druck vorbereitet wurde (sie erschien zuerst
1018 in der Historischen Zeitschrift), während die sechs übrigen Abhand-
lungen nur im Manuskript, ja teilweise nur als Fragmente in erster Nieder-
schrift vorlagen. Das gemeinsame Band der gleichen Auffassung der
Kunstgeschichte, die Verfolgung derselben Probleme in verschiedenen
Epochen verbindet die einzelnen Arbeiten, so daß die Herausgeber sach-
lich mit Recht den programmatisch klingenden Buchtitel wählen konnten.
Die beiden Herausgeber, Karl Maria Swoboda und Johannes Wilde, haben
sich im übrigen ihrer Aufgabe mit feinstem Takt und größter Gewissen-
haftigkeit unterworfen und eine nicht zu unterschätzende Leistung voll-
bracht, so daß wir ihnen es zu danken haben, daß das Werk in dieser
Art abgeschlossen vor uns liegt. Auch die sehr geschickte Auswahl der
schönen Abbildungen ist ihr Verdienst. Ein gleiches Lob gebührt dem
Verlag, der technisch eine Musterpublikation geliefert hat.
Der erste Aufsatz über Katakombenmalereien beschäftigt sich mit
den Anfängen der christlichen Kunst. Dvorak wendet sich hier gegen
Wilperts Datierung der ältesten Katakombenmalerei bis ins erste Jahr-
hundert zurück und beweist in breiter vollkommen klarer Ausführung,
daß die stilistischen und die religiösen Grundlagen für diese coemeteriale
Kunst erst in der mittleren Kaiserzeit um die Wende des zweiten und
dritten Jahrhunderts lägen. Diese Darlegung ist ebenso wichtig für die
Erkenntnis der in den Katakombenmalereien liegenden künstlerischen
Probleme wie für die Erfassung des geistigen und vor allem des religiösen
Lebens des spätantiken und frühchristlichen Zeitalters. Dvorak weist
nach, wie die Katakombenmalerei einen entscheidenden Wendepunkt in
der Geschichte der Kunst bedeutet, und wendet sich dann noch kurz den
kommenden Jahrhunderten zu, in denen der Gegensatz alter und neuer,
antiker und christlicher Kunst verschwinde, so daß es von nun an nur mehr
eine Kunst gebe, die aber keine klassische mehr sei.
Auf diese vollkommen in sich geschlossene Arbeit, die vom kunst-
und vom geistesgeschichtlichen Standpunkt aus die Anfänge der christ-
lichen Malerei in ein ganz neues Licht setzt, folgt der Abdruck des all-
bekannten oben zitierten Werkes über die gotische darstellende Kunst.
Es bedeutet die Signifizierung des Wendepunktes in Dvoräks Entwicklung,
ist das erste Werk, in dem er das Hauptgewicht nicht mehr auf die
formalen, sondern auf die inhaltlichen Qualitäten legt und die Kunst-
geschichte gleichsam, um eines seiner Lieblingsworte zu verwenden,
sub specie aeternitatis, vom geistesgeschichtlichen Standpunkt aus auf-
gefaßt hat. Die Wirkung, die dieses Werk weit über den engeren
Schülerkreis hinaus gewonnen hat, zeigen am besten Arbeiten wie
Rosenthals »Giotto« und Stanges »Deutsche Kunst um 1400«. Die neue
Einstellung brachte es mit sich, daß die Arbeit, deren Studium durch ein
Übermaß an Fremdwörtern und einen komplizierten Satzbau erschwert
wird, diejenige des Gelehrten ist, die sich am weitesten von den individu-
ellen Momenten des einzelnen Kunstwerkes abkehrt und aus ihm nur das
für die Entwicklung Typische herausholt. Erst als sich Dvofäk am Schluß
seiner alten Liebe Jan van Eyk zuwendet, (den er einst für den größten
Maler neben Tizian, den es je gegeben habe, erklärt hatte) und mit der
Analyse des Wesens der vaneykischen Kunst seine Abhandlung krönt,
bekommt seine Palette plötzlich einen neuen Farbenreichtum. Die Wärme
seines Empfindens, mit der er so oft seinen Hörern das Wesentliche
einer künstlerischen Tat blitzartig erleuchten konnte, bricht sich hier Bahn.
Die Arbeit über die Grundlagen der gotischen Skulptur und
Malerei bedeutet aber auch den Ausgangspunkt für die späteren in diesem
Bande zum erstenmal vereinigten Aufsätze Dvoräks. Rückgreifend hat
er den Beginn der christlichen Kunst geschildert, vorwärts schreitend
sich wieder vom geistesgeschichtlichen Standpunkt aus mit inhaltlichen
Problemen in jenen Kunstkreisen des XV. und XVI. Jahrhunderts
beschäftigt, in denen eine der Geistesströmung der Gotik verwandte Note
anklingt.
Die erste dieser Abhandlungen, die sich mit dem Verhältnis
Schongauers zur niederländischen Malerei beschäftigt, ist in jeder Hin-
sicht unvollendet geblieben. Sie beginnt mit einer Charakterisierung des
Wesens der deutschen Kunst im XV. Jahrhundert. Seine Auffassung
trifft sich im Grunde mit der, die Stange in seinem vortrefflichen etwa
gleichzeitig erschienenen und in Unkenntnis von Dvof äks Schrift geschrie-
benen Buche, das aber letzten Endes auf denselben Voraussetzungen,
nämlich auf Dvoraks »Idealismus und Naturalismus« beruht, nieder-
gelegt hat. Dvofäk beschäftigt sich hier mit der Chronologie Schongauers
und datiert eine Reihe von Kupferstichen früher als die Werke, die man
bisher stets für die frühesten hielt und die schon deutlich niederländi-
schen Einfluß zeigen. Es muß hier betont werden, daß die Arbeit in erster
Niederschrift vor uns liegt und daß Dvorak gewiß vor der Drucklegung
seines Manuskriptes diese Hypothese an den Originalen überprüft hätte.
Denn die Hypothese ist falsch, läßt sich allein angesichts der Technik
der Kupferstiche in keiner Hinsicht halten. Daß sie im übertragenen Sinne
dennoch richtig ist, d. h. daß Dvofäk als erster und bisher als einziger
erkannt hat, was im Werke Schongauers vom stilgeschichtlichen Stand-
punkt aus. gemessen an der allgemeinen Entwicklung der Kunst des
XV. Jahrhunderts nördlich der Alpen, vorgeschritten ist und was seinem
Wesen nach einer vergangenen Kunstperiode angehört, das hoffe ich
demnächst an anderer Stelle auseinandersetzen zu können. In breitem
Flusse weist Dvorak dann Quellen der niederländischen Werke Schon-
gauers nach und betont das Element seiner späteren Entwicklung, das
er der »Renaissance« gemäß findet. Zum Treffendsten des ganzen Auf-
satzes aber gehört das letzte, knapp dreieinhalb Seiten umfassende
Kapitel, in dem der Geist jener Richtung der deutschen Kunst um 1490,
aus der Dürer herauswächst, in das richtige Licht gesetzt wird.
Unmittelbar an dieses Kapitel knüpft der Vortrag über Dürers
Apokalypse an, zweifellos die lebendigste und anschaulichste Schrift des
Verfassers, die in ihrer klassischen und doch bewegten, dem Geist des
Werkes sichvollkommenanpassendenDiklion sichzu wirklich literarischer
Höhe erhebt und für mein Gefühl das letzte bedeutet, was unser Zeitalter
über das Thema zu sagen hat.
Der Aufsatz über die geschichtlichen Voraussetzungen des nieder-
ländischen Romanismus ist das einzige vollendete Kapitel einer Arbeit,
die ausgehend von dem Erlebnis eines einzelnen Kunstwerkes — und
diese Tatsache ist ein Menetekel für alle diejenigen, die in Dvofäk einen
bloßen Theoretiker erblicken wollen — sich mit dem Problem der Ent-
stehung der neuzeitigen Kabinettmalerei befassen sollte. Da er nicht mit
den Augen des ästhetisch befangenen, vom Weltmarktsurteil abhängigen
Kenners, sondern mit denen des Historikers sich dem Problem nähert,
sieht er es in einem neuen Lichte.
Die Arbeit über Peter Bruegel, die umfangreichste und am meisten
ausgearbeitete von Dvoräks posthumen Schriften, berührt das Problem
der späteren Kunstentwicklung des XVI. Jahrhunderts, des sogenannten
Manierismus, dessen Erforschung die letzten Lebensjahre des Gelehrten
imVordergrunde seines Interesses stand, an einem seiner wichtigsten Punkte.
Dasselbe Problem von einer anderen Seite her, steht im Mittel-
punkte des letzten Aufsatzes: Über Greco und den Manierismus.
Es erscheint daher nötig, beide Arbeiten zusammen zu betrachten,
enthielt doch die Bruegelabhandlung den vollkommen richtigen, aber auf
viele sicher revolutionär wirkenden Satz, daß Tintoretto und Heemskerk,
Spranger und Greco Vertreter einer und derselben Kunst, desselben neuen
Idealismus seien.
Beide Arbeiten haben vor allem dieselbe ganz ausgesprochen
geistesgeschichtliche Prägung gemein. Wie nur noch ebenso ausführlich
in der Untersuchung über die Anfänge der christlichen Kunst sieht Dvofäk
Kunstgeschichte als Geistesgeschichte. Stu-
dien zur abendländischen Kunstentwicklung von Max
Dvorak. R. Piper & Co. Verlag, München 1924.
Der vorliegende Band steht an der Spitze der geplanten Ausgabe
der gesammelten Schriften Max Dvoraks, des zu früh verstorbenen
Gelehrten, den man einmal mit Rumohr, mit Jakob Burckhardt und Alois
Riegl zu den bahnbrechenden Forschern der Kunstgeschichte zählen wird.
Er enthält seine letzten Werke, von denen nur die umfangreichste Arbeit:
Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei vom
Verfasser selbst für den Druck vorbereitet wurde (sie erschien zuerst
1018 in der Historischen Zeitschrift), während die sechs übrigen Abhand-
lungen nur im Manuskript, ja teilweise nur als Fragmente in erster Nieder-
schrift vorlagen. Das gemeinsame Band der gleichen Auffassung der
Kunstgeschichte, die Verfolgung derselben Probleme in verschiedenen
Epochen verbindet die einzelnen Arbeiten, so daß die Herausgeber sach-
lich mit Recht den programmatisch klingenden Buchtitel wählen konnten.
Die beiden Herausgeber, Karl Maria Swoboda und Johannes Wilde, haben
sich im übrigen ihrer Aufgabe mit feinstem Takt und größter Gewissen-
haftigkeit unterworfen und eine nicht zu unterschätzende Leistung voll-
bracht, so daß wir ihnen es zu danken haben, daß das Werk in dieser
Art abgeschlossen vor uns liegt. Auch die sehr geschickte Auswahl der
schönen Abbildungen ist ihr Verdienst. Ein gleiches Lob gebührt dem
Verlag, der technisch eine Musterpublikation geliefert hat.
Der erste Aufsatz über Katakombenmalereien beschäftigt sich mit
den Anfängen der christlichen Kunst. Dvorak wendet sich hier gegen
Wilperts Datierung der ältesten Katakombenmalerei bis ins erste Jahr-
hundert zurück und beweist in breiter vollkommen klarer Ausführung,
daß die stilistischen und die religiösen Grundlagen für diese coemeteriale
Kunst erst in der mittleren Kaiserzeit um die Wende des zweiten und
dritten Jahrhunderts lägen. Diese Darlegung ist ebenso wichtig für die
Erkenntnis der in den Katakombenmalereien liegenden künstlerischen
Probleme wie für die Erfassung des geistigen und vor allem des religiösen
Lebens des spätantiken und frühchristlichen Zeitalters. Dvorak weist
nach, wie die Katakombenmalerei einen entscheidenden Wendepunkt in
der Geschichte der Kunst bedeutet, und wendet sich dann noch kurz den
kommenden Jahrhunderten zu, in denen der Gegensatz alter und neuer,
antiker und christlicher Kunst verschwinde, so daß es von nun an nur mehr
eine Kunst gebe, die aber keine klassische mehr sei.
Auf diese vollkommen in sich geschlossene Arbeit, die vom kunst-
und vom geistesgeschichtlichen Standpunkt aus die Anfänge der christ-
lichen Malerei in ein ganz neues Licht setzt, folgt der Abdruck des all-
bekannten oben zitierten Werkes über die gotische darstellende Kunst.
Es bedeutet die Signifizierung des Wendepunktes in Dvoräks Entwicklung,
ist das erste Werk, in dem er das Hauptgewicht nicht mehr auf die
formalen, sondern auf die inhaltlichen Qualitäten legt und die Kunst-
geschichte gleichsam, um eines seiner Lieblingsworte zu verwenden,
sub specie aeternitatis, vom geistesgeschichtlichen Standpunkt aus auf-
gefaßt hat. Die Wirkung, die dieses Werk weit über den engeren
Schülerkreis hinaus gewonnen hat, zeigen am besten Arbeiten wie
Rosenthals »Giotto« und Stanges »Deutsche Kunst um 1400«. Die neue
Einstellung brachte es mit sich, daß die Arbeit, deren Studium durch ein
Übermaß an Fremdwörtern und einen komplizierten Satzbau erschwert
wird, diejenige des Gelehrten ist, die sich am weitesten von den individu-
ellen Momenten des einzelnen Kunstwerkes abkehrt und aus ihm nur das
für die Entwicklung Typische herausholt. Erst als sich Dvofäk am Schluß
seiner alten Liebe Jan van Eyk zuwendet, (den er einst für den größten
Maler neben Tizian, den es je gegeben habe, erklärt hatte) und mit der
Analyse des Wesens der vaneykischen Kunst seine Abhandlung krönt,
bekommt seine Palette plötzlich einen neuen Farbenreichtum. Die Wärme
seines Empfindens, mit der er so oft seinen Hörern das Wesentliche
einer künstlerischen Tat blitzartig erleuchten konnte, bricht sich hier Bahn.
Die Arbeit über die Grundlagen der gotischen Skulptur und
Malerei bedeutet aber auch den Ausgangspunkt für die späteren in diesem
Bande zum erstenmal vereinigten Aufsätze Dvoräks. Rückgreifend hat
er den Beginn der christlichen Kunst geschildert, vorwärts schreitend
sich wieder vom geistesgeschichtlichen Standpunkt aus mit inhaltlichen
Problemen in jenen Kunstkreisen des XV. und XVI. Jahrhunderts
beschäftigt, in denen eine der Geistesströmung der Gotik verwandte Note
anklingt.
Die erste dieser Abhandlungen, die sich mit dem Verhältnis
Schongauers zur niederländischen Malerei beschäftigt, ist in jeder Hin-
sicht unvollendet geblieben. Sie beginnt mit einer Charakterisierung des
Wesens der deutschen Kunst im XV. Jahrhundert. Seine Auffassung
trifft sich im Grunde mit der, die Stange in seinem vortrefflichen etwa
gleichzeitig erschienenen und in Unkenntnis von Dvof äks Schrift geschrie-
benen Buche, das aber letzten Endes auf denselben Voraussetzungen,
nämlich auf Dvoraks »Idealismus und Naturalismus« beruht, nieder-
gelegt hat. Dvofäk beschäftigt sich hier mit der Chronologie Schongauers
und datiert eine Reihe von Kupferstichen früher als die Werke, die man
bisher stets für die frühesten hielt und die schon deutlich niederländi-
schen Einfluß zeigen. Es muß hier betont werden, daß die Arbeit in erster
Niederschrift vor uns liegt und daß Dvorak gewiß vor der Drucklegung
seines Manuskriptes diese Hypothese an den Originalen überprüft hätte.
Denn die Hypothese ist falsch, läßt sich allein angesichts der Technik
der Kupferstiche in keiner Hinsicht halten. Daß sie im übertragenen Sinne
dennoch richtig ist, d. h. daß Dvofäk als erster und bisher als einziger
erkannt hat, was im Werke Schongauers vom stilgeschichtlichen Stand-
punkt aus. gemessen an der allgemeinen Entwicklung der Kunst des
XV. Jahrhunderts nördlich der Alpen, vorgeschritten ist und was seinem
Wesen nach einer vergangenen Kunstperiode angehört, das hoffe ich
demnächst an anderer Stelle auseinandersetzen zu können. In breitem
Flusse weist Dvorak dann Quellen der niederländischen Werke Schon-
gauers nach und betont das Element seiner späteren Entwicklung, das
er der »Renaissance« gemäß findet. Zum Treffendsten des ganzen Auf-
satzes aber gehört das letzte, knapp dreieinhalb Seiten umfassende
Kapitel, in dem der Geist jener Richtung der deutschen Kunst um 1490,
aus der Dürer herauswächst, in das richtige Licht gesetzt wird.
Unmittelbar an dieses Kapitel knüpft der Vortrag über Dürers
Apokalypse an, zweifellos die lebendigste und anschaulichste Schrift des
Verfassers, die in ihrer klassischen und doch bewegten, dem Geist des
Werkes sichvollkommenanpassendenDiklion sichzu wirklich literarischer
Höhe erhebt und für mein Gefühl das letzte bedeutet, was unser Zeitalter
über das Thema zu sagen hat.
Der Aufsatz über die geschichtlichen Voraussetzungen des nieder-
ländischen Romanismus ist das einzige vollendete Kapitel einer Arbeit,
die ausgehend von dem Erlebnis eines einzelnen Kunstwerkes — und
diese Tatsache ist ein Menetekel für alle diejenigen, die in Dvofäk einen
bloßen Theoretiker erblicken wollen — sich mit dem Problem der Ent-
stehung der neuzeitigen Kabinettmalerei befassen sollte. Da er nicht mit
den Augen des ästhetisch befangenen, vom Weltmarktsurteil abhängigen
Kenners, sondern mit denen des Historikers sich dem Problem nähert,
sieht er es in einem neuen Lichte.
Die Arbeit über Peter Bruegel, die umfangreichste und am meisten
ausgearbeitete von Dvoräks posthumen Schriften, berührt das Problem
der späteren Kunstentwicklung des XVI. Jahrhunderts, des sogenannten
Manierismus, dessen Erforschung die letzten Lebensjahre des Gelehrten
imVordergrunde seines Interesses stand, an einem seiner wichtigsten Punkte.
Dasselbe Problem von einer anderen Seite her, steht im Mittel-
punkte des letzten Aufsatzes: Über Greco und den Manierismus.
Es erscheint daher nötig, beide Arbeiten zusammen zu betrachten,
enthielt doch die Bruegelabhandlung den vollkommen richtigen, aber auf
viele sicher revolutionär wirkenden Satz, daß Tintoretto und Heemskerk,
Spranger und Greco Vertreter einer und derselben Kunst, desselben neuen
Idealismus seien.
Beide Arbeiten haben vor allem dieselbe ganz ausgesprochen
geistesgeschichtliche Prägung gemein. Wie nur noch ebenso ausführlich
in der Untersuchung über die Anfänge der christlichen Kunst sieht Dvofäk