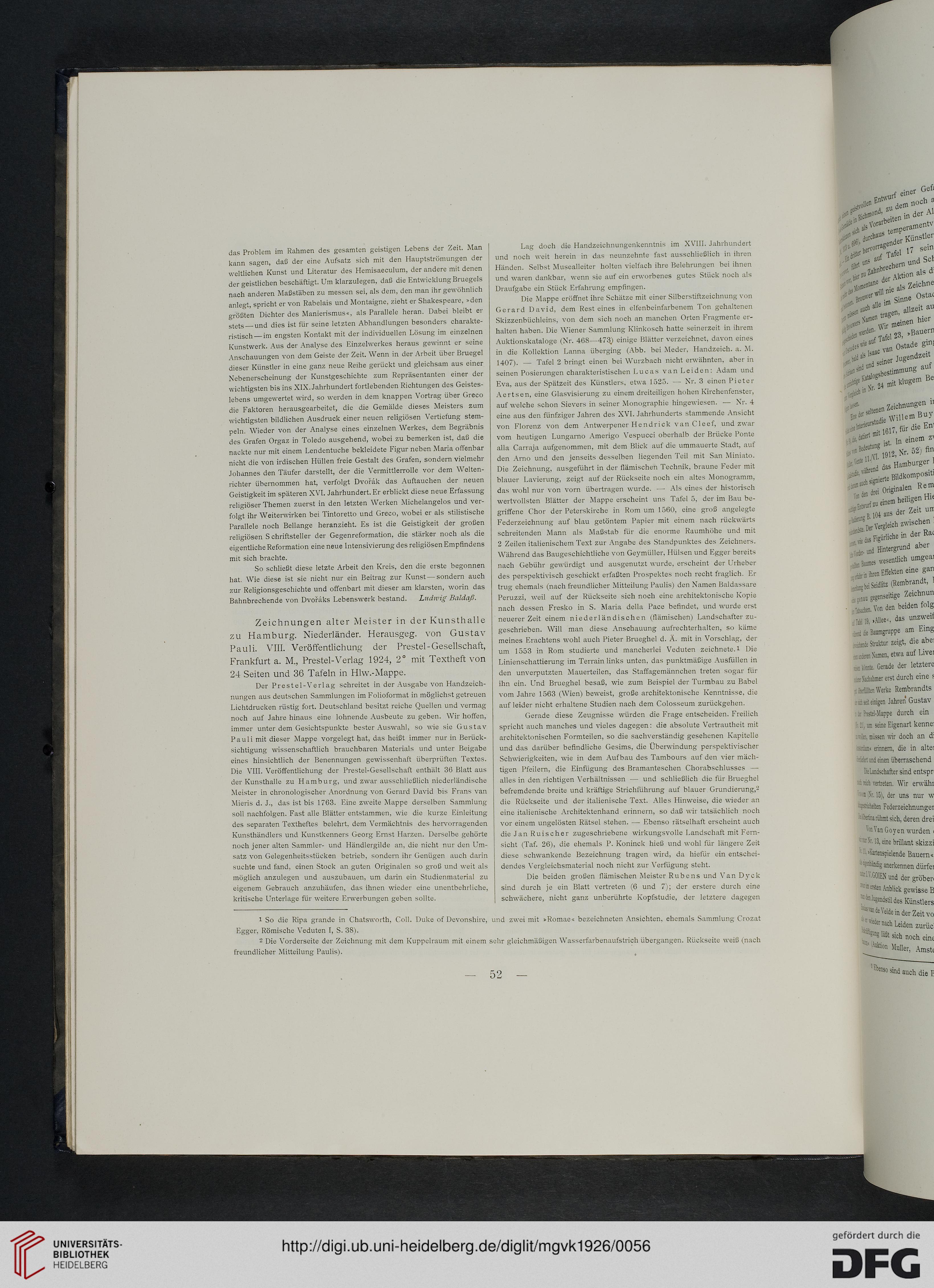das Problem im Rahmen des gesamten geistigen Lebens der Zeit. Man
kann sagen, daß der eine Aufsatz sich mit den Hauptströmungen der
weltlichen Kunst und Literatur des Hemisaeculum, der andere mit denen
der geistlichen beschäftigt. Um klarzulegen, daß die Entwicklung Bruegels
nach anderen Maßstäben zu messen sei, als dem, den man ihr gewöhnlich
anlegt, spricht er von Rabelais und Montaigne, zieht er Shakespeare, >den
größten Dichter des Manierismus«, als Parallele heran. Dabei bleibt er
stets — und dies ist für seine letzten Abhandlungen besonders charakte-
ristisch— im engsten Kontakt mit der individuellen Lösung im einzelnen
Kunstwerk. Aus der Analyse des Einzelwerkes heraus gewinnt er seine
Anschauungen von dem Geiste der Zeit. Wenn in der Arbeit über Bruegel
dieser Künstler in eine ganz neue Reihe gerückt und gleichsam aus einer
Nebenerscheinung der Kunstgeschichte zum Repräsentanten einer der
wichtigsten bis ins XIX. Jahrhundert fortlebenden Richtungen des Geistes-
lebens umgewertet wird, so werden in dem knappen Vortrag über Greco
die Faktoren herausgearbeitet, die die Gemälde dieses Meisters zum
wichtigsten bildlichen Ausdruck einer neuen religiösen Vertiefung stem-
peln. Wieder von der Analyse eines einzelnen Werkes, dem Begräbnis
des Grafen Orgaz in Toledo ausgehend, wobei zu bemerken ist, daß die
nackte nur mit einem Lendentuche bekleidete Figur neben Maria offenbar
nicht die von irdischen Hüllen freie Gestalt des Grafen, sondern vielmehr
Johannes den Täufer darstellt, der die Vermittlerrolle vor dem Welten-
richter übernommen hat, verfolgt Dvorak das Auftauchen der neuen
Geistigkeit im späteren XVI. Jahrhundert. Er erblickt diese neue Erfassung
religiöser Themen zuerst in den letzten Werken Michelangelos und ver-
folgt ihr Weiterwirken bei Tintoretto und Greco, wobei er als stilistische
Parallele noch Beilange heranzieht. Es ist die Geistigkeit der großen
religiösen S chriftsteller der Gegenreformation, die stärker noch als die
eigentliche Reformation eine neue Intensivierung des religiösen Empfindens
mit sich brachte.
So schließt diese letzte Arbeit den Kreis, den die erste begonnen
hat. Wie diese ist sie nicht nur ein Beitrag zur Kunst — sondern auch
zur Religionsgeschichte und offenbart mit dieser am klarsten, worin das
Bahnbrechende von Dvoräks Lebenswerk bestand. Ludwig Baldaß.
Zeichnungen alter Meister in der Kunsthalle
zu Hamburg. Niederländer. Herausgeg. von Gustav
Pauli. VIII. Veröffentlichung der Prestel-Gesellschaft,
Frankfurt a. M., Prestel -Verlag 1924, 2° mit Textheft von
24 Seiten und 36 Tafeln in Hlw.-Mappe.
Der Prestel-Ver 1 ag schreitet in der Ausgabe von Handzeich-
nungen aus deutschen Sammlungen im Folioformat in möglichst getreuen
Lichtdrucken rüstig fort. Deutschland besitzt reiche Quellen und vermag
noch auf Jahre hinaus eine lohnende Ausbeute zu geben. Wir hoffen,
immer unter dem Gesichtspunkte bester Auswahl, so wie sie Gustav
Pauli mit dieser Mappe vorgelegt hat, das heißt immer nur in Berück-
sichtigung wissenschaftlich brauchbaren Materials und unter Beigabe
eines hinsichtlich der Benennungen gewissenhaft überprüften Textes.
Die VIII. Veröffentlichung der Prestel-Gesellschaft enthält 36 Blatt aus
der Kunsthalle zu Hamburg, und zwar ausschließlich niederländische
Meister in chronologischer Anordnung von Gerard David bis Frans van
Mieris d. J., das ist bis 1763. Eine zweite Mappe derselben Sammlung
soll nachfolgen. Fast alle Blätter entstammen, wie die kurze Einleitung
des separaten Textheftes belehrt, dem Vermächtnis des hervorragenden
Kunsthändlers und Kunstkenners Georg Ernst Harzen. Derselbe gehörte
noch jener alten Sammler- und Händlergilde an, die nicht nur den Um-
satz von Gelegenheitsstücken betrieb, sondern ihr Genügen auch darin
suchte und fand, einen Stock an guten Originalen so groß und weit als
möglich anzulegen und auszubauen, um darin ein Studienmaterial zu
eigenem Gebrauch anzuhäufen, das ihnen wieder eine unentbehrliche,
kritische Unterlage für weitere Erwerbungen geben sollte.
Lag doch die Handzeichnungenkenntnis im XVIII. Jahrhundert
und noch weit herein in das neunzehnte fast ausschließlich in ihren
Händen. Selbst Musealleiter holten vielfach ihre Belehrungen bei ihnen
und waren dankbar, wenn sie auf ein erworbenes gutes Stück noch als
Draufgabe ein Stück Erfahrung empfingen.
Die Mappe eröffnet ihre Schätze mit einer Silberstiftzeichnung von
Gerard David, dem Rest eines in elfenbeinfarbenem Ton gehaltenen
Skizzenbüchleins, von dem sich noch an manchen Orten Fragmente er-
halten haben. Die Wiener Sammlung Klinkosch hatte seinerzeit in ihrem
Auktionskataloge (Nr. 468—473^ einige Blätter verzeichnet, davon eines
in die Kollektion Lanna überging (Abb. bei Meder. Handzeich, a. M.
1407). — Tafel 2 bringt einen bei Wurzbach nicht erwähnten, aber in
seinen Posierungen charakteristischen Lucas van Leiden: Adam und
Eva. aus der Spätzeit des Künstlers, etwa 1525. — Nr. 3 einen Pieter
Aertsen, eine Glasvisierung zu einem dreiteiligen hohen Kirchenfenster,
auf welche schon Sievers in seiner Monographie hingewiesen. — Nr. 4
eine aus den fünfziger Jahren des XVI. Jahrhunderts stammende Ansicht
von Florenz von dem Antwerpener Hendrick van Cleef, und zwar
vom heutigen Lungarno Amerigo Vespucci oberhalb der Brücke Ponte
alla Carraja aufgenommen, mit dem Blick auf die ummauerte Stadt, auf
den Arno und den jenseits desselben liegenden Teil mit San Miniato.
Die Zeichnung, ausgeführt in der flämischen Technik, braune Feder mit
blauer Lavierung, zeigt auf der Rückseite noch ein altes Monogramm,
das wohl nur von vorn übertragen wurde. — Als eines der historisch
wertvollsten Blätter der Mappe erscheint uns Tafel 5, der im Bau be-
griffene Chor der Peterskirche in Rom um 1560, eine groß angelegte
Federzeichnung auf blau getöntem Papier mit einem nach rückwärts
schreitenden Mann als Maßstab für die enorme Raumhöhe und mit
2 Zeilen italienischem Text zur Angabe des Standpunktes des Zeichners.
Während das Baugeschichtliche von Geymüller, Hülsen und Egger bereits
nach Gebühr gewürdigt und ausgenutzt wurde, erscheint der Urheber
des perspektivisch geschickt erfaßten Prospektes noch recht fraglich. Er
trug ehemals (nach freundlicher Mitteilung Paulis) den Namen Baldassare
Peruzzi, weil auf der Rückseite sich noch eine architektonische Kopie
nach dessen Fresko in S. Maria delia Pace befindet, und wurde erst
neuerer Zeit einem niederländischen (flämischen) Landschafter zu-
geschrieben. Will man diese Anschauung aufrechterhalten, so käme
meines Erachtens wohl auch Pieter Brueghel d. A. mit in Vorschlag, der
um 1553 in Rom studierte und mancherlei Veduten zeichnete, i Die
Linienschattierung im Terrain links unten, das punktmäßige Ausfüllen in
den unverputzten Mauerteilen, das Staffagemännchen treten sogar für
ihn ein. Und Brueghel besaß, wie zum Beispiel der Turmbau zu Babel
vom Jahre 1563 (Wien) beweist, große architektonische Kenntnisse, die
auf leider nicht erhaltene Studien nach dem Colosseum zurückgehen.
Gerade diese Zeugnisse würden die Frage entscheiden. Freilich
spricht auch manches und vieles dagegen: die absolute Vertrautheit mit
architektonischen Formteilen, so die sachverständig gesehenen Kapitelle
und das darüber befindliche Gesims, die Überwindung perspektivischer
Schwierigkeiten, wie in dem Aufbau des Tambours auf den vier mäch-
tigen Pfeilern, die Einfügung des Bramanteschen Chorabschlusses —
alles in den richtigen Verhältnissen — und schließlich die für Brueghel
befremdende breite und kräftige Strichführung auf blauer Grundierung,-
die Rückseite und der italienische Text. Alles Hinweise, die wieder an
eine italienische Architektenhand erinnern, so daß wir tatsächlich noch
vor einem ungelösten Rätsel stehen. — Ebenso rätselhaft erscheint auch
die Jan Ruischer zugeschriebene wirkungsvolle Landschaft mit Fern-
sicht (Taf. 26), die ehemals P. Köninck hieß und wohl für längere Zeit
diese schwankende Bezeichnung tragen wird, da hiefür ein entschei-
dendes Vergleiehsmaterial noch nicht zur Verfügung steht.
Die beiden großen flämischen Meister Rubens und Van Dyck
sind durch je ein Blatt vertreten (6 und 7); der erstere durch eine
schwächere, nicht ganz unberührte Kopfstudie, der letztere dagegen
1 So die Ripa grande in Chatsworth, Coli. Duke of Devonshire, und zwei mit »Romae« bezeichneten Ansichten, ehemals Sammlung Crozat
Egger. Römische Veduten I, S. 38).
2 Die Vorderseite der Zeichnung mit dem Kuppelraum mit einem sehr gleichmäßigen Wasserfarbenaufstrich übergangen. Rückseite weiß (nach
freundlicher Mitteilung Paulis).
— 52 —
,f einet Gef'
?f. ji£r.rn»nd' .„nin der AI
,^eld; Künstler
l7/s;t
0 "° Lecher" und Set
>^rAWionalsd
Sinne Ostac
hier
<i*0s<adeg^
^*äUnr5ti»n>ungauf
»nen Zeichnungen Ö
""^Willem Buy
für die En"
einem,'
/:; „ das Hamburgerl
^S^B—ositi
Originalen Rem
ti»einem heiligen H,.
' ,11«*» ^ Z«' un
'Der Vergleich zachen
.«toFigürliche in der Ra<
^„.„d Hintergrund aber
«entlich umgea,
m ihren Effekten eine gar,
^Id Seidita (Rembrandt,
i(dl* gegenseitige Zeichnun
■ iÄ. Von den beiden folg
J_„ niwtt'Pli
fljt% >AUee«.
das unzweif
i&iMfipc ^ni Ein.,
■tat Struktur zeigt, die abe
dm« Samen, etwa auf Uvei
«Knie. Gerade der letztere
v.t&bihmer erst durch eine s
lej ka Werke Rembrandts
. -ii seit einigen Jahren Gustav
■i fttstel-Mappe durch ":
Ml
ein
um seine Eigenart kenne'
3. müssen wir doch
an d:
erinnern, die in altei
einen überraschend
DieUndschafter sind entspr
- sich vertreten. Wir erwähl
Sr. 15). der uns nur w
-fächelten Federzeichnunger
"irbrühmt sich, deren drei
^nVanGoyen wurden i
?!t!Sr. 13, eine brillant skizzi
"'■'lianenspielende Bauern
--n dürfei
'-"'•WEN und der groben
r-'s listen Anblick gewisse B
;;:°%ndstil des Künstlers
^«ndeVeldein derZeitvo
•;;"*nachUidenzurüc
sich „och ein«
Ebt,w> sind auch die?
kann sagen, daß der eine Aufsatz sich mit den Hauptströmungen der
weltlichen Kunst und Literatur des Hemisaeculum, der andere mit denen
der geistlichen beschäftigt. Um klarzulegen, daß die Entwicklung Bruegels
nach anderen Maßstäben zu messen sei, als dem, den man ihr gewöhnlich
anlegt, spricht er von Rabelais und Montaigne, zieht er Shakespeare, >den
größten Dichter des Manierismus«, als Parallele heran. Dabei bleibt er
stets — und dies ist für seine letzten Abhandlungen besonders charakte-
ristisch— im engsten Kontakt mit der individuellen Lösung im einzelnen
Kunstwerk. Aus der Analyse des Einzelwerkes heraus gewinnt er seine
Anschauungen von dem Geiste der Zeit. Wenn in der Arbeit über Bruegel
dieser Künstler in eine ganz neue Reihe gerückt und gleichsam aus einer
Nebenerscheinung der Kunstgeschichte zum Repräsentanten einer der
wichtigsten bis ins XIX. Jahrhundert fortlebenden Richtungen des Geistes-
lebens umgewertet wird, so werden in dem knappen Vortrag über Greco
die Faktoren herausgearbeitet, die die Gemälde dieses Meisters zum
wichtigsten bildlichen Ausdruck einer neuen religiösen Vertiefung stem-
peln. Wieder von der Analyse eines einzelnen Werkes, dem Begräbnis
des Grafen Orgaz in Toledo ausgehend, wobei zu bemerken ist, daß die
nackte nur mit einem Lendentuche bekleidete Figur neben Maria offenbar
nicht die von irdischen Hüllen freie Gestalt des Grafen, sondern vielmehr
Johannes den Täufer darstellt, der die Vermittlerrolle vor dem Welten-
richter übernommen hat, verfolgt Dvorak das Auftauchen der neuen
Geistigkeit im späteren XVI. Jahrhundert. Er erblickt diese neue Erfassung
religiöser Themen zuerst in den letzten Werken Michelangelos und ver-
folgt ihr Weiterwirken bei Tintoretto und Greco, wobei er als stilistische
Parallele noch Beilange heranzieht. Es ist die Geistigkeit der großen
religiösen S chriftsteller der Gegenreformation, die stärker noch als die
eigentliche Reformation eine neue Intensivierung des religiösen Empfindens
mit sich brachte.
So schließt diese letzte Arbeit den Kreis, den die erste begonnen
hat. Wie diese ist sie nicht nur ein Beitrag zur Kunst — sondern auch
zur Religionsgeschichte und offenbart mit dieser am klarsten, worin das
Bahnbrechende von Dvoräks Lebenswerk bestand. Ludwig Baldaß.
Zeichnungen alter Meister in der Kunsthalle
zu Hamburg. Niederländer. Herausgeg. von Gustav
Pauli. VIII. Veröffentlichung der Prestel-Gesellschaft,
Frankfurt a. M., Prestel -Verlag 1924, 2° mit Textheft von
24 Seiten und 36 Tafeln in Hlw.-Mappe.
Der Prestel-Ver 1 ag schreitet in der Ausgabe von Handzeich-
nungen aus deutschen Sammlungen im Folioformat in möglichst getreuen
Lichtdrucken rüstig fort. Deutschland besitzt reiche Quellen und vermag
noch auf Jahre hinaus eine lohnende Ausbeute zu geben. Wir hoffen,
immer unter dem Gesichtspunkte bester Auswahl, so wie sie Gustav
Pauli mit dieser Mappe vorgelegt hat, das heißt immer nur in Berück-
sichtigung wissenschaftlich brauchbaren Materials und unter Beigabe
eines hinsichtlich der Benennungen gewissenhaft überprüften Textes.
Die VIII. Veröffentlichung der Prestel-Gesellschaft enthält 36 Blatt aus
der Kunsthalle zu Hamburg, und zwar ausschließlich niederländische
Meister in chronologischer Anordnung von Gerard David bis Frans van
Mieris d. J., das ist bis 1763. Eine zweite Mappe derselben Sammlung
soll nachfolgen. Fast alle Blätter entstammen, wie die kurze Einleitung
des separaten Textheftes belehrt, dem Vermächtnis des hervorragenden
Kunsthändlers und Kunstkenners Georg Ernst Harzen. Derselbe gehörte
noch jener alten Sammler- und Händlergilde an, die nicht nur den Um-
satz von Gelegenheitsstücken betrieb, sondern ihr Genügen auch darin
suchte und fand, einen Stock an guten Originalen so groß und weit als
möglich anzulegen und auszubauen, um darin ein Studienmaterial zu
eigenem Gebrauch anzuhäufen, das ihnen wieder eine unentbehrliche,
kritische Unterlage für weitere Erwerbungen geben sollte.
Lag doch die Handzeichnungenkenntnis im XVIII. Jahrhundert
und noch weit herein in das neunzehnte fast ausschließlich in ihren
Händen. Selbst Musealleiter holten vielfach ihre Belehrungen bei ihnen
und waren dankbar, wenn sie auf ein erworbenes gutes Stück noch als
Draufgabe ein Stück Erfahrung empfingen.
Die Mappe eröffnet ihre Schätze mit einer Silberstiftzeichnung von
Gerard David, dem Rest eines in elfenbeinfarbenem Ton gehaltenen
Skizzenbüchleins, von dem sich noch an manchen Orten Fragmente er-
halten haben. Die Wiener Sammlung Klinkosch hatte seinerzeit in ihrem
Auktionskataloge (Nr. 468—473^ einige Blätter verzeichnet, davon eines
in die Kollektion Lanna überging (Abb. bei Meder. Handzeich, a. M.
1407). — Tafel 2 bringt einen bei Wurzbach nicht erwähnten, aber in
seinen Posierungen charakteristischen Lucas van Leiden: Adam und
Eva. aus der Spätzeit des Künstlers, etwa 1525. — Nr. 3 einen Pieter
Aertsen, eine Glasvisierung zu einem dreiteiligen hohen Kirchenfenster,
auf welche schon Sievers in seiner Monographie hingewiesen. — Nr. 4
eine aus den fünfziger Jahren des XVI. Jahrhunderts stammende Ansicht
von Florenz von dem Antwerpener Hendrick van Cleef, und zwar
vom heutigen Lungarno Amerigo Vespucci oberhalb der Brücke Ponte
alla Carraja aufgenommen, mit dem Blick auf die ummauerte Stadt, auf
den Arno und den jenseits desselben liegenden Teil mit San Miniato.
Die Zeichnung, ausgeführt in der flämischen Technik, braune Feder mit
blauer Lavierung, zeigt auf der Rückseite noch ein altes Monogramm,
das wohl nur von vorn übertragen wurde. — Als eines der historisch
wertvollsten Blätter der Mappe erscheint uns Tafel 5, der im Bau be-
griffene Chor der Peterskirche in Rom um 1560, eine groß angelegte
Federzeichnung auf blau getöntem Papier mit einem nach rückwärts
schreitenden Mann als Maßstab für die enorme Raumhöhe und mit
2 Zeilen italienischem Text zur Angabe des Standpunktes des Zeichners.
Während das Baugeschichtliche von Geymüller, Hülsen und Egger bereits
nach Gebühr gewürdigt und ausgenutzt wurde, erscheint der Urheber
des perspektivisch geschickt erfaßten Prospektes noch recht fraglich. Er
trug ehemals (nach freundlicher Mitteilung Paulis) den Namen Baldassare
Peruzzi, weil auf der Rückseite sich noch eine architektonische Kopie
nach dessen Fresko in S. Maria delia Pace befindet, und wurde erst
neuerer Zeit einem niederländischen (flämischen) Landschafter zu-
geschrieben. Will man diese Anschauung aufrechterhalten, so käme
meines Erachtens wohl auch Pieter Brueghel d. A. mit in Vorschlag, der
um 1553 in Rom studierte und mancherlei Veduten zeichnete, i Die
Linienschattierung im Terrain links unten, das punktmäßige Ausfüllen in
den unverputzten Mauerteilen, das Staffagemännchen treten sogar für
ihn ein. Und Brueghel besaß, wie zum Beispiel der Turmbau zu Babel
vom Jahre 1563 (Wien) beweist, große architektonische Kenntnisse, die
auf leider nicht erhaltene Studien nach dem Colosseum zurückgehen.
Gerade diese Zeugnisse würden die Frage entscheiden. Freilich
spricht auch manches und vieles dagegen: die absolute Vertrautheit mit
architektonischen Formteilen, so die sachverständig gesehenen Kapitelle
und das darüber befindliche Gesims, die Überwindung perspektivischer
Schwierigkeiten, wie in dem Aufbau des Tambours auf den vier mäch-
tigen Pfeilern, die Einfügung des Bramanteschen Chorabschlusses —
alles in den richtigen Verhältnissen — und schließlich die für Brueghel
befremdende breite und kräftige Strichführung auf blauer Grundierung,-
die Rückseite und der italienische Text. Alles Hinweise, die wieder an
eine italienische Architektenhand erinnern, so daß wir tatsächlich noch
vor einem ungelösten Rätsel stehen. — Ebenso rätselhaft erscheint auch
die Jan Ruischer zugeschriebene wirkungsvolle Landschaft mit Fern-
sicht (Taf. 26), die ehemals P. Köninck hieß und wohl für längere Zeit
diese schwankende Bezeichnung tragen wird, da hiefür ein entschei-
dendes Vergleiehsmaterial noch nicht zur Verfügung steht.
Die beiden großen flämischen Meister Rubens und Van Dyck
sind durch je ein Blatt vertreten (6 und 7); der erstere durch eine
schwächere, nicht ganz unberührte Kopfstudie, der letztere dagegen
1 So die Ripa grande in Chatsworth, Coli. Duke of Devonshire, und zwei mit »Romae« bezeichneten Ansichten, ehemals Sammlung Crozat
Egger. Römische Veduten I, S. 38).
2 Die Vorderseite der Zeichnung mit dem Kuppelraum mit einem sehr gleichmäßigen Wasserfarbenaufstrich übergangen. Rückseite weiß (nach
freundlicher Mitteilung Paulis).
— 52 —
,f einet Gef'
?f. ji£r.rn»nd' .„nin der AI
,^eld; Künstler
l7/s;t
0 "° Lecher" und Set
>^rAWionalsd
Sinne Ostac
hier
<i*0s<adeg^
^*äUnr5ti»n>ungauf
»nen Zeichnungen Ö
""^Willem Buy
für die En"
einem,'
/:; „ das Hamburgerl
^S^B—ositi
Originalen Rem
ti»einem heiligen H,.
' ,11«*» ^ Z«' un
'Der Vergleich zachen
.«toFigürliche in der Ra<
^„.„d Hintergrund aber
«entlich umgea,
m ihren Effekten eine gar,
^Id Seidita (Rembrandt,
i(dl* gegenseitige Zeichnun
■ iÄ. Von den beiden folg
J_„ niwtt'Pli
fljt% >AUee«.
das unzweif
i&iMfipc ^ni Ein.,
■tat Struktur zeigt, die abe
dm« Samen, etwa auf Uvei
«Knie. Gerade der letztere
v.t&bihmer erst durch eine s
lej ka Werke Rembrandts
. -ii seit einigen Jahren Gustav
■i fttstel-Mappe durch ":
Ml
ein
um seine Eigenart kenne'
3. müssen wir doch
an d:
erinnern, die in altei
einen überraschend
DieUndschafter sind entspr
- sich vertreten. Wir erwähl
Sr. 15). der uns nur w
-fächelten Federzeichnunger
"irbrühmt sich, deren drei
^nVanGoyen wurden i
?!t!Sr. 13, eine brillant skizzi
"'■'lianenspielende Bauern
--n dürfei
'-"'•WEN und der groben
r-'s listen Anblick gewisse B
;;:°%ndstil des Künstlers
^«ndeVeldein derZeitvo
•;;"*nachUidenzurüc
sich „och ein«
Ebt,w> sind auch die?