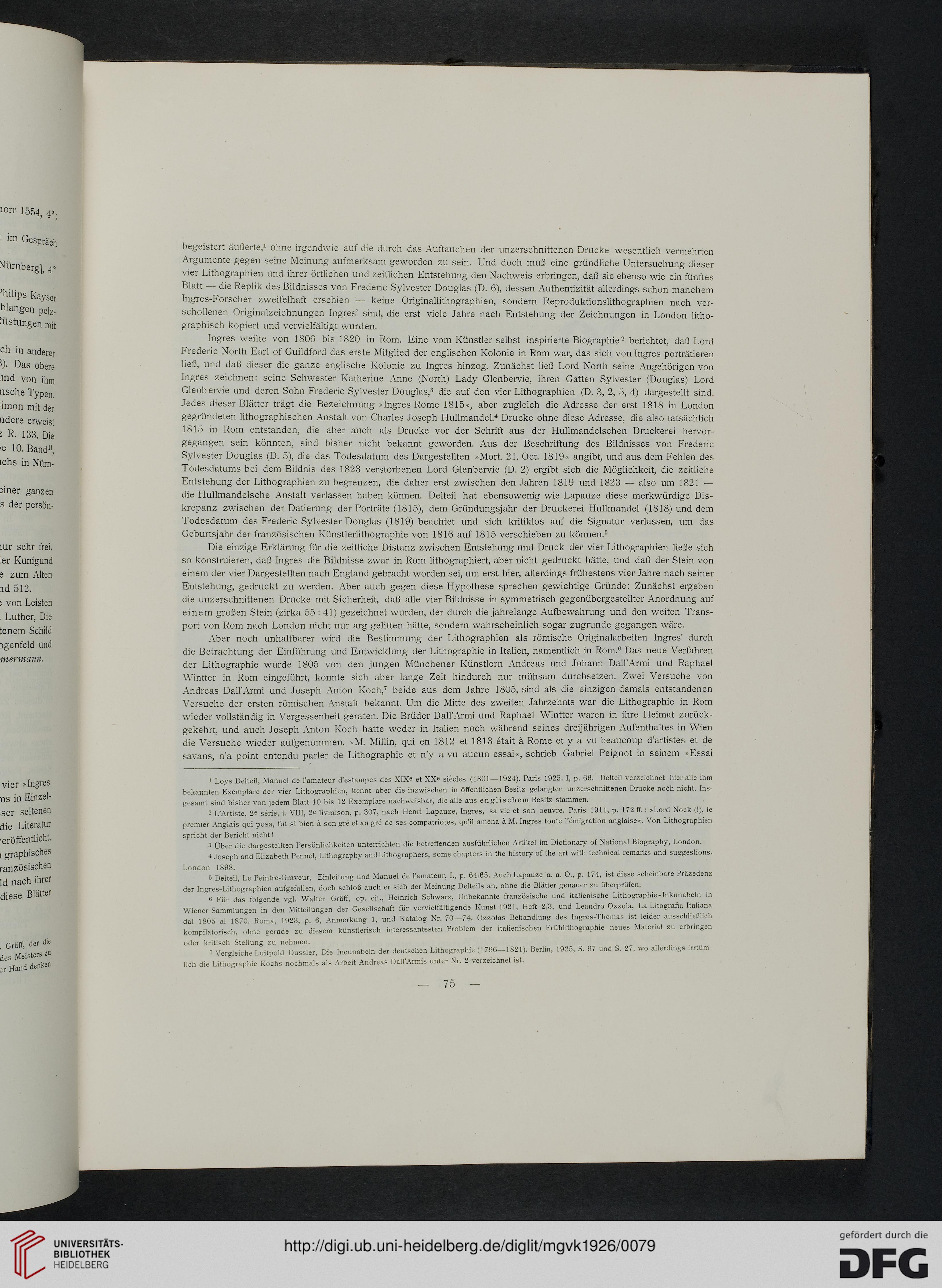begeistert äußerte,1 ohne irgendwie auf die durch das Auftauchen der unzerschnittenen Drucke wesentlich vermehrten
Argumente gegen seine Meinung aufmerksam geworden zu sein. Und doch muß eine gründliche Untersuchung dieser
vier Lithographien und ihrer örtlichen und zeitlichen Entstehung den Nachweis erbringen, daß sie ebenso wie ein fünftes
Blatt — die Replik des Bildnisses von Frederic Sylvester Douglas (D. 6), dessen Authentizität allerdings schon manchem
Ingres-Forscher zweifelhaft erschien — keine Originallithographien, sondern Reproduktionslithographien nach ver-
schollenen Originalzeichnungen Ingres' sind, die erst viele Jahre nach Entstehung der Zeichnungen in London litho-
graphisch kopiert und vervielfältigt wurden.
Ingres weilte von 1806 bis 1820 in Rom. Eine vom Künstler selbst inspirierte Biographie2 berichtet, daß Lord
Frederic North Earl of Guildford das erste Mitglied der englischen Kolonie in Rom war, das sich von Ingres porträtieren
ließ, und daß dieser die ganze englische Kolonie zu Ingres hinzog. Zunächst ließ Lord North seine Angehörigen von
Ingres zeichnen: seine Schwester Katherine Anne (North) Lady Glenbervie, ihren Gatten Sylvester (Douglas) Lord
Glenbervie und deren Sohn Frederic Sylvester Douglas,3 die auf den vier Lithographien (D. 3, 2, 5, 4) dargestellt sind.
Jedes dieser Blätter trägt die Bezeichnung »Ingres Rome 1815«, aber zugleich die Adresse der erst 1818 in London
gegründeten lithographischen Anstalt von Charles Joseph Hullmandel.4 Drucke ohne diese Adresse, die also tatsächlich
181 5 in Rom entstanden, die aber auch als Drucke vor der Schrift aus der Hullmandelschen Druckerei hervor-
gegangen sein könnten, sind bisher nicht bekannt geworden. Aus der Beschriftung des Bildnisses von Frederic
Sylvester Douglas (D. 5), die das Todesdatum des Dargestellten »Mort. 21. Oct. 1819« angibt, und aus dem Fehlen des
Todesdatums bei dem Bildnis des 1823 verstorbenen Lord Glenbervie (D. 2) ergibt sich die Möglichkeit, die zeitliche
Entstehung der Lithographien zu begrenzen, die daher erst zwischen den Jahren 1819 und 1823 — also um 1821 —
die Hullmandelsche Anstalt verlassen haben können. Delteil hat ebensowenig wie Lapauze diese merkwürdige Dis-
krepanz zwischen der Datierung der Porträte (1815), dem Gründungsjahr der Druckerei Hullmandel (1818) und dem
Todesdatum des Frederic Sylvester Douglas (1819) beachtet und sich kritiklos auf die Signatur verlassen, um das
Geburtsjahr der französischen Künstlerlithographie von 1816 auf 1815 verschieben zu können.5
Die einzige Erklärung für die zeitliche Distanz zwischen Entstehung und Druck der vier Lithographien ließe sich
so konstruieren, daß Ingres die Bildnisse zwar in Rom lithographiert, aber nicht gedruckt hätte, und daß der Stein von
einem der vier Dargestellten nach England gebracht worden sei, um erst hier, allerdings frühestens vier Jahre nach seiner
Entstehung, gedruckt zu werden. Aber auch gegen diese Hypothese sprechen gewichtige Gründe: Zunächst ergeben
die unzerschnittenen Drucke mit Sicherheit, daß alle vier Bildnisse in symmetrisch gegenübergestellter Anordnung auf
einem großen Stein (zirka 55 : 41) gezeichnet wurden, der durch die jahrelange Aufbewahrung und den weiten Trans-
port von Rom nach London nicht nur arg gelitten hätte, sondern wahrscheinlich sogar zugrunde gegangen wäre.
Aber noch unhaltbarer wird die Bestimmung der Lithographien als römische Originalarbeiten Ingres' durch
die Betrachtung der Einführung und Entwicklung der Lithographie in Italien, namentlich in Rom." Das neue Verfahren
der Lithographie wurde 1805 von den jungen Münchener Künstlern Andreas und Johann DaH'Armi und Raphael
Wintter in Rom eingeführt, konnte sich aber lange Zeit hindurch nur mühsam durchsetzen. Zwei Versuche von
Andreas Dall'Armi und Joseph Anton Koch,7 beide aus dem Jahre 1805, sind als die einzigen damals entstandenen
Versuche der ersten römischen Anstalt bekannt. Um die Mitte des zweiten Jahrzehnts war die Lithographie in Rom
wieder vollständig in Vergessenheit geraten. Die Brüder Dall'Armi und Raphael Wintter waren in ihre Heimat zurück-
gekehrt, und auch Joseph Anton Koch hatte weder in Italien noch während seines dreijährigen Aufenthaltes in Wien
die Versuche wieder aufgenommen. »M. Miliin, qui en 1812 et 1813 etait ä Rome et y a vu beaucoup d'artistes et de
savans, n'a point entendu parier de Lithographie et n'y a vu aucun essai«, schrieb Gabriel Peignot in seinem »Essai
1 Loys Delteil, .Manuel de l'amateur d'estampes des XIXe et XX« siecles (1801 — 1924). Paris 1925. I, p. 66. Delteil verzeichnet hier alle ihm
bekannten Exemplare der vier Lithographien, kennt aber die inzwischen in öffentlichen Besitz gelangten unzerschnittenen Drucke noch nicht. Ins-
gesamt sind bisher von jedem Blatt 10 bis 12 Exemplare nachweisbar, die alle aus englischem Besitz stammen.
- L'Artiste 2« Serie, t. VIII, 2e livraison, p. 307, nach Henri Lapauze, Ingres, sa vie et son oeuvre. Paris 1911, p. 172 ff.: >Lord Nock (!), le
premier Anglais qui posa, fut si bien ä son gre et au gre de ses compatriotes, qu'il amena ä M. Ingres toute l'emigration anglaise«. Von Lithographien
spricht der Bericht nicht!
3 Über die dargestellten Persönlichkeiten unterrichten die betreffenden ausführlichen Artikel im Dictionary of National Biography. London.
1 Joseph and Elizabeth Pennel, Lithography and Lithographers, some chapters in the history of the art with technical remarks and suggestions.
London 1898.
!> Delteil, I.c Peintre-Graveur, Einleitung und Manuel de l'amateur, I., p. 64 65. Auch Lapauze a. a. 0., p. 174, ist diese scheinbare Präzedenz
der Ingres-Lithographien aufgefallen, doch schloß auch er sich der Meinung Delteils an, ohne die Blätter genauer zu überprüfen.
6 Für das folgende vgl. Walter Gräff, op. cit., Heinrich Schwarz, Unbekannte französische und italienische Lithographie-Inkunabeln in
Wiener Sammlungen in den Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1921, Heft 2/3, und Leandro Ozzola, La Litografla Italiana
dal 1805 al 1870. Roma, 1923, p. 6, Anmerkung 1, und Katalog Nr. 70-74. Ozzolas Behandlung des Ingres-Themas ist leider ausschließlich
kompiiatorisch. ohne gerade zu diesem künstlerisch interessantesten Problem der italienischen Frühlithographie neues Material zu erbringen
oder kritisch Stellung zu nehmen.
" Vergleiche Luitpold Dussler, Die Incunabeln der deutschen Lithographie (1796-1821). Berlin, 1925, S. 97 und S. 27, wo allerdings irrtüm-
lich die Lithographie Kochs nochmals als Arbeit Andreas Dall'Armis unter Nr. 2 verzeichnet ist.
— 75 —
Argumente gegen seine Meinung aufmerksam geworden zu sein. Und doch muß eine gründliche Untersuchung dieser
vier Lithographien und ihrer örtlichen und zeitlichen Entstehung den Nachweis erbringen, daß sie ebenso wie ein fünftes
Blatt — die Replik des Bildnisses von Frederic Sylvester Douglas (D. 6), dessen Authentizität allerdings schon manchem
Ingres-Forscher zweifelhaft erschien — keine Originallithographien, sondern Reproduktionslithographien nach ver-
schollenen Originalzeichnungen Ingres' sind, die erst viele Jahre nach Entstehung der Zeichnungen in London litho-
graphisch kopiert und vervielfältigt wurden.
Ingres weilte von 1806 bis 1820 in Rom. Eine vom Künstler selbst inspirierte Biographie2 berichtet, daß Lord
Frederic North Earl of Guildford das erste Mitglied der englischen Kolonie in Rom war, das sich von Ingres porträtieren
ließ, und daß dieser die ganze englische Kolonie zu Ingres hinzog. Zunächst ließ Lord North seine Angehörigen von
Ingres zeichnen: seine Schwester Katherine Anne (North) Lady Glenbervie, ihren Gatten Sylvester (Douglas) Lord
Glenbervie und deren Sohn Frederic Sylvester Douglas,3 die auf den vier Lithographien (D. 3, 2, 5, 4) dargestellt sind.
Jedes dieser Blätter trägt die Bezeichnung »Ingres Rome 1815«, aber zugleich die Adresse der erst 1818 in London
gegründeten lithographischen Anstalt von Charles Joseph Hullmandel.4 Drucke ohne diese Adresse, die also tatsächlich
181 5 in Rom entstanden, die aber auch als Drucke vor der Schrift aus der Hullmandelschen Druckerei hervor-
gegangen sein könnten, sind bisher nicht bekannt geworden. Aus der Beschriftung des Bildnisses von Frederic
Sylvester Douglas (D. 5), die das Todesdatum des Dargestellten »Mort. 21. Oct. 1819« angibt, und aus dem Fehlen des
Todesdatums bei dem Bildnis des 1823 verstorbenen Lord Glenbervie (D. 2) ergibt sich die Möglichkeit, die zeitliche
Entstehung der Lithographien zu begrenzen, die daher erst zwischen den Jahren 1819 und 1823 — also um 1821 —
die Hullmandelsche Anstalt verlassen haben können. Delteil hat ebensowenig wie Lapauze diese merkwürdige Dis-
krepanz zwischen der Datierung der Porträte (1815), dem Gründungsjahr der Druckerei Hullmandel (1818) und dem
Todesdatum des Frederic Sylvester Douglas (1819) beachtet und sich kritiklos auf die Signatur verlassen, um das
Geburtsjahr der französischen Künstlerlithographie von 1816 auf 1815 verschieben zu können.5
Die einzige Erklärung für die zeitliche Distanz zwischen Entstehung und Druck der vier Lithographien ließe sich
so konstruieren, daß Ingres die Bildnisse zwar in Rom lithographiert, aber nicht gedruckt hätte, und daß der Stein von
einem der vier Dargestellten nach England gebracht worden sei, um erst hier, allerdings frühestens vier Jahre nach seiner
Entstehung, gedruckt zu werden. Aber auch gegen diese Hypothese sprechen gewichtige Gründe: Zunächst ergeben
die unzerschnittenen Drucke mit Sicherheit, daß alle vier Bildnisse in symmetrisch gegenübergestellter Anordnung auf
einem großen Stein (zirka 55 : 41) gezeichnet wurden, der durch die jahrelange Aufbewahrung und den weiten Trans-
port von Rom nach London nicht nur arg gelitten hätte, sondern wahrscheinlich sogar zugrunde gegangen wäre.
Aber noch unhaltbarer wird die Bestimmung der Lithographien als römische Originalarbeiten Ingres' durch
die Betrachtung der Einführung und Entwicklung der Lithographie in Italien, namentlich in Rom." Das neue Verfahren
der Lithographie wurde 1805 von den jungen Münchener Künstlern Andreas und Johann DaH'Armi und Raphael
Wintter in Rom eingeführt, konnte sich aber lange Zeit hindurch nur mühsam durchsetzen. Zwei Versuche von
Andreas Dall'Armi und Joseph Anton Koch,7 beide aus dem Jahre 1805, sind als die einzigen damals entstandenen
Versuche der ersten römischen Anstalt bekannt. Um die Mitte des zweiten Jahrzehnts war die Lithographie in Rom
wieder vollständig in Vergessenheit geraten. Die Brüder Dall'Armi und Raphael Wintter waren in ihre Heimat zurück-
gekehrt, und auch Joseph Anton Koch hatte weder in Italien noch während seines dreijährigen Aufenthaltes in Wien
die Versuche wieder aufgenommen. »M. Miliin, qui en 1812 et 1813 etait ä Rome et y a vu beaucoup d'artistes et de
savans, n'a point entendu parier de Lithographie et n'y a vu aucun essai«, schrieb Gabriel Peignot in seinem »Essai
1 Loys Delteil, .Manuel de l'amateur d'estampes des XIXe et XX« siecles (1801 — 1924). Paris 1925. I, p. 66. Delteil verzeichnet hier alle ihm
bekannten Exemplare der vier Lithographien, kennt aber die inzwischen in öffentlichen Besitz gelangten unzerschnittenen Drucke noch nicht. Ins-
gesamt sind bisher von jedem Blatt 10 bis 12 Exemplare nachweisbar, die alle aus englischem Besitz stammen.
- L'Artiste 2« Serie, t. VIII, 2e livraison, p. 307, nach Henri Lapauze, Ingres, sa vie et son oeuvre. Paris 1911, p. 172 ff.: >Lord Nock (!), le
premier Anglais qui posa, fut si bien ä son gre et au gre de ses compatriotes, qu'il amena ä M. Ingres toute l'emigration anglaise«. Von Lithographien
spricht der Bericht nicht!
3 Über die dargestellten Persönlichkeiten unterrichten die betreffenden ausführlichen Artikel im Dictionary of National Biography. London.
1 Joseph and Elizabeth Pennel, Lithography and Lithographers, some chapters in the history of the art with technical remarks and suggestions.
London 1898.
!> Delteil, I.c Peintre-Graveur, Einleitung und Manuel de l'amateur, I., p. 64 65. Auch Lapauze a. a. 0., p. 174, ist diese scheinbare Präzedenz
der Ingres-Lithographien aufgefallen, doch schloß auch er sich der Meinung Delteils an, ohne die Blätter genauer zu überprüfen.
6 Für das folgende vgl. Walter Gräff, op. cit., Heinrich Schwarz, Unbekannte französische und italienische Lithographie-Inkunabeln in
Wiener Sammlungen in den Mitteilungen der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst 1921, Heft 2/3, und Leandro Ozzola, La Litografla Italiana
dal 1805 al 1870. Roma, 1923, p. 6, Anmerkung 1, und Katalog Nr. 70-74. Ozzolas Behandlung des Ingres-Themas ist leider ausschließlich
kompiiatorisch. ohne gerade zu diesem künstlerisch interessantesten Problem der italienischen Frühlithographie neues Material zu erbringen
oder kritisch Stellung zu nehmen.
" Vergleiche Luitpold Dussler, Die Incunabeln der deutschen Lithographie (1796-1821). Berlin, 1925, S. 97 und S. 27, wo allerdings irrtüm-
lich die Lithographie Kochs nochmals als Arbeit Andreas Dall'Armis unter Nr. 2 verzeichnet ist.
— 75 —