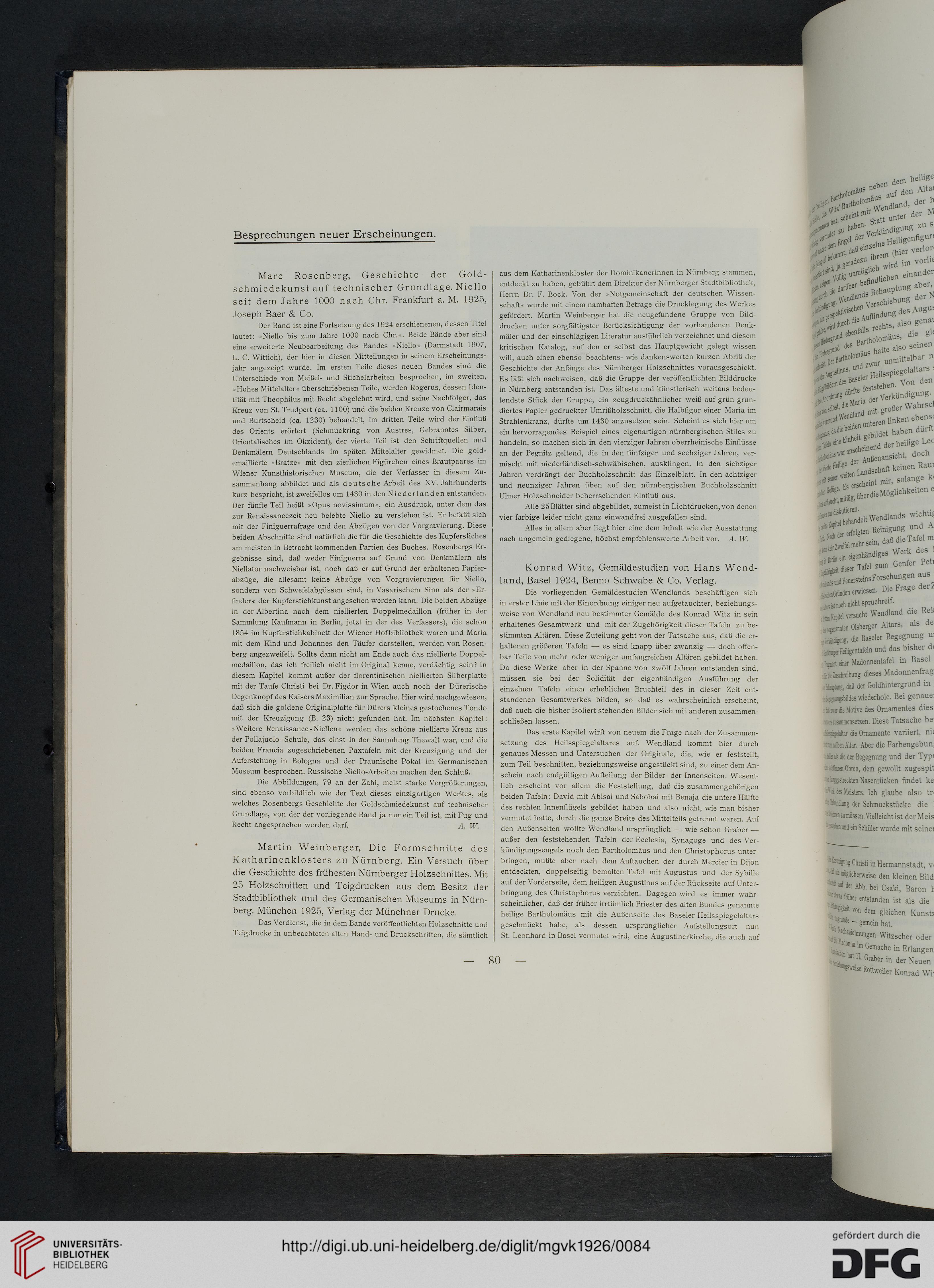Besprechungen neuer Erscheinungen.
Marc Rosenberg, Geschichte der Gold-
schmiedekunst auf technischer Grundlage. Niello
seit dem Jahre 1000 nach Chr. Frankfurt a. M. 1925,
Joseph Baer & Co.
Der Band ist eine Fortsetzung des 1924 erschienenen, dessen Titel
lautet: »Niello bis zum Jahre 1000 nach Chr.". Beide Bände aber sind
eine erweiterte Neubearbeitung des Bandes »Niello« (Darmstadt 1907,
L. C. Wittich), der hier in diesen Mitteilungen in seinem Erscheinungs-
jahr angezeigt wurde. Im ersten Teile dieses neuen Bandes sind die
Unterschiede von Meißel- und Stichelarbeiten besprochen, im zweiten,
»Hohes Mittelalter« überschriebenen Teile, werden Rogerus, dessen Iden-
tität mit Theophilus mit Recht abgelehnt wird, und seine Nachfolger, das
Kreuz von St. Trudpert (ca. 1100) und die beiden Kreuze von Ciairmarais
und Burtscheid (ca. 1230) behandelt, im dritten Teile wird der Einfluß
des Orients erörtert (Schmuckring von Austres, Gebranntes Silber,
Orientalisches im Okzident), der vierte Teil ist den Schriftquellen und
Denkmälern Deutschlands im späten Mittelalter gewidmet. Die gold-
emaillierte »Bratze« mit den zierlichen Figürchen eines Brautpaares im
Wiener Kunsthistorischen Museum, die der Verfasser in diesem Zu-
sammenhang abbildet und als deutsche Arbeit des XV. Jahrhunderts
kurz bespricht, ist zweifellos um 1430 in den Niederlanden entstanden.
Der fünfte Teil heißt »Opus novissimum«, ein Ausdruck, unter dem das
zur Renaissancezeit neu belebte Niello zu verstehen ist. Er befaßt sich
mit der Finiguerrafrage und den Abzügen von der Vorgravierung. Diese
beiden Abschnitte sind natürlich die für die Geschichte des Kupferstiches
am meisten in Betracht kommenden Partien des Buches. Rosenbergs Er-
gebnisse sind, daß weder Finiguerra auf Grund von Denkmälern als
Niellator nachweisbar ist, noch daß er auf Grund der erhaltenen Papier-
abzüge, die allesamt keine Abzüge von Vorgravierungen für Niello,
sondern von Schwefelabgüssen sind, in Vasarischem Sinn als der »Er-
finder« der Kupferstichkunst angesehen werden kann. Die beiden Abzüge
in der Albertina nach dem nieliierten Doppelmedaillon (früher in der
Sammlung Kaufmann in Berlin, jetzt in der des Verfassers), die schon
1854 im Kupferstichkabinett der Wiener Hofbibliothek waren und Maria
mit dem Kind und Johannes den Täufer darstellen, werden von Rosen-
berg angezweifelt. Sollte dann nicht am Ende auch das niellierte Doppel-
medaillon, das ich freilich nicht im Original kenne, verdächtig sein? In
diesem Kapitel kommt außer der florentinischen niellierten Silberplatte
mit der Taufe Christi bei Dr. Figdor in Wien auch noch der Dürerische
Degenknopf des Kaisers Maximilian zur Sprache. Hier wird nachgewiesen,
daß sich die goldene Originalplatte für Dürers kleines gestochenes Tondo
mit der Kreuzigung (B. 23) nicht gefunden hat. Im nächsten Kapitel:
»Weitere Renaissance-Niellen« werden das schöne niellierte Kreuz aus
der Pollajuolo-Schule, das einst in der Sammlung Thewalt war, und die
beiden Francia zugeschriebenen Paxtafeln mit der Kreuzigung und der
Auferstehung in Bologna und der Praunische Pokal im Germanischen
Museum besprochen. Russische Niello-Arbeiten machen den Schluß.
Die Abbildungen, 79 an der Zahl, meist starke Vergrößerungen,
sind ebenso vorbildlich wie der Text dieses einzigartigen Werkes, als
welches Rosenbergs Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer
Grundlage, von der der vorliegende Band ja nur ein Teil ist, mit Fug und
Recht angesprochen werden darf. A. W.
Martin Weinberger, Die Formschnitte des
Katharinenklosters zu Nürnberg. Ein Versuch über
die Geschichte des frühesten Nürnberger Holzschnittes. Mit
25 Holzschnitten und Teigdrucken aus dem Besitz der
Stadtbibliothek und des Germanischen Museums in Nürn-
berg. München 1925, Verlag der Münchner Drucke.
Das Verdienst, die in dem Bande veröffentlichten Holzschnitte und
Teigdrucke in unbeachteten alten Hand- und Druckschriften, die sämtlich
aus dem Katharinenkloster der Dominikanerinnen in Nürnberg stammen,
entdeckt zu haben, gebührt dem Direktor der Nürnberger Stadtbibliothek,
Herrn Dr. F. Bock. Von der »Notgemeinschaft der deutschen Wissen-
schaft« wurde mit einem namhaften Betrage die Drucklegung des Werkes
gefördert. Martin Weinberger hat die neugefundene Gruppe von Bild-
drucken unter sorgfältigster Berücksichtigung der vorhandenen Denk-
mäler und der einschlägigen Literatur ausführlich verzeichnet und diesem
kritischen Katalog, auf den er selbst das Hauptgewicht gelegt wissen
will, auch einen ebenso beachtens- wie dankenswerten kurzen Abriß der
Geschichte der Anfänge des Nürnberger Holzschnittes vorausgeschickt.
Es läßt sich nachweisen, daß die Gruppe der veröffentlichten Bilddrucke
in Nürnberg entstanden ist. Das älteste und künstlerisch weitaus bedeu-
tendste Stück der Gruppe, ein zeugdruckähnlkher weiß auf grün grun-
diertes Papier gedruckter Umrißholzschnitt, die Halbfigur einer Maria im
Strahlenkranz, dürfte um 1430 anzusetzen sein. Scheint es sich hier um
ein hervorragendes Beispiel eines eigenartigen nürnbergischen Stiles zu
handeln, so machen sich in den vierziger Jahren oberrheinische Einflüsse
an der Pegnitz geltend, die in den fünfziger und sechziger Jahren, ver-
mischt mit niederländisch-schwäbischen, ausklingen. In den siebziger
Jahren verdrängt der Buchholzschnitt das Einzelblatt. In den achtziger
und neunziger Jahren üben auf den nürnbergischen Buchholzschnitt
Ulmer Holzschneider beherrschenden Einiluß aus.
Alle 25 Blätter sind abgebildet, zumeist in Lichtdrucken, von denen
vier farbige leider nicht ganz einwandfrei ausgefallen sind.
Alles in allem aber liegt hier eine dem Inhalt wie der Ausstattung
nach ungemein gediegene, höchst empfehlenswerte Arbeit vor. A. W.
Konrad Witz, Gemäldestudien von Hans Wend-
land, Basel 1924, Benno Schwabe & Co. Verlag.
Die vorliegenden Gemäldestudien Wendlands beschäftigen sich
in erster Linie mit der Einordnung einiger neu aufgetauchter, beziehungs-
weise von Wendland neu bestimmter Gemälde des Konrad Witz in sein
erhaltenes Gesamtwerk und mit der Zugehörigkeit dieser Tafeln zu be-
stimmten Altären. Diese Zuteilung geht von der Tatsache aus, daß die er-
haltenen größeren Tafeln — es sind knapp über zwanzig — doch offen-
bar Teile von mehr oder weniger umfangreichen Altären gebildet haben.
Da diese Werke aber in der Spanne von zwölf Jahren entstanden sind,
müssen sie bei der Solidität der eigenhändigen Ausführung der
einzelnen Tafeln einen erheblichen Bruchteil des in dieser Zeit ent-
standenen Gesamtwerkes bilden, so daß es wahrscheinlich erscheint,
daß auch die bisher isoliert stehenden Bilder sich mit anderen zusammen-
schließen lassen.
Das erste Kapitel wirft von neuem die Frage nach der Zusammen-
setzung des Heilsspiegelaltares auf. Wendland kommt hier durch
genaues Messen und Untersuchen der Originale, die, wie er feststellt,
zum Teil beschnitten, beziehungsweise angestückt sind, zu einer dem An-
schein nach endgültigen Aufteilung der Bilder der Innenseiten. Wesent-
lich erscheint vor allem die Feststellung, daß die zusammengehörigen
beiden Tafeln: David mit Abisai und Sabobai mit Benaja die untere Hälfte
des rechten Innenflügels gebildet haben und also nicht, wie man bisher
vermutet hatte, durch die ganze Breite des Mittelteils getrennt waren. Auf
den Außenseiten wollte Wendland ursprünglich — wie schon Graber —
außer den feststehenden Tafeln der Ecclesia, Synagoge und des Ver-
kündigungsengels noch den Bartholomäus und den Christophorus unter-
bringen, mußte aber nach dem Auftauchen der durch Mercier in Dijon
entdeckten, doppelseitig bemalten Tafel mit Augustus und der Sybille
auf der Vorderseite, dem heiligen Augustinus auf der Rückseite auf Unter-
bringung des Christophorus verzichten. Dagegen wird es immer wahr-
scheinlicher, daß der früher irrtümlich Priester des alten Bundes genannte
heilige Bartholomäus mit die Außenseite des Baseler Heilsspiegelaltars
geschmückt habe, als dessen ursprünglicher Aufstellungsort nun
St. Leonhard in Basel vermutet wird, eine Augustinerkirche, die auch auf
Marc Rosenberg, Geschichte der Gold-
schmiedekunst auf technischer Grundlage. Niello
seit dem Jahre 1000 nach Chr. Frankfurt a. M. 1925,
Joseph Baer & Co.
Der Band ist eine Fortsetzung des 1924 erschienenen, dessen Titel
lautet: »Niello bis zum Jahre 1000 nach Chr.". Beide Bände aber sind
eine erweiterte Neubearbeitung des Bandes »Niello« (Darmstadt 1907,
L. C. Wittich), der hier in diesen Mitteilungen in seinem Erscheinungs-
jahr angezeigt wurde. Im ersten Teile dieses neuen Bandes sind die
Unterschiede von Meißel- und Stichelarbeiten besprochen, im zweiten,
»Hohes Mittelalter« überschriebenen Teile, werden Rogerus, dessen Iden-
tität mit Theophilus mit Recht abgelehnt wird, und seine Nachfolger, das
Kreuz von St. Trudpert (ca. 1100) und die beiden Kreuze von Ciairmarais
und Burtscheid (ca. 1230) behandelt, im dritten Teile wird der Einfluß
des Orients erörtert (Schmuckring von Austres, Gebranntes Silber,
Orientalisches im Okzident), der vierte Teil ist den Schriftquellen und
Denkmälern Deutschlands im späten Mittelalter gewidmet. Die gold-
emaillierte »Bratze« mit den zierlichen Figürchen eines Brautpaares im
Wiener Kunsthistorischen Museum, die der Verfasser in diesem Zu-
sammenhang abbildet und als deutsche Arbeit des XV. Jahrhunderts
kurz bespricht, ist zweifellos um 1430 in den Niederlanden entstanden.
Der fünfte Teil heißt »Opus novissimum«, ein Ausdruck, unter dem das
zur Renaissancezeit neu belebte Niello zu verstehen ist. Er befaßt sich
mit der Finiguerrafrage und den Abzügen von der Vorgravierung. Diese
beiden Abschnitte sind natürlich die für die Geschichte des Kupferstiches
am meisten in Betracht kommenden Partien des Buches. Rosenbergs Er-
gebnisse sind, daß weder Finiguerra auf Grund von Denkmälern als
Niellator nachweisbar ist, noch daß er auf Grund der erhaltenen Papier-
abzüge, die allesamt keine Abzüge von Vorgravierungen für Niello,
sondern von Schwefelabgüssen sind, in Vasarischem Sinn als der »Er-
finder« der Kupferstichkunst angesehen werden kann. Die beiden Abzüge
in der Albertina nach dem nieliierten Doppelmedaillon (früher in der
Sammlung Kaufmann in Berlin, jetzt in der des Verfassers), die schon
1854 im Kupferstichkabinett der Wiener Hofbibliothek waren und Maria
mit dem Kind und Johannes den Täufer darstellen, werden von Rosen-
berg angezweifelt. Sollte dann nicht am Ende auch das niellierte Doppel-
medaillon, das ich freilich nicht im Original kenne, verdächtig sein? In
diesem Kapitel kommt außer der florentinischen niellierten Silberplatte
mit der Taufe Christi bei Dr. Figdor in Wien auch noch der Dürerische
Degenknopf des Kaisers Maximilian zur Sprache. Hier wird nachgewiesen,
daß sich die goldene Originalplatte für Dürers kleines gestochenes Tondo
mit der Kreuzigung (B. 23) nicht gefunden hat. Im nächsten Kapitel:
»Weitere Renaissance-Niellen« werden das schöne niellierte Kreuz aus
der Pollajuolo-Schule, das einst in der Sammlung Thewalt war, und die
beiden Francia zugeschriebenen Paxtafeln mit der Kreuzigung und der
Auferstehung in Bologna und der Praunische Pokal im Germanischen
Museum besprochen. Russische Niello-Arbeiten machen den Schluß.
Die Abbildungen, 79 an der Zahl, meist starke Vergrößerungen,
sind ebenso vorbildlich wie der Text dieses einzigartigen Werkes, als
welches Rosenbergs Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer
Grundlage, von der der vorliegende Band ja nur ein Teil ist, mit Fug und
Recht angesprochen werden darf. A. W.
Martin Weinberger, Die Formschnitte des
Katharinenklosters zu Nürnberg. Ein Versuch über
die Geschichte des frühesten Nürnberger Holzschnittes. Mit
25 Holzschnitten und Teigdrucken aus dem Besitz der
Stadtbibliothek und des Germanischen Museums in Nürn-
berg. München 1925, Verlag der Münchner Drucke.
Das Verdienst, die in dem Bande veröffentlichten Holzschnitte und
Teigdrucke in unbeachteten alten Hand- und Druckschriften, die sämtlich
aus dem Katharinenkloster der Dominikanerinnen in Nürnberg stammen,
entdeckt zu haben, gebührt dem Direktor der Nürnberger Stadtbibliothek,
Herrn Dr. F. Bock. Von der »Notgemeinschaft der deutschen Wissen-
schaft« wurde mit einem namhaften Betrage die Drucklegung des Werkes
gefördert. Martin Weinberger hat die neugefundene Gruppe von Bild-
drucken unter sorgfältigster Berücksichtigung der vorhandenen Denk-
mäler und der einschlägigen Literatur ausführlich verzeichnet und diesem
kritischen Katalog, auf den er selbst das Hauptgewicht gelegt wissen
will, auch einen ebenso beachtens- wie dankenswerten kurzen Abriß der
Geschichte der Anfänge des Nürnberger Holzschnittes vorausgeschickt.
Es läßt sich nachweisen, daß die Gruppe der veröffentlichten Bilddrucke
in Nürnberg entstanden ist. Das älteste und künstlerisch weitaus bedeu-
tendste Stück der Gruppe, ein zeugdruckähnlkher weiß auf grün grun-
diertes Papier gedruckter Umrißholzschnitt, die Halbfigur einer Maria im
Strahlenkranz, dürfte um 1430 anzusetzen sein. Scheint es sich hier um
ein hervorragendes Beispiel eines eigenartigen nürnbergischen Stiles zu
handeln, so machen sich in den vierziger Jahren oberrheinische Einflüsse
an der Pegnitz geltend, die in den fünfziger und sechziger Jahren, ver-
mischt mit niederländisch-schwäbischen, ausklingen. In den siebziger
Jahren verdrängt der Buchholzschnitt das Einzelblatt. In den achtziger
und neunziger Jahren üben auf den nürnbergischen Buchholzschnitt
Ulmer Holzschneider beherrschenden Einiluß aus.
Alle 25 Blätter sind abgebildet, zumeist in Lichtdrucken, von denen
vier farbige leider nicht ganz einwandfrei ausgefallen sind.
Alles in allem aber liegt hier eine dem Inhalt wie der Ausstattung
nach ungemein gediegene, höchst empfehlenswerte Arbeit vor. A. W.
Konrad Witz, Gemäldestudien von Hans Wend-
land, Basel 1924, Benno Schwabe & Co. Verlag.
Die vorliegenden Gemäldestudien Wendlands beschäftigen sich
in erster Linie mit der Einordnung einiger neu aufgetauchter, beziehungs-
weise von Wendland neu bestimmter Gemälde des Konrad Witz in sein
erhaltenes Gesamtwerk und mit der Zugehörigkeit dieser Tafeln zu be-
stimmten Altären. Diese Zuteilung geht von der Tatsache aus, daß die er-
haltenen größeren Tafeln — es sind knapp über zwanzig — doch offen-
bar Teile von mehr oder weniger umfangreichen Altären gebildet haben.
Da diese Werke aber in der Spanne von zwölf Jahren entstanden sind,
müssen sie bei der Solidität der eigenhändigen Ausführung der
einzelnen Tafeln einen erheblichen Bruchteil des in dieser Zeit ent-
standenen Gesamtwerkes bilden, so daß es wahrscheinlich erscheint,
daß auch die bisher isoliert stehenden Bilder sich mit anderen zusammen-
schließen lassen.
Das erste Kapitel wirft von neuem die Frage nach der Zusammen-
setzung des Heilsspiegelaltares auf. Wendland kommt hier durch
genaues Messen und Untersuchen der Originale, die, wie er feststellt,
zum Teil beschnitten, beziehungsweise angestückt sind, zu einer dem An-
schein nach endgültigen Aufteilung der Bilder der Innenseiten. Wesent-
lich erscheint vor allem die Feststellung, daß die zusammengehörigen
beiden Tafeln: David mit Abisai und Sabobai mit Benaja die untere Hälfte
des rechten Innenflügels gebildet haben und also nicht, wie man bisher
vermutet hatte, durch die ganze Breite des Mittelteils getrennt waren. Auf
den Außenseiten wollte Wendland ursprünglich — wie schon Graber —
außer den feststehenden Tafeln der Ecclesia, Synagoge und des Ver-
kündigungsengels noch den Bartholomäus und den Christophorus unter-
bringen, mußte aber nach dem Auftauchen der durch Mercier in Dijon
entdeckten, doppelseitig bemalten Tafel mit Augustus und der Sybille
auf der Vorderseite, dem heiligen Augustinus auf der Rückseite auf Unter-
bringung des Christophorus verzichten. Dagegen wird es immer wahr-
scheinlicher, daß der früher irrtümlich Priester des alten Bundes genannte
heilige Bartholomäus mit die Außenseite des Baseler Heilsspiegelaltars
geschmückt habe, als dessen ursprünglicher Aufstellungsort nun
St. Leonhard in Basel vermutet wird, eine Augustinerkirche, die auch auf