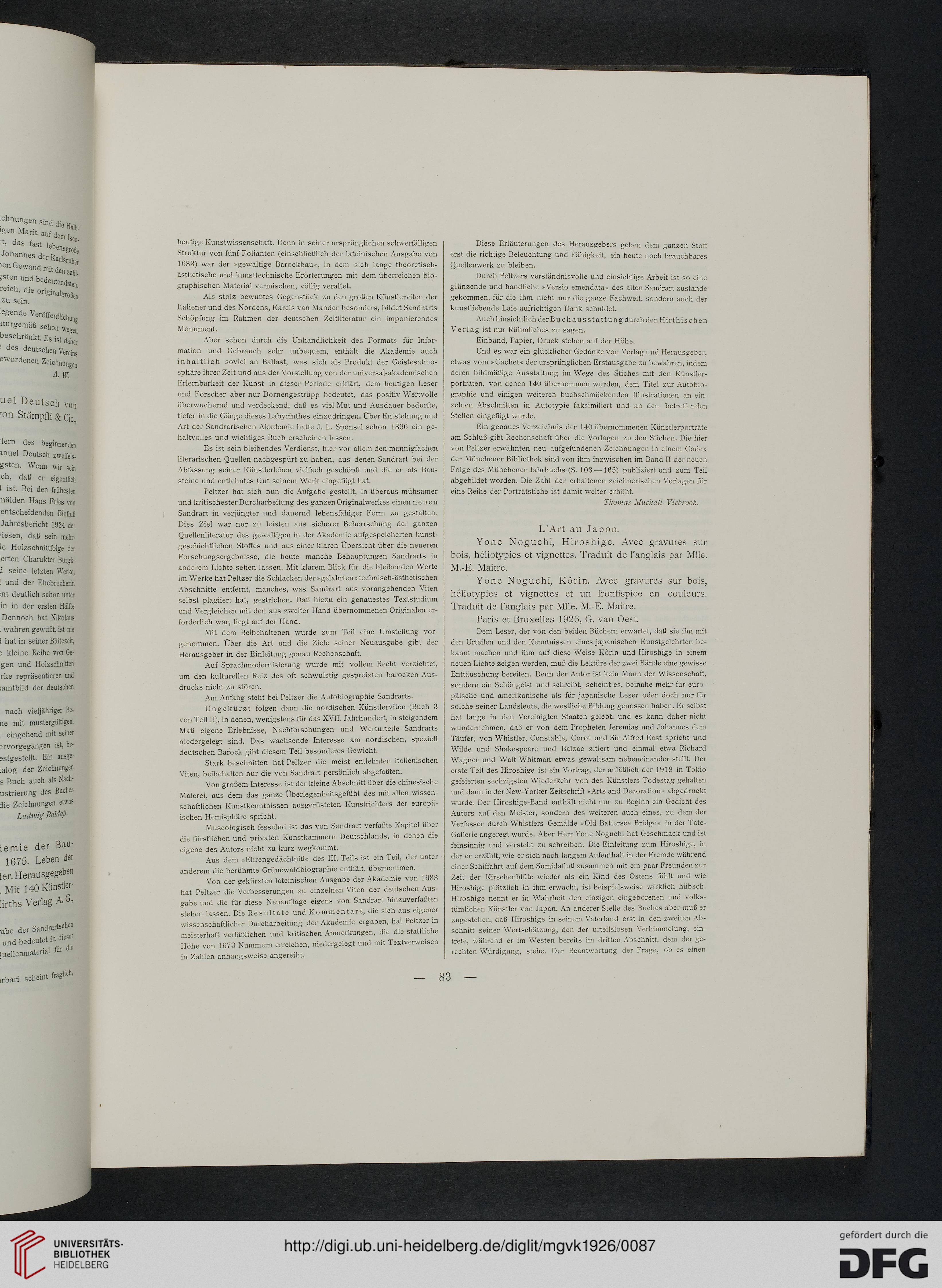;ch«»ngen sind die h,,
J;"-nesderKarI^
?St™ bedeutend^
--"'dieorigin^
zu sein.
«Sende Veröffentlichung
•'"■•gemäß schon 8
beschränkt. Es ist(,aher
! des deutschen Vereins
ewordenen Zeichnungen
A. W.
uel Deutsch von
'on Stämpfli & Cie.,
üern des beginnenden
inuel Deutsch Zweifels-
gsten. Wenn wir sein
ch, daß er eigentlich
t ist. Bei den frühesten
Bälden Hans Fries von
entscheidenden Einfluß
Jahresbericht 1924 der
•iesen, daß sein mehr-
ie Holzschnittfolge der
erten Charakter Burgk-
i seine letzten Werke,
und der Ehebrecherin
:nt deutlich schon unter
in in der ersten Hälfte
Dennoch hat Nikolaus
i wahren gewußt, ist nie
1 hat in seiner Blütezeit,
: kleine Reihe von Ge-
gen und Holzschnitten
rke repräsentieren und
;amtbild der deutschen
nach vieljähriger Be-
ne mit mustergültigem
eingehend mit seiner
srvorgegangen ist, be-
estgestellt. Ein ausge-
;alog der Zeichnungen
s Buch auch als Nacb-
ustrierung des Buches
die Zeichnungen etwas
Ludwig Bädaß-
lemie der Bau-
1675. Leben der
ter. Herausgegeben
, Mit 140Künstler-
[irths Verlag A.G,
abe der Sandrartscbe«
und bedeutet ind.es*
iuellenmaterial f& <"'e
heutige Kunstwissenschaft. Denn in seiner ursprünglichen schwerfalligen
Struktur von fünf Folianten (einschließlich der lateinischen Ausgabe von
1683) war der »gewaltige Barockbau«, in dem sich lange theoretisch-
ästhetische und kunsttechnische Erörterungen mit dem überreichen bio-
graphischen Material vermischen, völlig veraltet.
Als stolz bewußtes Gegenstück zu den großen Künstlerviten der
Italiener und des Nordens, Kareis van Mander besonders, bildet Sandrarts
Schöpfung im Rahmen der deutschen Zeitliteratur ein imponierendes
Monument.
Aber schon durch die Unhandlichkeit des Formats für Infor-
mation und Gebrauch sehr unbequem, enthält die Akademie auch
inhaltlich soviel an Ballast, was sich als Produkt der Geistesatmo-
sphäre ihrer Zeit und aus der Vorstellung von der universal-akademischen
Erlernbarkeit der Kunst in dieser Periode erklärt, dem heutigen Leser
und Forscher aber nur Domengestrüpp bedeutet, das positiv Wertvolle
überwuchernd und verdeckend, daß es viel Mut und Ausdauer bedurfte,
tiefer in die Gänge dieses Labyrinthes einzudringen. Über Entstehung und
Art der Sandrartschen Akademie hatte J. L. Sponsel schon 1896 ein ge-
haltvolles und wichtiges Buch erscheinen lassen.
Es ist sein bleibendes Verdienst, hier vor allem den mannigfachen
literarischen Quellen nachgespürt zu haben, aus denen Sandrart bei der
Abfassung seiner Künstlerleben vielfach geschöpft und die er als Bau-
steine und entlehntes Gut seinem Werk eingefügt hat.
Peltzer hat sich nun die Aufgabe gestellt, in überaus mühsamer
und kritischester Durcharbeitung des ganzen Originalwerkes einen neuen
Sandrart in verjüngter und dauernd lebensfähiger Form zu gestalten.
Dies Ziel war nur zu leisten aus sicherer Beherrschung der ganzen
Quellenliteratur des gewaltigen in der Akademie aufgespeicherten kunst-
geschichtlichen Stoffes und aus einer klaren Übersicht über die neueren
Forschungsergebnisse, die heute manche Behauptungen Sandrarts in
anderem Lichte sehen lassen. Mit klarem Blick für die bleibenden Werte
im Werke hat Peltzer die Schlacken der > gelahrten« technisch-ästhetischen
Abschnitte entfernt, manches, was Sandrart aus vorangehenden Viten
selbst plagiiert hat, gestrichen. Daß hiezu ein genauestes Textstudium
und Vergleichen mit den aus zweiter Hand übernommenen Originalen er-
forderlich war, liegt auf der Hand.
Mit dem Beibehaltenen wurde zum Teil eine Umstellung vor-
genommen. Über die Art und die Ziele seiner Neuausgabe gibt der
Herausgeber in der Einleitung genau Rechenschaft.
Auf Sprachmodernisierung wurde mit vollem Recht verzichtet,
um den kulturellen Reiz des oft schwulstig gespreizten barocken Aus-
drucks nicht zu stören.
Am Anfang steht bei Peltzer die Autobiographie Sandrarts.
Ungekürzt folgen dann die nordischen Künstlerviten (Buch 3
von Teil II), in denen, wenigstens für das XVII. Jahrhundert, in steigendem
Maß eigene Erlebnisse, Nachforschungen und Werturteile Sandrarts
niedergelegt sind. Das wachsende Interesse am nordischen, speziell
deutschen Barock gibt diesem Teil besonderes Gewicht.
Stark beschnitten hat Peltzer die meist entlehnten italienischen
Viten, beibehalten nur die von Sandrart persönlich abgefaßten.
Von großem Interesse ist der kleine Abschnitt über die chinesische
Malerei, aus dem das ganze Überlegenheitsgefühl des mit allen wissen-
schaftlichen Kunstkenntnissen ausgerüsteten Kunstrichters der europä-
ischen Hemisphäre spricht.
Museologisch fesselnd ist das von Sandrart verfaßte Kapitel über
die fürstlichen und privaten Kunstkammern Deutschlands, in denen die
eigene des Autors nicht zu kurz wegkommt.
Aus dem »Ehrengedächtniß« des III. Teils ist ein Teil, der unter
anderem die berühmte Grünewaldbiographie enthält, übernommen.
Von der gekürzten lateinischen Ausgabe der Akademie von 1683
hat Peltzer die Verbesserungen zu einzelnen Viten der deutschen Aus-
gabe und die für diese Neuauflage eigens von Sandrart hinzuverfaßten
stehen lassen. Die Resultate und Kommentare, die sich aus eigener
wissenschaftlicher Durcharbeitung der Akademie ergaben, hat Peltzer in
meisterhaft verläßlichen und kritischen Anmerkungen, die die stattliche
Höhe von 1673 Nummern erreichen, niedergelegt und mit Textverweisen
in Zahlen anhangsweise angereiht.
Diese Erläuterungen des Herausgebers geben dem ganzen Stoff
erst die richtige Beleuchtung und Fähigkeit, ein heute noch brauchbares
Quellenwerk zu bleiben.
Durch Peltzers verständnisvolle und einsichtige Arbeit ist so eine
glänzende und handliche >Versio emendata« des alten Sandrart zustande
gekommen, für die ihm nicht nur die ganze Fachwelt, sondern auch der
kunstliebende Laie aufrichtigen Dank schuldet.
Auch hinsichtlich der Buch au ss tat tung durch den Hirthischen
Verlag ist nur Rühmliches zu sagen.
Einband, Papier, Druck stehen auf der Höhe.
Und es war ein glücklicher Gedanke von Verlag und Herausgeber,
etwas vom »Cachet« der ursprünglichen Erstausgabe zu bewahren, indem
deren bildmäßige Ausstattung im Wege des Stiches mit den Künstler-
porträten, von denen 140 übernommen wurden, dem Titel zur Autobio-
graphie und einigen weiteren buchschmückenden Illustrationen an ein-
zelnen Abschnitten in Autotypie faksimiliert und an den betreffenden
Stellen eingefügt wurde.
Ein genaues Verzeichnis der 140 übernommenen Künstlerporträte
am Schluß gibt Rechenschaft über die Vorlagen zu den Stichen. Die hier
von Peltzer erwähnten neu aufgefundenen Zeichnungen in einem Codex
der .Münchener Bibliothek sind von ihm inzwischen im Band II der neuen
Folge des Münchener Jahrbuchs (S. 103—165) publiziert und zum Teil
abgebildet worden. Die Zahl der erhaltenen zeichnerischen Vorlagen für
eine Reihe der Porträtstiche ist damit weiter erhöht,
Thomas Muchall- Viebrook.
L'Art au Japon.
Yone Noguchi, Hiroshige. Avec gravures Süt-
hens, heliotypies et vignettes. Traduit de l'anglais par MHe.
M.-E. Maitre.
Yone Noguchi, Körin. Avec gravures sur bois,
heliotypies et vignettes et un frontispice en couleurs.
Traduit de l'anglais par MUe. M.-E. Maitre.
Paris et Bruxelles 1926, G. van Oest.
Dem Leser, der von den beiden Büchern erwartet, daß sie ihn mit
den Urteilen und den Kenntnissen eines japanischen Kunstgelehrten be-
kannt machen und ihm auf diese Weise Korin und Hiroshige in einem
neuen Lichte zeigen werden, muß die Lektüre der zwei Bände eine gewisse
Enttäuschung bereiten. Denn der Autor ist kein Mann der Wissenschaft,
sondern ein Schöngeist und schreibt, scheint es, beinahe mehr für euro-
päische und amerikanische als für japanische Leser oder doch nur für
solche seiner Landsleute, die westliche Bildung genossen haben. Er selbst
hat lange in den Vereinigten Staaten gelebt, und es kann daher nicht
wundernehmen, daß er von dem Propheten Jeremias und Johannes dem
Täufer, von Whistler, Constable, Corot und Sir Alfred East spricht und
Wilde und Shakespeare und Balzac zitiert und einmal etwa Richard
Wagner und Walt Whitman etwas gewaltsam nebeneinander stellt. Der
erste Teil des Hiroshige ist ein Vortrag, der anläßlich der 1918 in Tokio
gefeierten sechzigsten Wiederkehr von des Künstlers Todestag gehalten
und dann in der New-Yorker Zeitschrift » Arts and Decoration« abgedruckt
wurde. Der Hiroshige-Band enthält nicht nur zu Beginn ein Gedicht des
Autors auf den Meister, sondern des weiteren auch eines, zu dem der
Verfasser durch Whistlers Gemälde »Old Battersea Bridge« in der Tate-
Gallcrie angeregt wurde. Aber Herr Yone Noguchi hat Geschmack und ist
feinsinnig und versteht zu schreiben. Die Einleitung zum Hiroshige, in
der er erzählt, wie er sich nach langem Aufenthalt in der Fremde während
einer Schiffahrt auf dem Sumidafluß zusammen mit ein paar Freunden zur
Zeit der Kirschenblüte wieder als ein Kind des Ostens fühlt und wie
Hiroshige plötzlich in ihm erwacht, ist beispielsweise wirklieh hübsch.
Hiroshige nennt er in Wahrheit den einzigen eingeborenen und volks-
tümlichen Künstler von Japan. An anderer Stelle des Buches aber muß er
zugestehen, daß Hiroshige in seinem Vaterland erst in den zweiten Ab-
schnitt seiner Wertschätzung, den der urteilslosen Verhimmelung, ein-
trete, während er im Westen bereits im dritten Abschnitt, dem der ge-
rechten Würdigung, stehe. Der Beantwortung der Frage, ob es einen
u-bari scheint frag
lieb,
— 83
J;"-nesderKarI^
?St™ bedeutend^
--"'dieorigin^
zu sein.
«Sende Veröffentlichung
•'"■•gemäß schon 8
beschränkt. Es ist(,aher
! des deutschen Vereins
ewordenen Zeichnungen
A. W.
uel Deutsch von
'on Stämpfli & Cie.,
üern des beginnenden
inuel Deutsch Zweifels-
gsten. Wenn wir sein
ch, daß er eigentlich
t ist. Bei den frühesten
Bälden Hans Fries von
entscheidenden Einfluß
Jahresbericht 1924 der
•iesen, daß sein mehr-
ie Holzschnittfolge der
erten Charakter Burgk-
i seine letzten Werke,
und der Ehebrecherin
:nt deutlich schon unter
in in der ersten Hälfte
Dennoch hat Nikolaus
i wahren gewußt, ist nie
1 hat in seiner Blütezeit,
: kleine Reihe von Ge-
gen und Holzschnitten
rke repräsentieren und
;amtbild der deutschen
nach vieljähriger Be-
ne mit mustergültigem
eingehend mit seiner
srvorgegangen ist, be-
estgestellt. Ein ausge-
;alog der Zeichnungen
s Buch auch als Nacb-
ustrierung des Buches
die Zeichnungen etwas
Ludwig Bädaß-
lemie der Bau-
1675. Leben der
ter. Herausgegeben
, Mit 140Künstler-
[irths Verlag A.G,
abe der Sandrartscbe«
und bedeutet ind.es*
iuellenmaterial f& <"'e
heutige Kunstwissenschaft. Denn in seiner ursprünglichen schwerfalligen
Struktur von fünf Folianten (einschließlich der lateinischen Ausgabe von
1683) war der »gewaltige Barockbau«, in dem sich lange theoretisch-
ästhetische und kunsttechnische Erörterungen mit dem überreichen bio-
graphischen Material vermischen, völlig veraltet.
Als stolz bewußtes Gegenstück zu den großen Künstlerviten der
Italiener und des Nordens, Kareis van Mander besonders, bildet Sandrarts
Schöpfung im Rahmen der deutschen Zeitliteratur ein imponierendes
Monument.
Aber schon durch die Unhandlichkeit des Formats für Infor-
mation und Gebrauch sehr unbequem, enthält die Akademie auch
inhaltlich soviel an Ballast, was sich als Produkt der Geistesatmo-
sphäre ihrer Zeit und aus der Vorstellung von der universal-akademischen
Erlernbarkeit der Kunst in dieser Periode erklärt, dem heutigen Leser
und Forscher aber nur Domengestrüpp bedeutet, das positiv Wertvolle
überwuchernd und verdeckend, daß es viel Mut und Ausdauer bedurfte,
tiefer in die Gänge dieses Labyrinthes einzudringen. Über Entstehung und
Art der Sandrartschen Akademie hatte J. L. Sponsel schon 1896 ein ge-
haltvolles und wichtiges Buch erscheinen lassen.
Es ist sein bleibendes Verdienst, hier vor allem den mannigfachen
literarischen Quellen nachgespürt zu haben, aus denen Sandrart bei der
Abfassung seiner Künstlerleben vielfach geschöpft und die er als Bau-
steine und entlehntes Gut seinem Werk eingefügt hat.
Peltzer hat sich nun die Aufgabe gestellt, in überaus mühsamer
und kritischester Durcharbeitung des ganzen Originalwerkes einen neuen
Sandrart in verjüngter und dauernd lebensfähiger Form zu gestalten.
Dies Ziel war nur zu leisten aus sicherer Beherrschung der ganzen
Quellenliteratur des gewaltigen in der Akademie aufgespeicherten kunst-
geschichtlichen Stoffes und aus einer klaren Übersicht über die neueren
Forschungsergebnisse, die heute manche Behauptungen Sandrarts in
anderem Lichte sehen lassen. Mit klarem Blick für die bleibenden Werte
im Werke hat Peltzer die Schlacken der > gelahrten« technisch-ästhetischen
Abschnitte entfernt, manches, was Sandrart aus vorangehenden Viten
selbst plagiiert hat, gestrichen. Daß hiezu ein genauestes Textstudium
und Vergleichen mit den aus zweiter Hand übernommenen Originalen er-
forderlich war, liegt auf der Hand.
Mit dem Beibehaltenen wurde zum Teil eine Umstellung vor-
genommen. Über die Art und die Ziele seiner Neuausgabe gibt der
Herausgeber in der Einleitung genau Rechenschaft.
Auf Sprachmodernisierung wurde mit vollem Recht verzichtet,
um den kulturellen Reiz des oft schwulstig gespreizten barocken Aus-
drucks nicht zu stören.
Am Anfang steht bei Peltzer die Autobiographie Sandrarts.
Ungekürzt folgen dann die nordischen Künstlerviten (Buch 3
von Teil II), in denen, wenigstens für das XVII. Jahrhundert, in steigendem
Maß eigene Erlebnisse, Nachforschungen und Werturteile Sandrarts
niedergelegt sind. Das wachsende Interesse am nordischen, speziell
deutschen Barock gibt diesem Teil besonderes Gewicht.
Stark beschnitten hat Peltzer die meist entlehnten italienischen
Viten, beibehalten nur die von Sandrart persönlich abgefaßten.
Von großem Interesse ist der kleine Abschnitt über die chinesische
Malerei, aus dem das ganze Überlegenheitsgefühl des mit allen wissen-
schaftlichen Kunstkenntnissen ausgerüsteten Kunstrichters der europä-
ischen Hemisphäre spricht.
Museologisch fesselnd ist das von Sandrart verfaßte Kapitel über
die fürstlichen und privaten Kunstkammern Deutschlands, in denen die
eigene des Autors nicht zu kurz wegkommt.
Aus dem »Ehrengedächtniß« des III. Teils ist ein Teil, der unter
anderem die berühmte Grünewaldbiographie enthält, übernommen.
Von der gekürzten lateinischen Ausgabe der Akademie von 1683
hat Peltzer die Verbesserungen zu einzelnen Viten der deutschen Aus-
gabe und die für diese Neuauflage eigens von Sandrart hinzuverfaßten
stehen lassen. Die Resultate und Kommentare, die sich aus eigener
wissenschaftlicher Durcharbeitung der Akademie ergaben, hat Peltzer in
meisterhaft verläßlichen und kritischen Anmerkungen, die die stattliche
Höhe von 1673 Nummern erreichen, niedergelegt und mit Textverweisen
in Zahlen anhangsweise angereiht.
Diese Erläuterungen des Herausgebers geben dem ganzen Stoff
erst die richtige Beleuchtung und Fähigkeit, ein heute noch brauchbares
Quellenwerk zu bleiben.
Durch Peltzers verständnisvolle und einsichtige Arbeit ist so eine
glänzende und handliche >Versio emendata« des alten Sandrart zustande
gekommen, für die ihm nicht nur die ganze Fachwelt, sondern auch der
kunstliebende Laie aufrichtigen Dank schuldet.
Auch hinsichtlich der Buch au ss tat tung durch den Hirthischen
Verlag ist nur Rühmliches zu sagen.
Einband, Papier, Druck stehen auf der Höhe.
Und es war ein glücklicher Gedanke von Verlag und Herausgeber,
etwas vom »Cachet« der ursprünglichen Erstausgabe zu bewahren, indem
deren bildmäßige Ausstattung im Wege des Stiches mit den Künstler-
porträten, von denen 140 übernommen wurden, dem Titel zur Autobio-
graphie und einigen weiteren buchschmückenden Illustrationen an ein-
zelnen Abschnitten in Autotypie faksimiliert und an den betreffenden
Stellen eingefügt wurde.
Ein genaues Verzeichnis der 140 übernommenen Künstlerporträte
am Schluß gibt Rechenschaft über die Vorlagen zu den Stichen. Die hier
von Peltzer erwähnten neu aufgefundenen Zeichnungen in einem Codex
der .Münchener Bibliothek sind von ihm inzwischen im Band II der neuen
Folge des Münchener Jahrbuchs (S. 103—165) publiziert und zum Teil
abgebildet worden. Die Zahl der erhaltenen zeichnerischen Vorlagen für
eine Reihe der Porträtstiche ist damit weiter erhöht,
Thomas Muchall- Viebrook.
L'Art au Japon.
Yone Noguchi, Hiroshige. Avec gravures Süt-
hens, heliotypies et vignettes. Traduit de l'anglais par MHe.
M.-E. Maitre.
Yone Noguchi, Körin. Avec gravures sur bois,
heliotypies et vignettes et un frontispice en couleurs.
Traduit de l'anglais par MUe. M.-E. Maitre.
Paris et Bruxelles 1926, G. van Oest.
Dem Leser, der von den beiden Büchern erwartet, daß sie ihn mit
den Urteilen und den Kenntnissen eines japanischen Kunstgelehrten be-
kannt machen und ihm auf diese Weise Korin und Hiroshige in einem
neuen Lichte zeigen werden, muß die Lektüre der zwei Bände eine gewisse
Enttäuschung bereiten. Denn der Autor ist kein Mann der Wissenschaft,
sondern ein Schöngeist und schreibt, scheint es, beinahe mehr für euro-
päische und amerikanische als für japanische Leser oder doch nur für
solche seiner Landsleute, die westliche Bildung genossen haben. Er selbst
hat lange in den Vereinigten Staaten gelebt, und es kann daher nicht
wundernehmen, daß er von dem Propheten Jeremias und Johannes dem
Täufer, von Whistler, Constable, Corot und Sir Alfred East spricht und
Wilde und Shakespeare und Balzac zitiert und einmal etwa Richard
Wagner und Walt Whitman etwas gewaltsam nebeneinander stellt. Der
erste Teil des Hiroshige ist ein Vortrag, der anläßlich der 1918 in Tokio
gefeierten sechzigsten Wiederkehr von des Künstlers Todestag gehalten
und dann in der New-Yorker Zeitschrift » Arts and Decoration« abgedruckt
wurde. Der Hiroshige-Band enthält nicht nur zu Beginn ein Gedicht des
Autors auf den Meister, sondern des weiteren auch eines, zu dem der
Verfasser durch Whistlers Gemälde »Old Battersea Bridge« in der Tate-
Gallcrie angeregt wurde. Aber Herr Yone Noguchi hat Geschmack und ist
feinsinnig und versteht zu schreiben. Die Einleitung zum Hiroshige, in
der er erzählt, wie er sich nach langem Aufenthalt in der Fremde während
einer Schiffahrt auf dem Sumidafluß zusammen mit ein paar Freunden zur
Zeit der Kirschenblüte wieder als ein Kind des Ostens fühlt und wie
Hiroshige plötzlich in ihm erwacht, ist beispielsweise wirklieh hübsch.
Hiroshige nennt er in Wahrheit den einzigen eingeborenen und volks-
tümlichen Künstler von Japan. An anderer Stelle des Buches aber muß er
zugestehen, daß Hiroshige in seinem Vaterland erst in den zweiten Ab-
schnitt seiner Wertschätzung, den der urteilslosen Verhimmelung, ein-
trete, während er im Westen bereits im dritten Abschnitt, dem der ge-
rechten Würdigung, stehe. Der Beantwortung der Frage, ob es einen
u-bari scheint frag
lieb,
— 83