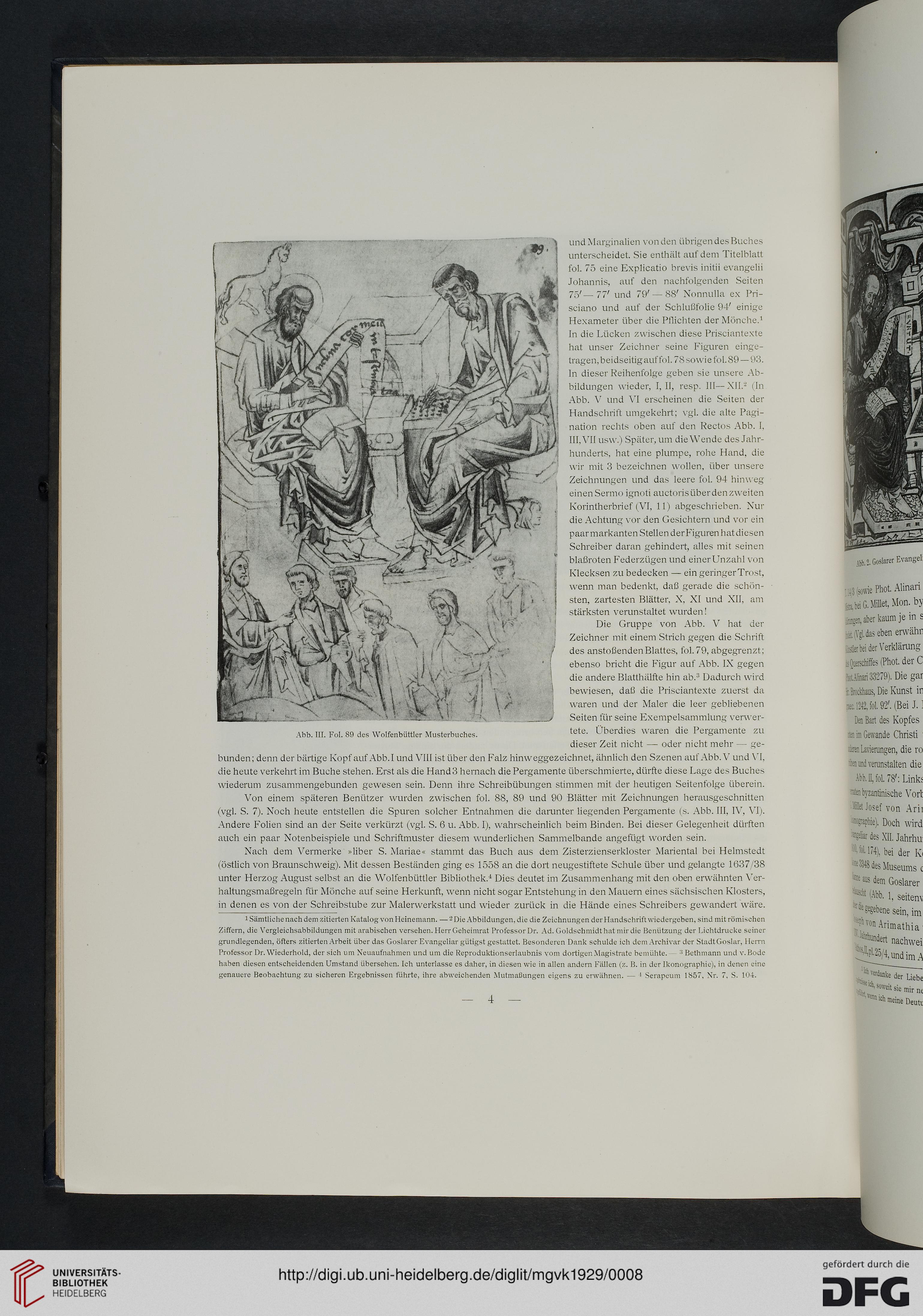und Marginalien von Jen übrigen des Buches
unterscheidet. Sie enthält auf dem Titelblatt
fol. 75 eine Explicatio brevis initii evangelii
Johannis, auf den nachfolgenden Seiten
75'—77' und 79' — 88' Nonnulla ex Pri-
sciano und auf der Schlußfolie 94' einige
Hexameter über die Pflichten der Mönche.1
In die Lücken zwischen diese Prisciantexte
hat unser Zeichner seine Figuren einge-
tragen, beidseitig auf fol. 78 sowie fol. 89 —! Kl
In dieser Reihenfolge geben sie unsere Ab-
bildungen wieder, I, II, resp. III—XII.2 (In
Abb. V und VI erscheinen die Seiten der
Handschrift umgekehrt; vgl. die alte Pagi-
nation rechts oben auf den Rectos Abb. I,
III, VII usw.) Später, um die Wende des Jahr-
hunderts, hat eine plumpe, rohe Hand, die
wir mit 3 bezeichnen wollen, über unsere
Zeichnungen und das leere fol. 94 hinweg
einen Sermo ignoti auctoris über den zweiten
Korintherbrief (VI, 11) abgeschrieben. Nur
die Achtung vor den Gesichtern und vor ein
paar markanten Stellen derFiguren hat diesen
Schreiber daran gehindert, alles mit seinen
blaßroten Federzügen und einer Unzahl von
Klecksen zu bedecken — ein geringer Trost,
wenn man bedenkt, daß gerade die schön-
sten, zartesten Blätter, X, XI und XII, am
stärksten verunstaltet wurden!
Die Gruppe von Abb. V hat der
Zeichner mit einem Strich gegen die Schrift
des anstoßenden Blattes, fol. 79, abgegrenzt:
ebenso bricht die Figur auf Abb. IX gegen
die andere Blatthälfte hin ab.3 Dadurch wird
bewiesen, daß die Prisciantexte zuerst da
waren und der Maler die leer gebliebenen
Seiten für seine Exempelsammlung verwer-
tete. Überdies waren die Pergamente zu
dieser Zeit nicht — oder nicht mehr — ge-
bunden; denn der bärtige Kopf auf Abb.I und VIII ist über den Falz hinweggezeichnet, ähnlich den Szenen auf Abb. V und VI,
die heute verkehrt im Buche stehen. Erst als die Hand3 hernach die Pergamente überschmierte, dürfte diese Lage des Buches
wiederum zusammengebunden gewesen sein. Denn ihre Schreibübungen stimmen mit der heutigen Seitenfolge überein.
Von einem späteren Benützer wurden zwischen fol. 88, 89 und 90 Blätter mit Zeichnungen herausgeschnitten
(vgl. S. 7). Noch heute entstellen die Spuren solcher Entnahmen die darunter liegenden Pergamente (s. Abb. III. IV, VI).
Andere Folien sind an der Seite verkürzt (vgl. S. 6 u. Abb. I), wahrscheinlich beim Binden. Bei dieser Gelegenheit dürften
auch ein paar Notenbeispiele und Schriftmuster diesem wunderlichen Sammelbande angefügt worden sein.
Nach dem Vermerke »liber S. Mariae« stammt das Buch aus dem Zisterzienserkloster Mariental bei Helmstedt
(östlich von Braunschweig). Mit dessen Beständen ging es 1558 an die dort neugestiftete Schule über und gelangte 1637/38
unter Herzog August selbst an die Wolfenbüttler Bibliothek.4 Dies deutet im Zusammenhang mit den oben erwähnten Ver-
haltungsmaßregeln für Mönche auf seine Herkunft, wenn nicht sogar Entstehung in den Mauern eines sächsischen Klosters,
in denen es von der Schreibstube zur Malerwerkstatt und wieder zurück in die Hände eines Schreibers gewandert wäre.
1 Sämtliche nach dem zitierten Kataiog von Heinemann. — ~ Die Abbildungen, die die Zeichnungen der Handschrift wiedergeben, sind mit römischen
Ziffern, die Vergleichsabbildungen mit arabischen versehen. Herr Geheimrat Professor Dr. Ad. Goldschmidt hat mir die Benützung der Lichtdrucke seiner
grundlegenden, öfters zitierten Arbeit über das Goslarer Evangeliar gütigst gestattet. Besonderen Dank schulde ich dem Archivar der Stadt Goslar, 1 [errn
Professor Dr. Wiederhold, der sich um Neuaufnahmen und um die Reproduktionserlaubnis vom dortigen Magistrate bemühte. — ;1 Bethmann und v.Bode
haben diesen entscheidenden Umstand übersehen. Ich unterlasse es daher, in diesen wie in allen andern Fällen (z. B. in der Ikonographie), in denen eine
genauere Beobachtung zu sicheren Ergebnissen führte, ihre abweichenden Mutmaßungen eigens zu erwähnen. — 1 Serapeum 1H5", Nr. 7. S. 104.
— 4 —
Abb. III. Fol. 89 des Wolfenbüttler Musterbuches.
Sf*
Abb. 2. Goslarer Evangel
[1^ (sowie Phot. Alinari
ÄbeiG.Millet,Mon. b>
jagen, aber kaum je in s
-jt (Vgl. das eben erwähr
fcfa bei der Verklärung
bQiHschles (Phot. der C
Min 33279). Die gar
itakhaus, Die Kunst ir
jw.1242, fol. 92'. (Bei J.:
Den Bart des Kopfes
a im Gewände Christi
iw Lavierungen, die ro
•jenund verunstalten die
Abb.ü, fol. 78': Link:
*n byzantinische Vort
■Met Josef von Arii
•graphie). Doch wird
"«fades XII. Jahrhu
^foLl74), bei der R
*»desMuseums c
•»"s dem Goslarer
^« (Abb. 1, seitem
gegebene sein, im
JPk'onArimathia
'^nta nachwei
^/iundim.A
J1*«* der Liebe
^'th'*eitsiemirns
unterscheidet. Sie enthält auf dem Titelblatt
fol. 75 eine Explicatio brevis initii evangelii
Johannis, auf den nachfolgenden Seiten
75'—77' und 79' — 88' Nonnulla ex Pri-
sciano und auf der Schlußfolie 94' einige
Hexameter über die Pflichten der Mönche.1
In die Lücken zwischen diese Prisciantexte
hat unser Zeichner seine Figuren einge-
tragen, beidseitig auf fol. 78 sowie fol. 89 —! Kl
In dieser Reihenfolge geben sie unsere Ab-
bildungen wieder, I, II, resp. III—XII.2 (In
Abb. V und VI erscheinen die Seiten der
Handschrift umgekehrt; vgl. die alte Pagi-
nation rechts oben auf den Rectos Abb. I,
III, VII usw.) Später, um die Wende des Jahr-
hunderts, hat eine plumpe, rohe Hand, die
wir mit 3 bezeichnen wollen, über unsere
Zeichnungen und das leere fol. 94 hinweg
einen Sermo ignoti auctoris über den zweiten
Korintherbrief (VI, 11) abgeschrieben. Nur
die Achtung vor den Gesichtern und vor ein
paar markanten Stellen derFiguren hat diesen
Schreiber daran gehindert, alles mit seinen
blaßroten Federzügen und einer Unzahl von
Klecksen zu bedecken — ein geringer Trost,
wenn man bedenkt, daß gerade die schön-
sten, zartesten Blätter, X, XI und XII, am
stärksten verunstaltet wurden!
Die Gruppe von Abb. V hat der
Zeichner mit einem Strich gegen die Schrift
des anstoßenden Blattes, fol. 79, abgegrenzt:
ebenso bricht die Figur auf Abb. IX gegen
die andere Blatthälfte hin ab.3 Dadurch wird
bewiesen, daß die Prisciantexte zuerst da
waren und der Maler die leer gebliebenen
Seiten für seine Exempelsammlung verwer-
tete. Überdies waren die Pergamente zu
dieser Zeit nicht — oder nicht mehr — ge-
bunden; denn der bärtige Kopf auf Abb.I und VIII ist über den Falz hinweggezeichnet, ähnlich den Szenen auf Abb. V und VI,
die heute verkehrt im Buche stehen. Erst als die Hand3 hernach die Pergamente überschmierte, dürfte diese Lage des Buches
wiederum zusammengebunden gewesen sein. Denn ihre Schreibübungen stimmen mit der heutigen Seitenfolge überein.
Von einem späteren Benützer wurden zwischen fol. 88, 89 und 90 Blätter mit Zeichnungen herausgeschnitten
(vgl. S. 7). Noch heute entstellen die Spuren solcher Entnahmen die darunter liegenden Pergamente (s. Abb. III. IV, VI).
Andere Folien sind an der Seite verkürzt (vgl. S. 6 u. Abb. I), wahrscheinlich beim Binden. Bei dieser Gelegenheit dürften
auch ein paar Notenbeispiele und Schriftmuster diesem wunderlichen Sammelbande angefügt worden sein.
Nach dem Vermerke »liber S. Mariae« stammt das Buch aus dem Zisterzienserkloster Mariental bei Helmstedt
(östlich von Braunschweig). Mit dessen Beständen ging es 1558 an die dort neugestiftete Schule über und gelangte 1637/38
unter Herzog August selbst an die Wolfenbüttler Bibliothek.4 Dies deutet im Zusammenhang mit den oben erwähnten Ver-
haltungsmaßregeln für Mönche auf seine Herkunft, wenn nicht sogar Entstehung in den Mauern eines sächsischen Klosters,
in denen es von der Schreibstube zur Malerwerkstatt und wieder zurück in die Hände eines Schreibers gewandert wäre.
1 Sämtliche nach dem zitierten Kataiog von Heinemann. — ~ Die Abbildungen, die die Zeichnungen der Handschrift wiedergeben, sind mit römischen
Ziffern, die Vergleichsabbildungen mit arabischen versehen. Herr Geheimrat Professor Dr. Ad. Goldschmidt hat mir die Benützung der Lichtdrucke seiner
grundlegenden, öfters zitierten Arbeit über das Goslarer Evangeliar gütigst gestattet. Besonderen Dank schulde ich dem Archivar der Stadt Goslar, 1 [errn
Professor Dr. Wiederhold, der sich um Neuaufnahmen und um die Reproduktionserlaubnis vom dortigen Magistrate bemühte. — ;1 Bethmann und v.Bode
haben diesen entscheidenden Umstand übersehen. Ich unterlasse es daher, in diesen wie in allen andern Fällen (z. B. in der Ikonographie), in denen eine
genauere Beobachtung zu sicheren Ergebnissen führte, ihre abweichenden Mutmaßungen eigens zu erwähnen. — 1 Serapeum 1H5", Nr. 7. S. 104.
— 4 —
Abb. III. Fol. 89 des Wolfenbüttler Musterbuches.
Sf*
Abb. 2. Goslarer Evangel
[1^ (sowie Phot. Alinari
ÄbeiG.Millet,Mon. b>
jagen, aber kaum je in s
-jt (Vgl. das eben erwähr
fcfa bei der Verklärung
bQiHschles (Phot. der C
Min 33279). Die gar
itakhaus, Die Kunst ir
jw.1242, fol. 92'. (Bei J.:
Den Bart des Kopfes
a im Gewände Christi
iw Lavierungen, die ro
•jenund verunstalten die
Abb.ü, fol. 78': Link:
*n byzantinische Vort
■Met Josef von Arii
•graphie). Doch wird
"«fades XII. Jahrhu
^foLl74), bei der R
*»desMuseums c
•»"s dem Goslarer
^« (Abb. 1, seitem
gegebene sein, im
JPk'onArimathia
'^nta nachwei
^/iundim.A
J1*«* der Liebe
^'th'*eitsiemirns