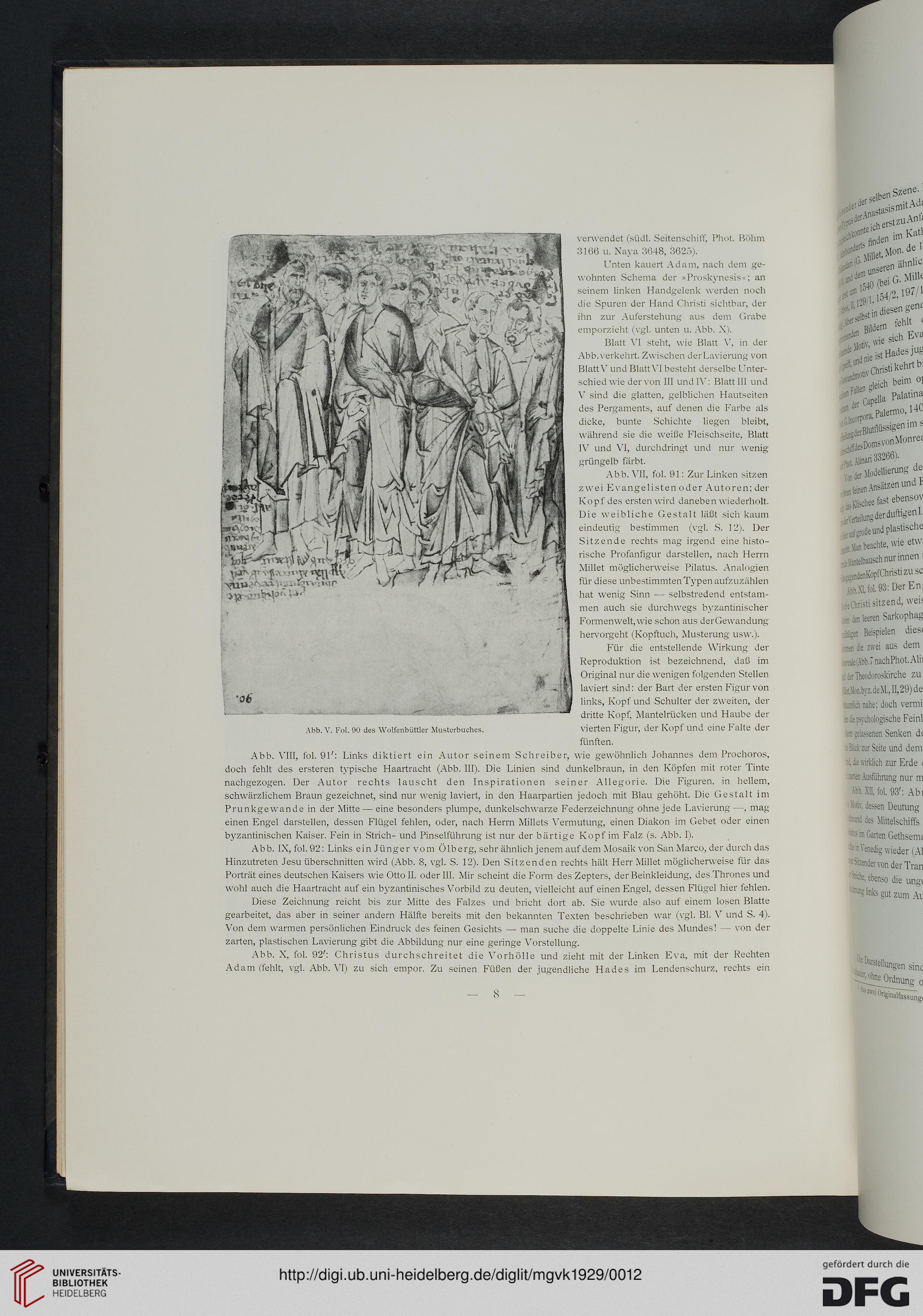verwendet (südl. Seitenschiff, Phot. Böhm
3166 u. Naya 3648, 3625).
Unten kauert Adam, nach dem ge-
wohnten Schema der »Proskynesis«; an
seinem linken Handgelenk werden noch
die Spuren der Hand Christi sichtbar, der
ihn zur Auferstehung aus dem Grabe
emporzieht (vgl. unten u. Abb. X).
Blatt VI steht, wie Blatt V, in der
Abb. verkehrt. Zwischen derLavierung von
Blatt V und Blatt VI besteht derselbe Unter-
schied wie der von III und IV: Blatt III und
V sind die glatten, gelblichen Hautseiten
des Pergaments, auf denen die Farbe als
dicke, bunte Schichte liegen bleibt,
während sie die weiße Fleischseite, Blatt
IV und VI, durchdringt und nur wenig
grüngelb färbt.
Abb. VII, fol. 91: Zur Linken sitzen
zwei Evangelisten oder Autoren; der
Kopf des ersten wird daneben wiederholt.
Die weibliche Gestalt läßt sich kaum
eindeutig bestimmen (vgl. S. 12). Der
Sitzende rechts mag irgend eine histo-
rische Profanfigur darstellen, nach Herrn
Millet möglicherweise Pilatus. Analogien
für diese unbestimmten Typen aufzuzählen
hat wenig Sinn — selbstredend entstam-
men auch sie durchwegs byzantinischer
Formenwelt,wie schon aus derGewandung
hervorgeht (Kopftuch, Musterung usw.).
Für die entstellende Wirkung der
Reproduktion ist bezeichnend, daß im
Original nur die wenigen folgenden Stellen
laviert sind: der Bart der ersten Figur von
links, Kopf und Schulter der zweiten, der
dritte Kopf. Mantelrücken und Haube der
vierten Figur, der Kopf und eine Falte der
fünften.
Abb. VIII, fol. 91': Links diktiert ein Autor seinem Schreiber, wie gewöhnlich Johannes dem Prochoros,
doch fehlt des ersteren typische Haartracht (Abb. III). Die Linien sind dunkelbraun, in den Köpfen mit roter Tinte
nachgezogen. Der Autor rechts lauscht den Inspirationen seiner Allegorie. Die Figuren, in hellem,
schwärzlichem Braun gezeichnet, sind nur wenig laviert, in den Haarpartien jedoch mit Blau gehöht. Die Gestalt im
Prunkgewande in der Mitte — eine besonders plumpe, dunkelschwarze Federzeichnung ohne jede Lavierung —, mag
einen Engel darstellen, dessen Flügel fehlen, oder, nach Herrn Millets Vermutung, einen Diakon im Gebet oder einen
byzantinischen Kaiser. Fein in Strich- und Pinselführung ist nur der bärtige Kopf im Falz (s. Abb. I).
Abb. IX, fol. 92: Links ein Jünger vom Ölberg, sehr ähnlich jenem auf dem Mosaik von San Marco, der durch das
Hinzutreten Jesu überschnitten wird (Abb. 8, vgl. S. 12). Den Sitzenden rechts hält Herr Millet möglicherweise für das
Porträt eines deutschen Kaisers wie Otto II. oder III. Mir scheint die Form des Zepters, der Beinkleidung, des Thrones und
wohl auch die Haartracht auf ein byzantinisches Vorbild zu deuten, vielleicht auf einen Engel, dessen Flügel hier fehlen.
Diese Zeichnung reicht bis zur Mitte des Falzes und bricht dort ab. Sie wurde also auf einem losen Blatte
gearbeitet, das aber in seiner andern Hälfte bereits mit den bekannten Texten beschrieben war (vgl. Bl. V und S. 4).
Von dem warmen persönlichen Eindruck des feinen Gesichts — man suche die doppelte Linie des Mundes! — von der
zarten, plastischen Lavierung gibt die Abbildung nur eine geringe Vorstellung.
Abb. X, fol. 92': Christus durchschreitet die Vorhölle und zieht mit der Linken Eva, mit der Rechten
Adam (fehlt, vgl. Abb. VI) zu sich empor. Zu seinen Füßen der jugendliche Hades im Lendenschurz, rechts ein
Abb. V. Fol. 90 des Wolfenbüttler Musterbuches.
3166 u. Naya 3648, 3625).
Unten kauert Adam, nach dem ge-
wohnten Schema der »Proskynesis«; an
seinem linken Handgelenk werden noch
die Spuren der Hand Christi sichtbar, der
ihn zur Auferstehung aus dem Grabe
emporzieht (vgl. unten u. Abb. X).
Blatt VI steht, wie Blatt V, in der
Abb. verkehrt. Zwischen derLavierung von
Blatt V und Blatt VI besteht derselbe Unter-
schied wie der von III und IV: Blatt III und
V sind die glatten, gelblichen Hautseiten
des Pergaments, auf denen die Farbe als
dicke, bunte Schichte liegen bleibt,
während sie die weiße Fleischseite, Blatt
IV und VI, durchdringt und nur wenig
grüngelb färbt.
Abb. VII, fol. 91: Zur Linken sitzen
zwei Evangelisten oder Autoren; der
Kopf des ersten wird daneben wiederholt.
Die weibliche Gestalt läßt sich kaum
eindeutig bestimmen (vgl. S. 12). Der
Sitzende rechts mag irgend eine histo-
rische Profanfigur darstellen, nach Herrn
Millet möglicherweise Pilatus. Analogien
für diese unbestimmten Typen aufzuzählen
hat wenig Sinn — selbstredend entstam-
men auch sie durchwegs byzantinischer
Formenwelt,wie schon aus derGewandung
hervorgeht (Kopftuch, Musterung usw.).
Für die entstellende Wirkung der
Reproduktion ist bezeichnend, daß im
Original nur die wenigen folgenden Stellen
laviert sind: der Bart der ersten Figur von
links, Kopf und Schulter der zweiten, der
dritte Kopf. Mantelrücken und Haube der
vierten Figur, der Kopf und eine Falte der
fünften.
Abb. VIII, fol. 91': Links diktiert ein Autor seinem Schreiber, wie gewöhnlich Johannes dem Prochoros,
doch fehlt des ersteren typische Haartracht (Abb. III). Die Linien sind dunkelbraun, in den Köpfen mit roter Tinte
nachgezogen. Der Autor rechts lauscht den Inspirationen seiner Allegorie. Die Figuren, in hellem,
schwärzlichem Braun gezeichnet, sind nur wenig laviert, in den Haarpartien jedoch mit Blau gehöht. Die Gestalt im
Prunkgewande in der Mitte — eine besonders plumpe, dunkelschwarze Federzeichnung ohne jede Lavierung —, mag
einen Engel darstellen, dessen Flügel fehlen, oder, nach Herrn Millets Vermutung, einen Diakon im Gebet oder einen
byzantinischen Kaiser. Fein in Strich- und Pinselführung ist nur der bärtige Kopf im Falz (s. Abb. I).
Abb. IX, fol. 92: Links ein Jünger vom Ölberg, sehr ähnlich jenem auf dem Mosaik von San Marco, der durch das
Hinzutreten Jesu überschnitten wird (Abb. 8, vgl. S. 12). Den Sitzenden rechts hält Herr Millet möglicherweise für das
Porträt eines deutschen Kaisers wie Otto II. oder III. Mir scheint die Form des Zepters, der Beinkleidung, des Thrones und
wohl auch die Haartracht auf ein byzantinisches Vorbild zu deuten, vielleicht auf einen Engel, dessen Flügel hier fehlen.
Diese Zeichnung reicht bis zur Mitte des Falzes und bricht dort ab. Sie wurde also auf einem losen Blatte
gearbeitet, das aber in seiner andern Hälfte bereits mit den bekannten Texten beschrieben war (vgl. Bl. V und S. 4).
Von dem warmen persönlichen Eindruck des feinen Gesichts — man suche die doppelte Linie des Mundes! — von der
zarten, plastischen Lavierung gibt die Abbildung nur eine geringe Vorstellung.
Abb. X, fol. 92': Christus durchschreitet die Vorhölle und zieht mit der Linken Eva, mit der Rechten
Adam (fehlt, vgl. Abb. VI) zu sich empor. Zu seinen Füßen der jugendliche Hades im Lendenschurz, rechts ein
Abb. V. Fol. 90 des Wolfenbüttler Musterbuches.