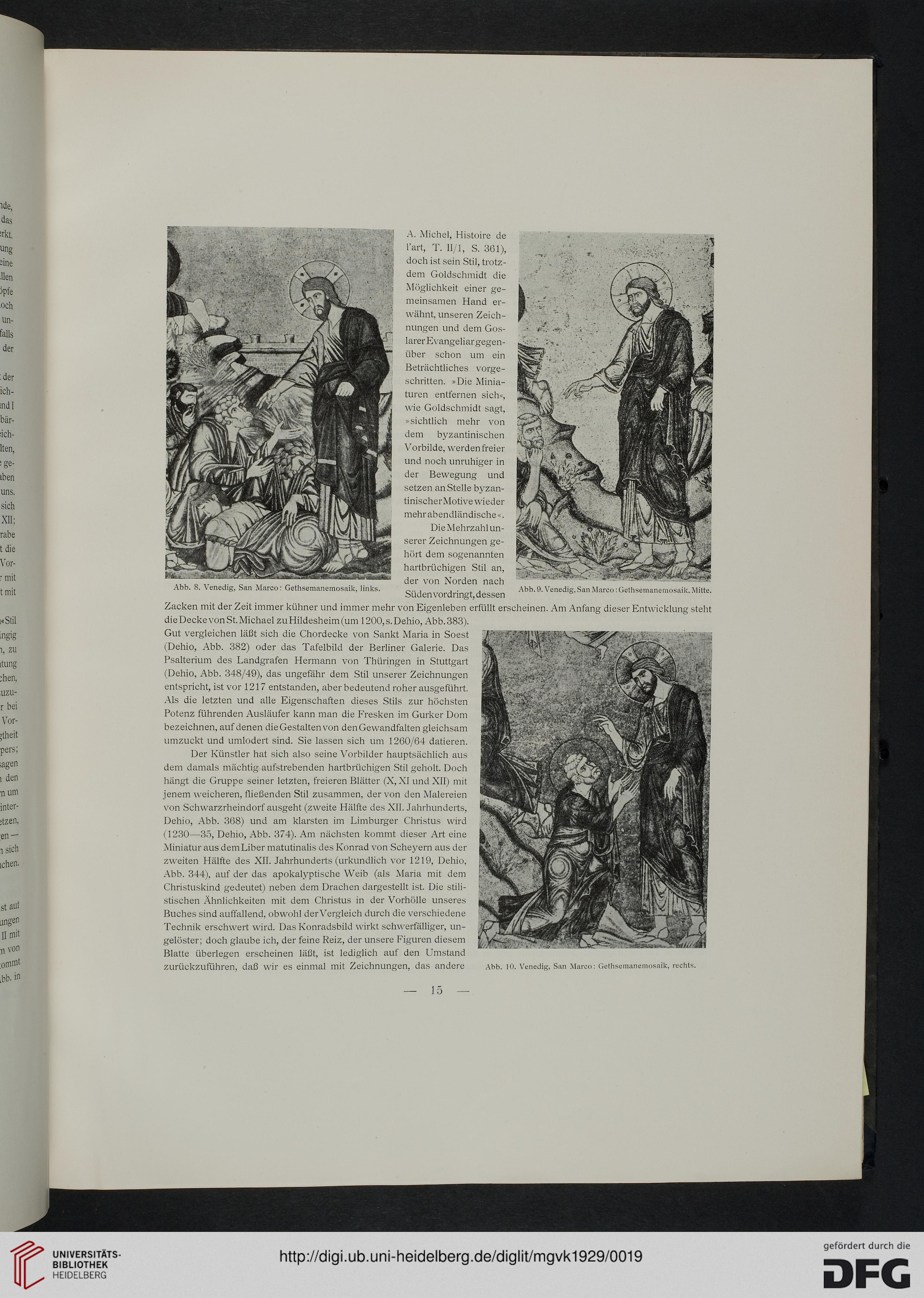A. Michel, Histoire de
l'art, T. n/1, S. 361),
doch ist sein Stil, trotz-
dem Goldschmidt die
Möglichkeit einer ge-
meinsamen Hand er-
wähnt, unseren Zeich-
nungen und dem Gos-
larer Evangeliar gegen-
über schon um ein
Beträchtliches vorge-
schritten. »Die Minia-
turen entfernen sich«,
wie Goldschmidt sagt,
»sichtlich mehr von
dem byzantinischen
Vorbilde, werden freier
und noch unruhiger in
der Bewegung und
setzen an Stelle byzan-
tiniseher Motive wieder
mehr abendländische«.
Die Mehrzahl un-
serer Zeichnungen ge-
hört dem sogenannten
hartbrüchigen Stil an,
der von Norden nach
Süden vordringt, dessen
Zacken mit der Zeit immer kühner und immer mehr von Eigenleben erfüllt erscheinen. Am Anfang dieser Entwicklung steht
die Decke von St. Michael zu Hildesheim (um 1200, s. Dehio, Abb. 383).
Gut vergleichen läßt sich die Chordecke von Sankt Maria in Soest
(Dehio, Abb. 382) oder das Tafelbild der Berliner Galerie. Das
Psalterium des Landgrafen Hermann von Thüringen in Stuttgart
(Dehio, Abb. 348/49), das ungefähr dem Stil unserer Zeichnungen
entspricht, ist vor 1217 entstanden, aber bedeutend roher ausgeführt.
Als die letzten und alle Eigenschaften dieses Stils zur höchsten
Potenz führenden Ausläufer kann man die Fresken im Gurker Dom
bezeichnen, auf denen die Gestalten von den Gewandfalten gleichsam
umzuckt und umlodert sind. Sie lassen sich um 1260/64 datieren.
Der Künstler hat sich also seine Vorbilder hauptsächlich aus
dem damals mächtig aufstrebenden hartbrüchigen Stil geholt. Doch
hängt die Gruppe seiner letzten, freieren Blätter (X, XI und XII) mit
jenem weicheren, fließenden Stil zusammen, der von den Malereien
von Schwarzrheindorf ausgeht (zweite Hälfte des XU. Jahrhunderts,
Dehio, Abb. 368) und am klarsten im Limburger Christus wird
(1230—35, Dehio, Abb. 374). Am nächsten kommt dieser Art eine
Miniatur aus demLiber matutinalis des Konrad von Scheyern aus der
zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts (urkundlich vor 1219, Dehio,
Abb. 344), auf der das apokalyptische Weib (als Maria mit dem
Christuskind gedeutet) neben dem Drachen dargestellt ist. Die stili-
stischen Ähnlichkeiten mit dem Christus in der Vorhölle unseres
Buches sind auffallend, obwohl der Vergleich durch die verschiedene
Technik erschwert wird. Das Konradsbild wirkt schwerfälliger, un-
gelöster; doch glaube ich, der feine Reiz, der unsere Figuren diesem
Blatte überlegen erscheinen läßt, ist lediglich auf den Umstand
8. Venedig, San Marco: Gethsemanemosaik, links.
Abb. 9. Venedig, San Marco: Gethsemane mosaik. Mitte.
zurückzuführen, daß wir es einmal mit Zeichnungen, das andere
Abb. 10. Venedig, San Marco: Gethsemanemosaik, rechts
0 -
l'art, T. n/1, S. 361),
doch ist sein Stil, trotz-
dem Goldschmidt die
Möglichkeit einer ge-
meinsamen Hand er-
wähnt, unseren Zeich-
nungen und dem Gos-
larer Evangeliar gegen-
über schon um ein
Beträchtliches vorge-
schritten. »Die Minia-
turen entfernen sich«,
wie Goldschmidt sagt,
»sichtlich mehr von
dem byzantinischen
Vorbilde, werden freier
und noch unruhiger in
der Bewegung und
setzen an Stelle byzan-
tiniseher Motive wieder
mehr abendländische«.
Die Mehrzahl un-
serer Zeichnungen ge-
hört dem sogenannten
hartbrüchigen Stil an,
der von Norden nach
Süden vordringt, dessen
Zacken mit der Zeit immer kühner und immer mehr von Eigenleben erfüllt erscheinen. Am Anfang dieser Entwicklung steht
die Decke von St. Michael zu Hildesheim (um 1200, s. Dehio, Abb. 383).
Gut vergleichen läßt sich die Chordecke von Sankt Maria in Soest
(Dehio, Abb. 382) oder das Tafelbild der Berliner Galerie. Das
Psalterium des Landgrafen Hermann von Thüringen in Stuttgart
(Dehio, Abb. 348/49), das ungefähr dem Stil unserer Zeichnungen
entspricht, ist vor 1217 entstanden, aber bedeutend roher ausgeführt.
Als die letzten und alle Eigenschaften dieses Stils zur höchsten
Potenz führenden Ausläufer kann man die Fresken im Gurker Dom
bezeichnen, auf denen die Gestalten von den Gewandfalten gleichsam
umzuckt und umlodert sind. Sie lassen sich um 1260/64 datieren.
Der Künstler hat sich also seine Vorbilder hauptsächlich aus
dem damals mächtig aufstrebenden hartbrüchigen Stil geholt. Doch
hängt die Gruppe seiner letzten, freieren Blätter (X, XI und XII) mit
jenem weicheren, fließenden Stil zusammen, der von den Malereien
von Schwarzrheindorf ausgeht (zweite Hälfte des XU. Jahrhunderts,
Dehio, Abb. 368) und am klarsten im Limburger Christus wird
(1230—35, Dehio, Abb. 374). Am nächsten kommt dieser Art eine
Miniatur aus demLiber matutinalis des Konrad von Scheyern aus der
zweiten Hälfte des XII. Jahrhunderts (urkundlich vor 1219, Dehio,
Abb. 344), auf der das apokalyptische Weib (als Maria mit dem
Christuskind gedeutet) neben dem Drachen dargestellt ist. Die stili-
stischen Ähnlichkeiten mit dem Christus in der Vorhölle unseres
Buches sind auffallend, obwohl der Vergleich durch die verschiedene
Technik erschwert wird. Das Konradsbild wirkt schwerfälliger, un-
gelöster; doch glaube ich, der feine Reiz, der unsere Figuren diesem
Blatte überlegen erscheinen läßt, ist lediglich auf den Umstand
8. Venedig, San Marco: Gethsemanemosaik, links.
Abb. 9. Venedig, San Marco: Gethsemane mosaik. Mitte.
zurückzuführen, daß wir es einmal mit Zeichnungen, das andere
Abb. 10. Venedig, San Marco: Gethsemanemosaik, rechts
0 -