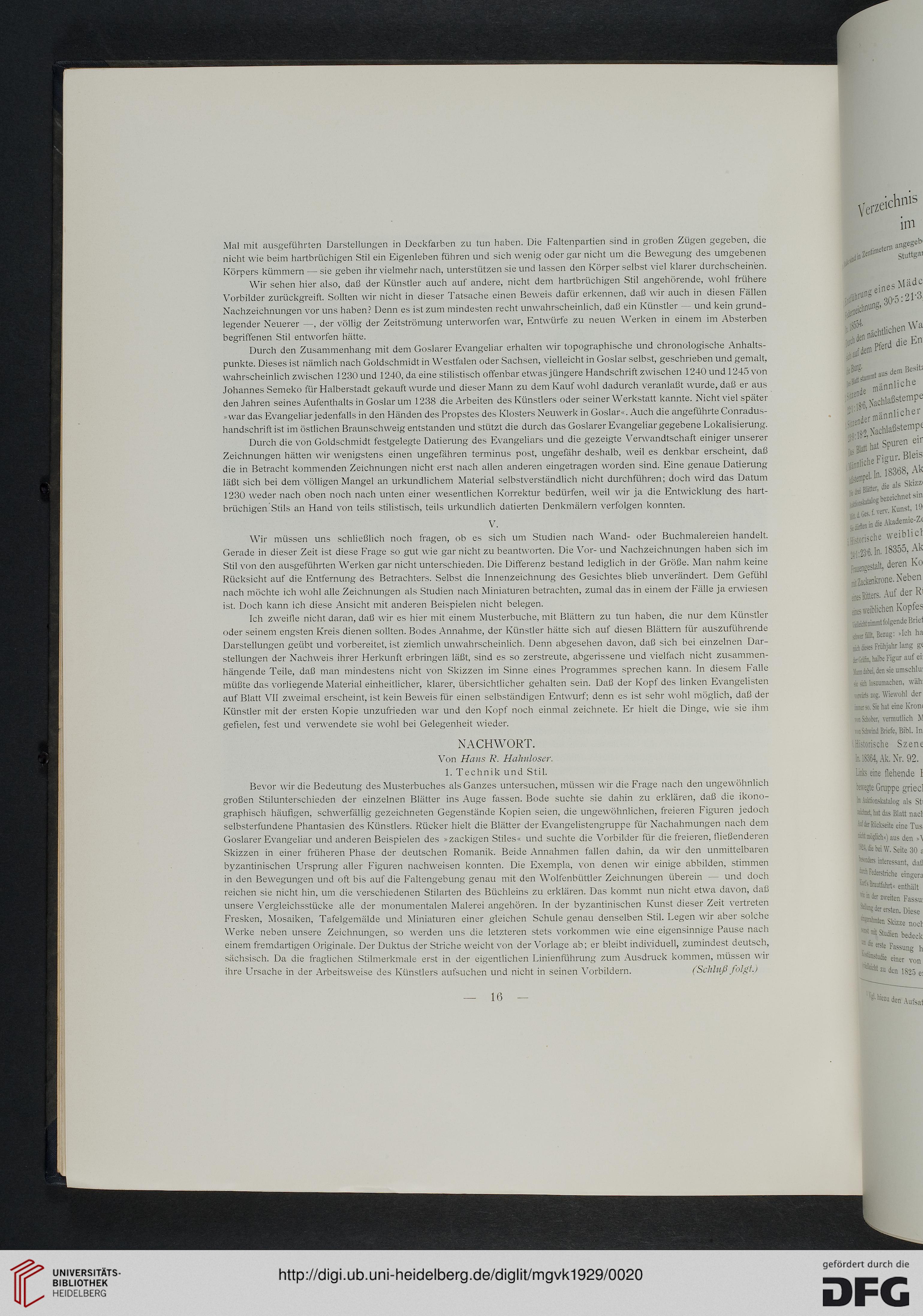Verze
ichnis
Mal mit ausgeführten Darstellungen in Deckfarben zu tun haben. Die Faltenpartien sind in großen Zügen gegeben, die
nicht wie beim hartbrüchigen Stil ein Eigenleben führen und sich wenig oder gar nicht um die Bewegung des umgebenen
Körpers kümmern — sie geben ihr vielmehr nach, unterstützen sie und lassen den Körper selbst viel klarer durchscheinen.
Wir sehen hier also, daß der Künstler auch auf andere, nicht dem hartbrüchigen Stil angehörende, wohl frühere
Vorbilder zurückgreift. Sollten wir nicht in dieser Tatsache einen Beweis dafür erkennen, daß wir auch in diesen Fällen
Nachzeichnungen vor uns haben? Denn es ist zum mindesten recht unwahrscheinlich, daß ein Künstler — und kein grund-
legender Neuerer —, der völlig der Zeitströmung unterworfen war, Entwürfe zu neuen Werken in einem im Absterben
begriffenen Stil entworfen hätte.
Durch den Zusammenhang mit dem Goslarer Evangeliar erhalten wir topographische und chronologische Anhalts-
punkte. Dieses ist nämlich nach Goldschmidt in Westfalen oder Sachsen, vielleicht in Goslar selbst, geschrieben und gemalt,
wahrscheinlich zwischen 1230 und 1240, da eine stilistisch offenbar etwas jüngere Handschrift zwischen 1240 und 1245 von
Johannes Semeko für Halberstadt gekauft wurde und dieser Mann zu dem Kauf wohl dadurch veranlaßt wurde, daß er aus
den Jahren seines Aufenthalts in Goslar um 1238 die Arbeiten des Künstlers oder seiner Werkstatt kannte. Nicht viel später
»war das Evangeliar jedenfalls in den Händen des Propstes de» Klosters Neuwerk in Goslar«. Auch die angeführte Conradu>-
handschrift ist im östlichen Braunschweig entstanden und stützt die durch das Goslarer Evangeliar gegebene Lokalisierung.
Durch die von Goldschmidt festgelegte Datierung des Evangeliars und die gezeigte Verwandtschaft einiger unserer
Zeichnungen hätten wir wenigstens einen ungefähren terminus post, ungefähr deshalb, weil es denkbar erscheint, daß
die in Betracht kommenden Zeichnungen nicht erst nach allen anderen eingetragen worden sind. Eine genaue Datierung
läßt sich bei dem völligen Mangel an urkundlichem Material selbstverständlich nicht durchführen; doch wird das Datum
1230 weder nach oben noch nach unten einer wesentlichen Korrektur bedürfen, weil wir ja die Entwicklung des hart-
brüchigen Stils an Hand von teils stilistisch, teils urkundlich datierten Denkmälern verfolgen konnten.
V.
Wir müssen uns schließlich noch fragen, ob es sich um Studien nach Wand- oder Buchmalereien handelt.
Gerade in dieser Zeit ist diese Frage so gut wie gar nicht zu beantworten. Die Vor- und Nachzeichnungen haben sich im
Stil von den ausgeführten Werken gar nicht unterschieden. Die Differenz bestand lediglich in der Größe. Man nahm keine
Rücksicht auf die Entfernung des Betrachters. Selbst die Innenzeichnung des Gesichtes blieb unverändert. Dem Gefühl
nach möchte ich wohl alle Zeichnungen als Studien nach Miniaturen betrachten, zumal das in einem der Fälle ja erwiesen
ist. Doch kann ich diese Ansicht mit anderen Beispielen nicht belegen.
Ich zweifle nicht daran, daß wir es hier mit einem Musterbuche, mit Blättern zu tun haben, die nur dem Künstler
oder seinem engsten Kreis dienen sollten. Bodes Annahme, der Künstler hätte sich auf diesen Blättern für auszuführende
Darstellungen geübt und vorbereitet, ist ziemlich unwahrscheinlich. Denn abgesehen davon, daß sich bei einzelnen Dar-
stellungen der Nachweis ihrer Herkunft erbringen läßt, sind es so zerstreute, abgerissene und vielfach nicht zusammen-
hängende Teile, daß man mindestens nicht von Skizzen im Sinne eines Programmes sprechen kann. In diesem Falle
müßte das vorliegende Material einheitlicher, klarer, übersichtlicher gehalten sein. Daß der Kopf des linken Evangelisten
auf Blatt VII zweimal erscheint, ist kein Beweis für einen selbständigen Entwurf; denn es ist sehr wohl möglich, daß der
Künstler mit der ersten Kopie unzufrieden war und den Kopf noch einmal zeichnete. Er hielt die Dinge, wie sie ihm
gefielen, fest und verwendete sie wohl bei Gelegenheit wieder.
NACHWORT.
Von Hans R. Hahnloser.
1. Technik und Stil.
Bevor wir die Bedeutung des Musterbuches als Ganzes untersuchen, müssen wir die Frage nach den ungewöhnlich
großen Stilunterschieden der einzelnen Blätter ins Auge fassen. Bode suchte sie dahin zu erklären, daß die ikono-
graphisch häufigen, schwerfällig gezeichneten Gegenstände Kopien seien, die ungewöhnlichen, freieren Figuren jedoch
selbsterfundene Phantasien des Künstlers. Rücker hielt die Blätter der Evangelistengruppe für Nachahmungen nach dem
Goslarer Evangeliar und anderen Beispielen des »zackigen Stiles« und suchte die Vorbilder für die freieren, fließenderen
Skizzen in einer früheren Phase der deutschen Romanik. Beide Annahmen fallen dahin, da wir den unmittelbaren
byzantinischen Ursprung aller Figuren nachweisen konnten. Die Exempla, von denen wir einige abbilden, stimmen
in den Bewegungen und oft bis auf die Faltengebung genau mit den Wolfenbüttler Zeichnungen überein — und doch
reichen sie nicht hin, um die verschiedenen Stilarten des Büchleins zu erklären. Das kommt nun nicht etwa davon, daß
unsere Vergleichsstücke alle der monumentalen Malerei angehören. In der byzantinischen Kunst dieser Zeit vertreten
Fresken, Mosaiken, Tafelgemälde und Miniaturen einer gleichen Schule genau denselben Stil. Legen wir aber solche
Werke neben unsere Zeichnungen, so werden uns die letzteren stets vorkommen wie eine eigensinnige Pause nach
einem fremdartigen Originale. Der Duktus der Striche weicht von der Vorlage ab; er bleibt individuell, zumindest deutsch,
sächsisch. Da die fraglichen Stilmerkmale erst in der eigentlichen Linienführung zum Ausdruck kommen, müssen wir
ihre Ursache in der Arbeitsweise des Künstlers aufsuchen und nicht in seinen Vorbildern. (Schluß folgt.)
im
ang«Se
Stuttg
<L 30-5:21-
nächtliche^'
, , Pferd die L
3e männliche
J'VNachlaßstemP
iendermännUche
Nachlaßstemp*
tßlatt hat Spuren eir
In. 18368, Ak
^bezeichnes
J^ver, Kunst, 19
i6tomdieAkadem.e-
Bistorische weiblic
W:23i In. 18355, Ak
deren Ko
aZackenkrone. Neben
sies Ritters. Auf der R
aes weiblichen Kopfe
rslltkMmmint folgende Briel
ara fällt, Bezug: .Ich h*
-ihfas Frühjahr lang «
jaCrinn, halbe Figur auf ei
Stadiki. den sie umschlu
s in loszumachen, wäh:
wtiits zog. Wiewohl der
333 so. Sie hat eine Krom
-'«Schober, vermutlich M
vut Schvrind Briefe. Bibl. In
Historische Szen
4,Ak.Xr. 92.
Links eine flehende
'xwegte Gruppe grieel
!a Jith'onskatalog als Sti
«int, hat das Blatt nact
Wto Rückseite eine Tus
Oaus den >\
'Öt, die bei W. Seite 30
^•te interessant, dafl
^Federstriche einger
^Bnutfatat, enthält
*»fanreiten Fassu
^Hte ersten. Diese
•W*» Skizze noct
** * Studien bedeck
"* «e Fassung h
l einer von
110 den 1S25 e:
— 16 —
"""im Aufsal
ichnis
Mal mit ausgeführten Darstellungen in Deckfarben zu tun haben. Die Faltenpartien sind in großen Zügen gegeben, die
nicht wie beim hartbrüchigen Stil ein Eigenleben führen und sich wenig oder gar nicht um die Bewegung des umgebenen
Körpers kümmern — sie geben ihr vielmehr nach, unterstützen sie und lassen den Körper selbst viel klarer durchscheinen.
Wir sehen hier also, daß der Künstler auch auf andere, nicht dem hartbrüchigen Stil angehörende, wohl frühere
Vorbilder zurückgreift. Sollten wir nicht in dieser Tatsache einen Beweis dafür erkennen, daß wir auch in diesen Fällen
Nachzeichnungen vor uns haben? Denn es ist zum mindesten recht unwahrscheinlich, daß ein Künstler — und kein grund-
legender Neuerer —, der völlig der Zeitströmung unterworfen war, Entwürfe zu neuen Werken in einem im Absterben
begriffenen Stil entworfen hätte.
Durch den Zusammenhang mit dem Goslarer Evangeliar erhalten wir topographische und chronologische Anhalts-
punkte. Dieses ist nämlich nach Goldschmidt in Westfalen oder Sachsen, vielleicht in Goslar selbst, geschrieben und gemalt,
wahrscheinlich zwischen 1230 und 1240, da eine stilistisch offenbar etwas jüngere Handschrift zwischen 1240 und 1245 von
Johannes Semeko für Halberstadt gekauft wurde und dieser Mann zu dem Kauf wohl dadurch veranlaßt wurde, daß er aus
den Jahren seines Aufenthalts in Goslar um 1238 die Arbeiten des Künstlers oder seiner Werkstatt kannte. Nicht viel später
»war das Evangeliar jedenfalls in den Händen des Propstes de» Klosters Neuwerk in Goslar«. Auch die angeführte Conradu>-
handschrift ist im östlichen Braunschweig entstanden und stützt die durch das Goslarer Evangeliar gegebene Lokalisierung.
Durch die von Goldschmidt festgelegte Datierung des Evangeliars und die gezeigte Verwandtschaft einiger unserer
Zeichnungen hätten wir wenigstens einen ungefähren terminus post, ungefähr deshalb, weil es denkbar erscheint, daß
die in Betracht kommenden Zeichnungen nicht erst nach allen anderen eingetragen worden sind. Eine genaue Datierung
läßt sich bei dem völligen Mangel an urkundlichem Material selbstverständlich nicht durchführen; doch wird das Datum
1230 weder nach oben noch nach unten einer wesentlichen Korrektur bedürfen, weil wir ja die Entwicklung des hart-
brüchigen Stils an Hand von teils stilistisch, teils urkundlich datierten Denkmälern verfolgen konnten.
V.
Wir müssen uns schließlich noch fragen, ob es sich um Studien nach Wand- oder Buchmalereien handelt.
Gerade in dieser Zeit ist diese Frage so gut wie gar nicht zu beantworten. Die Vor- und Nachzeichnungen haben sich im
Stil von den ausgeführten Werken gar nicht unterschieden. Die Differenz bestand lediglich in der Größe. Man nahm keine
Rücksicht auf die Entfernung des Betrachters. Selbst die Innenzeichnung des Gesichtes blieb unverändert. Dem Gefühl
nach möchte ich wohl alle Zeichnungen als Studien nach Miniaturen betrachten, zumal das in einem der Fälle ja erwiesen
ist. Doch kann ich diese Ansicht mit anderen Beispielen nicht belegen.
Ich zweifle nicht daran, daß wir es hier mit einem Musterbuche, mit Blättern zu tun haben, die nur dem Künstler
oder seinem engsten Kreis dienen sollten. Bodes Annahme, der Künstler hätte sich auf diesen Blättern für auszuführende
Darstellungen geübt und vorbereitet, ist ziemlich unwahrscheinlich. Denn abgesehen davon, daß sich bei einzelnen Dar-
stellungen der Nachweis ihrer Herkunft erbringen läßt, sind es so zerstreute, abgerissene und vielfach nicht zusammen-
hängende Teile, daß man mindestens nicht von Skizzen im Sinne eines Programmes sprechen kann. In diesem Falle
müßte das vorliegende Material einheitlicher, klarer, übersichtlicher gehalten sein. Daß der Kopf des linken Evangelisten
auf Blatt VII zweimal erscheint, ist kein Beweis für einen selbständigen Entwurf; denn es ist sehr wohl möglich, daß der
Künstler mit der ersten Kopie unzufrieden war und den Kopf noch einmal zeichnete. Er hielt die Dinge, wie sie ihm
gefielen, fest und verwendete sie wohl bei Gelegenheit wieder.
NACHWORT.
Von Hans R. Hahnloser.
1. Technik und Stil.
Bevor wir die Bedeutung des Musterbuches als Ganzes untersuchen, müssen wir die Frage nach den ungewöhnlich
großen Stilunterschieden der einzelnen Blätter ins Auge fassen. Bode suchte sie dahin zu erklären, daß die ikono-
graphisch häufigen, schwerfällig gezeichneten Gegenstände Kopien seien, die ungewöhnlichen, freieren Figuren jedoch
selbsterfundene Phantasien des Künstlers. Rücker hielt die Blätter der Evangelistengruppe für Nachahmungen nach dem
Goslarer Evangeliar und anderen Beispielen des »zackigen Stiles« und suchte die Vorbilder für die freieren, fließenderen
Skizzen in einer früheren Phase der deutschen Romanik. Beide Annahmen fallen dahin, da wir den unmittelbaren
byzantinischen Ursprung aller Figuren nachweisen konnten. Die Exempla, von denen wir einige abbilden, stimmen
in den Bewegungen und oft bis auf die Faltengebung genau mit den Wolfenbüttler Zeichnungen überein — und doch
reichen sie nicht hin, um die verschiedenen Stilarten des Büchleins zu erklären. Das kommt nun nicht etwa davon, daß
unsere Vergleichsstücke alle der monumentalen Malerei angehören. In der byzantinischen Kunst dieser Zeit vertreten
Fresken, Mosaiken, Tafelgemälde und Miniaturen einer gleichen Schule genau denselben Stil. Legen wir aber solche
Werke neben unsere Zeichnungen, so werden uns die letzteren stets vorkommen wie eine eigensinnige Pause nach
einem fremdartigen Originale. Der Duktus der Striche weicht von der Vorlage ab; er bleibt individuell, zumindest deutsch,
sächsisch. Da die fraglichen Stilmerkmale erst in der eigentlichen Linienführung zum Ausdruck kommen, müssen wir
ihre Ursache in der Arbeitsweise des Künstlers aufsuchen und nicht in seinen Vorbildern. (Schluß folgt.)
im
ang«Se
Stuttg
<L 30-5:21-
nächtliche^'
, , Pferd die L
3e männliche
J'VNachlaßstemP
iendermännUche
Nachlaßstemp*
tßlatt hat Spuren eir
In. 18368, Ak
^bezeichnes
J^ver, Kunst, 19
i6tomdieAkadem.e-
Bistorische weiblic
W:23i In. 18355, Ak
deren Ko
aZackenkrone. Neben
sies Ritters. Auf der R
aes weiblichen Kopfe
rslltkMmmint folgende Briel
ara fällt, Bezug: .Ich h*
-ihfas Frühjahr lang «
jaCrinn, halbe Figur auf ei
Stadiki. den sie umschlu
s in loszumachen, wäh:
wtiits zog. Wiewohl der
333 so. Sie hat eine Krom
-'«Schober, vermutlich M
vut Schvrind Briefe. Bibl. In
Historische Szen
4,Ak.Xr. 92.
Links eine flehende
'xwegte Gruppe grieel
!a Jith'onskatalog als Sti
«int, hat das Blatt nact
Wto Rückseite eine Tus
Oaus den >\
'Öt, die bei W. Seite 30
^•te interessant, dafl
^Federstriche einger
^Bnutfatat, enthält
*»fanreiten Fassu
^Hte ersten. Diese
•W*» Skizze noct
** * Studien bedeck
"* «e Fassung h
l einer von
110 den 1S25 e:
— 16 —
"""im Aufsal