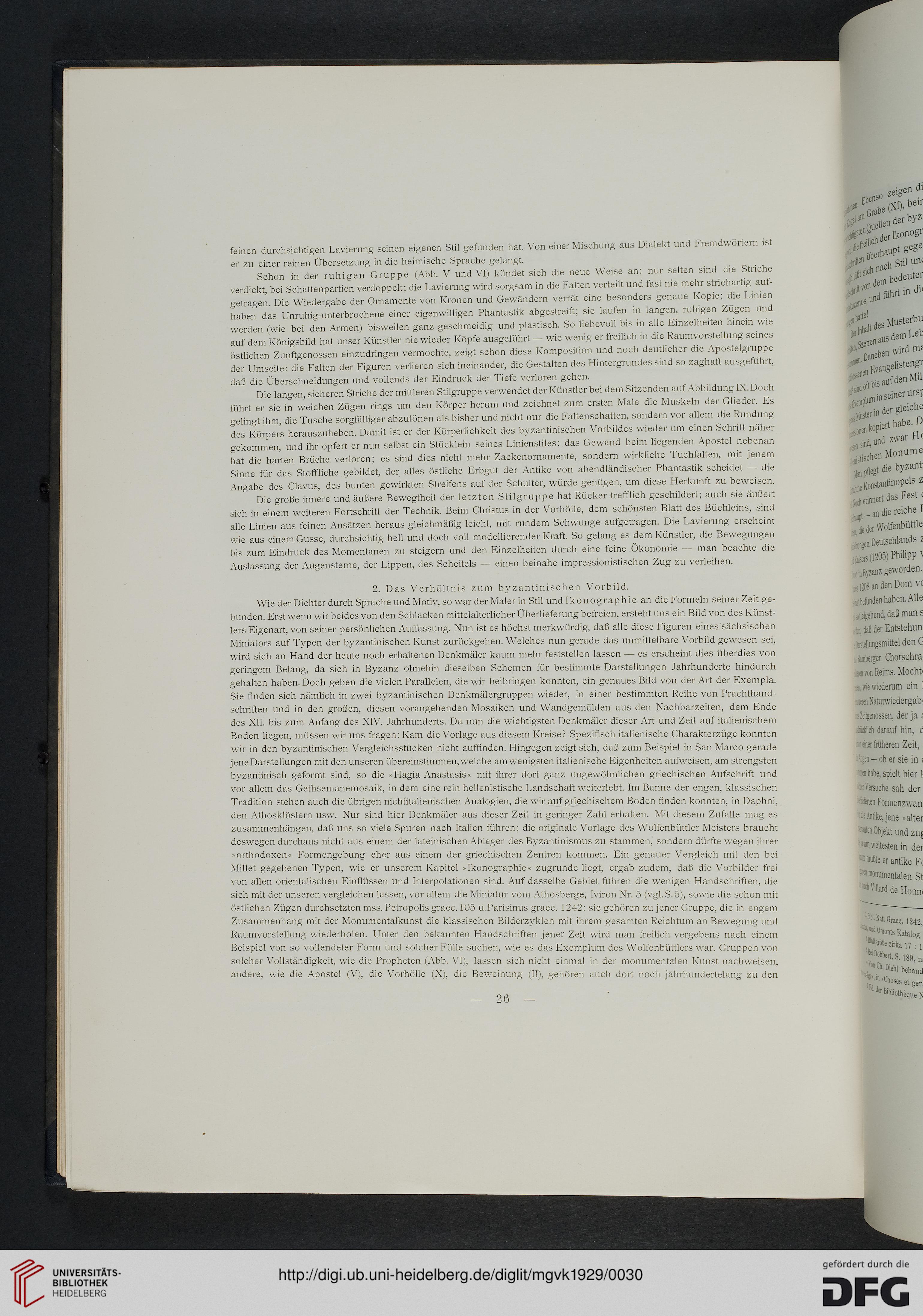feinen durchsichtigen Lavierung seinen eigenen Stil gefunden hat. Von einer Mischung aus Dialekt und Fremdwörtern ist
er zu einer reinen Übersetzung in die heimische Sprache gelangt.
Schon in der ruhigen Gruppe (Abb. V und VI) kündet sich die neue Weise an: nur selten sind die Striche
verdickt, bei Schattenpartien verdoppelt; die Lavierung wird sorgsam in die Falten verteilt und fast nie mehr strichartig auf-
getragen. Die Wiedergabe der Ornamente von Kronen und Gewändern verrät eine besonders genaue Kopie; die Linien
haben das Unruhig-unterbrochene einer eigenwilligen Phantastik abgestreift; sie laufen in langen, ruhigen Zügen und
werden (wie bei den Armen) bisweilen ganz geschmeidig und plastisch. So liebevoll bis in alle Einzelheiten hinein wie
auf dem Königsbild hat unser Künstler nie wieder Köpfe ausgeführt — wie wenig er freilich in die Raumvorstellung seines
östlichen Zunftgenossen einzudringen vermochte, zeigt schon diese Komposition und noch deutlicher die Apostelgruppe
der Umseite: die Falten der Figuren verlieren sich ineinander, die Gestalten des Hintergrundes sind so zaghaft ausgeführt,
daß die Überschneidungen und vollends der Eindruck der Tiefe verloren gehen.
Die langen, sicheren Striche der mittleren Stilgruppe verwendet der Künstler bei dem Sitzenden auf Abbildung IX. Doch
führt er sie in weichen Zügen rings um den Körper herum und zeichnet zum ersten Male die Muskeln der Glieder. Es
gelingt ihm, die Tusche sorgfältiger abzutönen als bisher und nicht nur die Faltenschatten, sondern vor allem die Rundung
des Körpers herauszuheben. Damit ist er der Körperlichkeit des byzantinischen Vorbildes wieder um einen Schritt näher
gekommen, und ihr opfert er nun selbst ein Stücklein seines Linienstiles: das Gewand beim liegenden Apostel nebenan
hat die harten Brüche verloren; es sind dies nicht mehr Zackenornamente, sondern wirkliche Tuchfalten, mit jenem
Sinne für das Stoffliche gebildet, der alles östliche Erbgut der Antike von abendländischer Phantastik scheidet — die
Angabe des Clavus, des bunten gewirkten Streifens auf der Schulter, würde genügen, um diese Herkunft zu beweisen.
Die große innere und äußere Bewegtheit der letzten Stilgruppe hat Rücker trefflich geschildert; auch sie äußert
sich in einem weiteren Fortschritt der Technik. Beim Christus in der Vorhölle, dem schönsten Blatt des Büchleins, sind
alle Linien aus feinen Ansätzen heraus gleichmäßig leicht, mit rundem Schwünge aufgetragen. Die Lavierung erscheint
wie aus einem Gusse, durchsichtig hell und doch voll modellierender Kraft. So gelang es dem Künstler, die Bewegungen
bis zum Eindruck des Momentanen zu steigern und den Einzelheiten durch eine feine Ökonomie — man beachte die
Auslassung der Augensterne, der Lippen, des Scheitels — einen beinahe impressionistischen Zug zu verleihen.
2. Das Verhältnis zum byzantinischen Vorbild.
Wie der Dichter durch Sprache und Motiv, so war der Maler in Stil und Ikonographie an die Formeln seinerzeit ge-
bunden. Erst wenn wir beides von den Schlacken mittelalterlicher Überlieferung befreien, ersteht uns ein Bild von des Künst-
lers Eigenart, von seiner persönlichen Auffassung. Nun ist es höchst merkwürdig, daß alle diese Figuren eines sächsischen
Miniators auf Typen der byzantinischen Kunst zurückgehen. Welches nun gerade das unmittelbare Vorbild gewesen sei,
wird sich an Hand der heute noch erhaltenen Denkmäler kaum mehr feststellen lassen — es erscheint dies überdies von
geringem Belang, da sich in Byzanz ohnehin dieselben Schemen für bestimmte Darstellungen Jahrhunderte hindurch
gehalten haben. Doch geben die vielen Parallelen, die wir beibringen konnten, ein genaues Bild von der Art der Exempla.
Sie finden sich nämlich in zwei byzantinischen Denkmälergruppen wieder, in einer bestimmten Reihe von Prachthand-
schriften und in den großen, diesen vorangehenden Mosaiken und Wandgemälden aus den Nachbarzeiten, dem Ende
des XII. bis zum Anfang des XIV. Jahrhunderts. Da nun die wichtigsten Denkmäler dieser Art und Zeit auf italienischem
Boden liegen, müssen wir uns fragen: Kam die Vorlage aus diesem Kreise? Spezifisch italienische Charakterzüge konnten
wir in den byzantinischen Vergleichsstücken nicht auffinden. Hingegen zeigt sich, daß zum Beispiel in San Marco gerade
jene Darstellungen mit den unseren übereinstimmen, welche am wenigsten italienische Eigenheiten aufweisen, am strengsten
byzantinisch geformt sind, so die »Hagia Anastasis« mit ihrer dort ganz ungewöhnlichen griechischen Aufschrift und
vor allem das Gethsemanemosaik, in dem eine rein hellenistische Landschaft weiterlebt. Im Banne der engen, klassischen
Tradition stehen auch die übrigen nichtitalienischen Analogien, die wir auf griechischem Boden finden konnten, in Daphni,
den Athosklöstern usw. Nur sind hier Denkmäler aus dieser Zeit in geringer Zahl erhalten. Mit diesem Zufalle mag es
zusammenhängen, daß uns so viele Spuren nach Italien führen; die originale Vorlage des Wolfenbüttler Meisters braucht
deswegen durchaus nicht aus einem der lateinischen Ableger des Byzantinismus zu stammen, sondern dürfte wegen ihrer
-orthodoxen« Formengebung eher aus einem der griechischen Zentren kommen. Ein genauer Vergleich mit den bei
Millet gegebenen Typen, wie er unserem Kapitel »Ikonographie« zugrunde liegt, ergab zudem, daß die Vorbilder frei
von allen orientalischen Einflüssen und Interpolationen sind. Auf dasselbe Gebiet führen die wenigen Handschriften, die
sich mit der unseren vergleichen lassen, vor allem die Miniatur vom Athosberge, Iviron Nr. 5 (vgl.S.5), sowie die schon mit
östlichen Zügen durchsetzten mss. Petropolis graec. 105 u. Parisinus graec. 1242: sie gehören zu jener Gruppe, die in engem
Zusammenhang mit der Monumentalkunst die klassischen Bilderzyklen mit ihrem gesamten Reichtum an Bewegung und
Raumvorstellung wiederholen. Unter den bekannten Handschriften jener Zeit wird man freilich vergebens nach einem
Beispiel von so vollendeter Form und solcher Fülle suchen, wie es das Exemplum des Wolfenbüttlers war. Gruppen von
solcher Vollständigkeit, wie die Propheten (Abb. VI), lassen sich nicht einmal in der monumentalen Kunst nachweisen,
andere, wie die Apostel (V), die Vorhülle (X), die Beweinung (II), gehören auch dort noch jahrhundertelang zu den
— 26 —
«so *eigen ^
^terhaupt gege
„acb Stü um
^fldesMusterbu
;b UmLet
Cluster indern'
>piert habe.D
rtund zwarHc
fischen Monume
Man pflegt die byzant
-e Konstantinopels z
««innert das Fest <
:jpl_ an die reiche I
„derWolfenbüttle
'.^„Deutschlands i
fcßtlä») Philippe
■;8vzanz geworden.
sl20B«nden Dom v<
^befunden haben. Alle
gehend, daß mans
4 jal) der Entstehun
^mittel den G
Chorschra
•:: von Reims. Mocht
lie wiederum ein !
m Naturwiedergab'
ägenossen, der ja <
äklich darauf hin, d
:-r- früheren Zeit,
■-gen — ob er sie in i
■ habe, spielt hier \
■"Versuche sah der
-inen Formenzwan
Antike, jene »alter
•»Objekt und zuf
'■Mitesten in der
»mfiteer antike Fi
■"■Mnumentalen St
de Honm
.stein
-»Villard (
01 Graec. 124'
^«onts Katalog'
%*iirkai7 ■ l
',!*"««. S. 189,'n,
..^hlbehand
^■"■Chcsesetgen
lib6«"iothequeN
er zu einer reinen Übersetzung in die heimische Sprache gelangt.
Schon in der ruhigen Gruppe (Abb. V und VI) kündet sich die neue Weise an: nur selten sind die Striche
verdickt, bei Schattenpartien verdoppelt; die Lavierung wird sorgsam in die Falten verteilt und fast nie mehr strichartig auf-
getragen. Die Wiedergabe der Ornamente von Kronen und Gewändern verrät eine besonders genaue Kopie; die Linien
haben das Unruhig-unterbrochene einer eigenwilligen Phantastik abgestreift; sie laufen in langen, ruhigen Zügen und
werden (wie bei den Armen) bisweilen ganz geschmeidig und plastisch. So liebevoll bis in alle Einzelheiten hinein wie
auf dem Königsbild hat unser Künstler nie wieder Köpfe ausgeführt — wie wenig er freilich in die Raumvorstellung seines
östlichen Zunftgenossen einzudringen vermochte, zeigt schon diese Komposition und noch deutlicher die Apostelgruppe
der Umseite: die Falten der Figuren verlieren sich ineinander, die Gestalten des Hintergrundes sind so zaghaft ausgeführt,
daß die Überschneidungen und vollends der Eindruck der Tiefe verloren gehen.
Die langen, sicheren Striche der mittleren Stilgruppe verwendet der Künstler bei dem Sitzenden auf Abbildung IX. Doch
führt er sie in weichen Zügen rings um den Körper herum und zeichnet zum ersten Male die Muskeln der Glieder. Es
gelingt ihm, die Tusche sorgfältiger abzutönen als bisher und nicht nur die Faltenschatten, sondern vor allem die Rundung
des Körpers herauszuheben. Damit ist er der Körperlichkeit des byzantinischen Vorbildes wieder um einen Schritt näher
gekommen, und ihr opfert er nun selbst ein Stücklein seines Linienstiles: das Gewand beim liegenden Apostel nebenan
hat die harten Brüche verloren; es sind dies nicht mehr Zackenornamente, sondern wirkliche Tuchfalten, mit jenem
Sinne für das Stoffliche gebildet, der alles östliche Erbgut der Antike von abendländischer Phantastik scheidet — die
Angabe des Clavus, des bunten gewirkten Streifens auf der Schulter, würde genügen, um diese Herkunft zu beweisen.
Die große innere und äußere Bewegtheit der letzten Stilgruppe hat Rücker trefflich geschildert; auch sie äußert
sich in einem weiteren Fortschritt der Technik. Beim Christus in der Vorhölle, dem schönsten Blatt des Büchleins, sind
alle Linien aus feinen Ansätzen heraus gleichmäßig leicht, mit rundem Schwünge aufgetragen. Die Lavierung erscheint
wie aus einem Gusse, durchsichtig hell und doch voll modellierender Kraft. So gelang es dem Künstler, die Bewegungen
bis zum Eindruck des Momentanen zu steigern und den Einzelheiten durch eine feine Ökonomie — man beachte die
Auslassung der Augensterne, der Lippen, des Scheitels — einen beinahe impressionistischen Zug zu verleihen.
2. Das Verhältnis zum byzantinischen Vorbild.
Wie der Dichter durch Sprache und Motiv, so war der Maler in Stil und Ikonographie an die Formeln seinerzeit ge-
bunden. Erst wenn wir beides von den Schlacken mittelalterlicher Überlieferung befreien, ersteht uns ein Bild von des Künst-
lers Eigenart, von seiner persönlichen Auffassung. Nun ist es höchst merkwürdig, daß alle diese Figuren eines sächsischen
Miniators auf Typen der byzantinischen Kunst zurückgehen. Welches nun gerade das unmittelbare Vorbild gewesen sei,
wird sich an Hand der heute noch erhaltenen Denkmäler kaum mehr feststellen lassen — es erscheint dies überdies von
geringem Belang, da sich in Byzanz ohnehin dieselben Schemen für bestimmte Darstellungen Jahrhunderte hindurch
gehalten haben. Doch geben die vielen Parallelen, die wir beibringen konnten, ein genaues Bild von der Art der Exempla.
Sie finden sich nämlich in zwei byzantinischen Denkmälergruppen wieder, in einer bestimmten Reihe von Prachthand-
schriften und in den großen, diesen vorangehenden Mosaiken und Wandgemälden aus den Nachbarzeiten, dem Ende
des XII. bis zum Anfang des XIV. Jahrhunderts. Da nun die wichtigsten Denkmäler dieser Art und Zeit auf italienischem
Boden liegen, müssen wir uns fragen: Kam die Vorlage aus diesem Kreise? Spezifisch italienische Charakterzüge konnten
wir in den byzantinischen Vergleichsstücken nicht auffinden. Hingegen zeigt sich, daß zum Beispiel in San Marco gerade
jene Darstellungen mit den unseren übereinstimmen, welche am wenigsten italienische Eigenheiten aufweisen, am strengsten
byzantinisch geformt sind, so die »Hagia Anastasis« mit ihrer dort ganz ungewöhnlichen griechischen Aufschrift und
vor allem das Gethsemanemosaik, in dem eine rein hellenistische Landschaft weiterlebt. Im Banne der engen, klassischen
Tradition stehen auch die übrigen nichtitalienischen Analogien, die wir auf griechischem Boden finden konnten, in Daphni,
den Athosklöstern usw. Nur sind hier Denkmäler aus dieser Zeit in geringer Zahl erhalten. Mit diesem Zufalle mag es
zusammenhängen, daß uns so viele Spuren nach Italien führen; die originale Vorlage des Wolfenbüttler Meisters braucht
deswegen durchaus nicht aus einem der lateinischen Ableger des Byzantinismus zu stammen, sondern dürfte wegen ihrer
-orthodoxen« Formengebung eher aus einem der griechischen Zentren kommen. Ein genauer Vergleich mit den bei
Millet gegebenen Typen, wie er unserem Kapitel »Ikonographie« zugrunde liegt, ergab zudem, daß die Vorbilder frei
von allen orientalischen Einflüssen und Interpolationen sind. Auf dasselbe Gebiet führen die wenigen Handschriften, die
sich mit der unseren vergleichen lassen, vor allem die Miniatur vom Athosberge, Iviron Nr. 5 (vgl.S.5), sowie die schon mit
östlichen Zügen durchsetzten mss. Petropolis graec. 105 u. Parisinus graec. 1242: sie gehören zu jener Gruppe, die in engem
Zusammenhang mit der Monumentalkunst die klassischen Bilderzyklen mit ihrem gesamten Reichtum an Bewegung und
Raumvorstellung wiederholen. Unter den bekannten Handschriften jener Zeit wird man freilich vergebens nach einem
Beispiel von so vollendeter Form und solcher Fülle suchen, wie es das Exemplum des Wolfenbüttlers war. Gruppen von
solcher Vollständigkeit, wie die Propheten (Abb. VI), lassen sich nicht einmal in der monumentalen Kunst nachweisen,
andere, wie die Apostel (V), die Vorhülle (X), die Beweinung (II), gehören auch dort noch jahrhundertelang zu den
— 26 —
«so *eigen ^
^terhaupt gege
„acb Stü um
^fldesMusterbu
;b UmLet
Cluster indern'
>piert habe.D
rtund zwarHc
fischen Monume
Man pflegt die byzant
-e Konstantinopels z
««innert das Fest <
:jpl_ an die reiche I
„derWolfenbüttle
'.^„Deutschlands i
fcßtlä») Philippe
■;8vzanz geworden.
sl20B«nden Dom v<
^befunden haben. Alle
gehend, daß mans
4 jal) der Entstehun
^mittel den G
Chorschra
•:: von Reims. Mocht
lie wiederum ein !
m Naturwiedergab'
ägenossen, der ja <
äklich darauf hin, d
:-r- früheren Zeit,
■-gen — ob er sie in i
■ habe, spielt hier \
■"Versuche sah der
-inen Formenzwan
Antike, jene »alter
•»Objekt und zuf
'■Mitesten in der
»mfiteer antike Fi
■"■Mnumentalen St
de Honm
.stein
-»Villard (
01 Graec. 124'
^«onts Katalog'
%*iirkai7 ■ l
',!*"««. S. 189,'n,
..^hlbehand
^■"■Chcsesetgen
lib6«"iothequeN