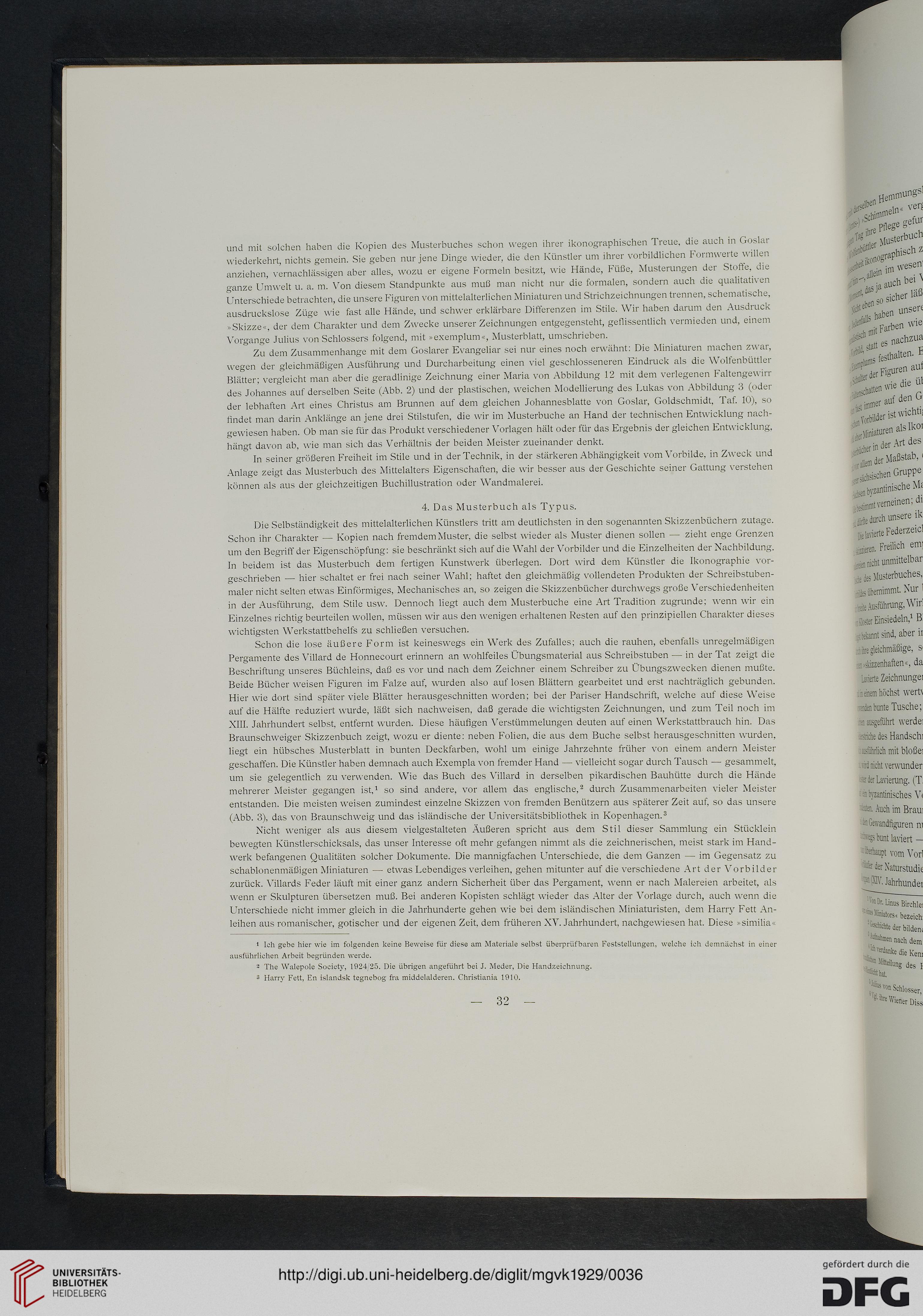und mit solchen haben die Kopien des Musterbuches schon wegen ihrer ikonographischen Treue, die auch in Goslar
wiederkehrt, nichts gemein. Sie geben nur jene Dinge wieder, die den Künstler um ihrer vorbildlichen Formwerte willen
anziehen, vernachlässigen aber alles, wozu er eigene Formeln besitzt, wie Hände, Füße, Musterungen der Stoffe, die
ganze Umwelt u. a. m. Von diesem Standpunkte aus muß man nicht nur die formalen, sondern auch die qualitativen
Unterschiede betrachten, die unsere Figuren von mittelalterlichen Miniaturen und Strichzeichnungen trennen, schematische,
ausdruckslose Züge wie fast alle Hände, und schwer erklärbare Differenzen im Stile. Wir haben darum den Ausdruck
»Skizze«, der dem Charakter und dem Zwecke unserer Zeichnungen entgegensteht, geflissentlich vermieden und, einem
Vorgange Julius von Schlossers folgend, mit »exemplum«, Musterblatt, umschrieben.
Zu dem Zusammenhange mit dem Goslarer Evangeliar sei nur eines noch erwähnt: Die Miniaturen machen zwar,
wegen der gleichmäßigen Ausführung und Durcharbeitung einen viel geschlosseneren Eindruck als die Wolfenbüttler
Blätter; vergleicht man aber die geradlinige Zeichnung einer Maria von Abbildung 12 mit dem verlegenen Faltengewirr
des Johannes auf derselben Seite (Abb. 2) und der plastischen, weichen Modellierung des Lukas von Abbildung 3 (oder
der lebhaften Art eines Christus am Brunnen auf dem gleichen Johannesblatte von Goslar, Goldschmidt, Taf. 10), so
findet man darin Anklänge an jene drei Stilstufen, die wir im Musterbuche an Hand der technischen Entwicklung nach-
gewiesen haben. Ob man sie für das Produkt verschiedener Vorlagen hält oder für das Ergebnis der gleichen Entwicklung,
hängt davon ab, wie man sich das Verhältnis der beiden Meister zueinander denkt.
In seiner größeren Freiheit im Stile und in der Technik, in der stärkeren Abhängigkeit vom Vorbilde, in Zweck und
Anlage zeigt das Musterbuch des Mittelalters Eigenschaften, die wir besser aus der Geschichte seiner Gattung verstehen
können als aus der gleichzeitigen Buchillustration oder Wandmalerei.
4. Das Musterbuch als Typus.
Die Selbständigkeit des mittelalterlichen Künstlers tritt am deutlichsten in den sogenannten Skizzenbüchern zutage.
Schon ihr Charakter — Kopien nach fremdem Muster, die selbst wieder als Muster dienen sollen — zieht enge Grenzen
um den Begriff der Eigenschöpfung: sie beschränkt sich auf die Wahl der Vorbilder und die Einzelheiten der Nachbildung.
In beidem ist das Musterbuch dem fertigen Kunstwerk überlegen. Dort wird dem Künstler die Ikonographie vor-
geschrieben — hier schaltet er frei nach seiner Wahl; haftet den gleichmäßig vollendeten Produkten der Schreibstuben-
maler nicht selten etwas Einförmiges, Mechanisches an, so zeigen die Skizzenbücher durchwegs große Verschiedenheiten
in der Ausführung, dem Stile usw. Dennoch liegt auch dem Musterbuche eine Art Tradition zugrunde; wenn wir ein
Einzelnes richtig beurteilen wollen, müssen wir aus den wenigen erhaltenen Resten auf den prinzipiellen Charakter dieses
wichtigsten Werkstattbehelfs zu schließen versuchen.
Schon die lose äußere Form ist keineswegs ein Werk des Zufalles; auch die rauhen, ebenfalls unregelmäßigen
Pergamente des Villard de Honnecourt erinnern an wohlfeiles Übungsmaterial aus Schreibstuben — in der Tat zeigt die
Beschriftung unseres Büchleins, daß es vor und nach dem Zeichner einem Schreiber zu Übungszwecken dienen mußte.
Beide Bücher weisen Figuren im Falze auf, wurden also auf losen Blättern gearbeitet und erst nachträglich gebunden.
Hier wie dort sind später viele Blätter herausgeschnitten worden; bei der Pariser Handschrift, welche auf diese Weise
auf die Hälfte reduziert wurde, läßt sich nachweisen, daß gerade die wichtigsten Zeichnungen, und zum Teil noch im
XIII. Jahrhundert selbst, entfernt wurden. Diese häufigen Verstümmelungen deuten auf einen Werkstattbrauch hin. Das
Braunschweiger Skizzenbuch zeigt, wozu er diente: neben Folien, die aus dem Buche selbst herausgeschnitten wurden,
liegt ein hübsches Musterblatt in bunten Deckfarben, wohl um einige Jahrzehnte früher von einem andern Meister
geschaffen. Die Künstler haben demnach auch Exempla von fremder Hand — vielleicht sogar durch Tausch — gesammelt,
um sie gelegentlich zu verwenden. Wie das Buch des Villard in derselben pikardischen Bauhütte durch die Hände
mehrerer Meister gegangen ist,1 so sind andere, vor allem das englische,2 durch Zusammenarbeiten vieler Meister
entstanden. Die meisten weisen zumindest einzelne Skizzen von fremden Benützern aus späterer Zeit auf, so das unsere
(Abb. 3), das von Braunschweig und das isländische der Universitätsbibliothek in Kopenhagen.3
Xicht weniger als aus diesem vielgestalteten Äußeren spricht aus dem Stil dieser Sammlung ein Stücklein
bewegten Künstlerschicksals, das unser Interesse oft mehr gefangen nimmt als die zeichnerischen, meist stark im Hand-
werk befangenen Qualitäten solcher Dokumente. Die mannigfachen Unterschiede, die dem Ganzen — im Gegensatz zu
schablonenmäßigen Miniaturen — etwas Lebendiges verleihen, gehen mitunter auf die verschiedene Art der Vorbilder
zurück. Villards Feder läuft mit einer ganz andern Sicherheit über das Pergament, wenn er nach Malereien arbeitet, als
wenn er Skulpturen übersetzen muß. Bei anderen Kopisten schlägt wieder das Alter der Vorlage durch, auch wenn die
Unterschiede nicht immer gleich in die Jahrhunderte gehen wie bei dem isländischen Miniaturisten, dem Harry Fett An-
leihen aus romanischer, gotischer und der eigenen Zeit, dem früheren XV. Jahrhundert, nachgewiesen hat. Diese »similia«
i Ich gebe hier wie im folgenden keine Beweise für diese am Materiale selbst überprüfbaren Feststellungen, welche ich demnächst in einer
ausführlichen Arbeit begründen werde.
s The Walepole Society, 1924/25. Die übrigen angeführt bei J. Meder, Die Handzeichnung.
3 Harry Fett, En islandsk tegnebog fra middetalderen. Cliristiania 1910.
wiederkehrt, nichts gemein. Sie geben nur jene Dinge wieder, die den Künstler um ihrer vorbildlichen Formwerte willen
anziehen, vernachlässigen aber alles, wozu er eigene Formeln besitzt, wie Hände, Füße, Musterungen der Stoffe, die
ganze Umwelt u. a. m. Von diesem Standpunkte aus muß man nicht nur die formalen, sondern auch die qualitativen
Unterschiede betrachten, die unsere Figuren von mittelalterlichen Miniaturen und Strichzeichnungen trennen, schematische,
ausdruckslose Züge wie fast alle Hände, und schwer erklärbare Differenzen im Stile. Wir haben darum den Ausdruck
»Skizze«, der dem Charakter und dem Zwecke unserer Zeichnungen entgegensteht, geflissentlich vermieden und, einem
Vorgange Julius von Schlossers folgend, mit »exemplum«, Musterblatt, umschrieben.
Zu dem Zusammenhange mit dem Goslarer Evangeliar sei nur eines noch erwähnt: Die Miniaturen machen zwar,
wegen der gleichmäßigen Ausführung und Durcharbeitung einen viel geschlosseneren Eindruck als die Wolfenbüttler
Blätter; vergleicht man aber die geradlinige Zeichnung einer Maria von Abbildung 12 mit dem verlegenen Faltengewirr
des Johannes auf derselben Seite (Abb. 2) und der plastischen, weichen Modellierung des Lukas von Abbildung 3 (oder
der lebhaften Art eines Christus am Brunnen auf dem gleichen Johannesblatte von Goslar, Goldschmidt, Taf. 10), so
findet man darin Anklänge an jene drei Stilstufen, die wir im Musterbuche an Hand der technischen Entwicklung nach-
gewiesen haben. Ob man sie für das Produkt verschiedener Vorlagen hält oder für das Ergebnis der gleichen Entwicklung,
hängt davon ab, wie man sich das Verhältnis der beiden Meister zueinander denkt.
In seiner größeren Freiheit im Stile und in der Technik, in der stärkeren Abhängigkeit vom Vorbilde, in Zweck und
Anlage zeigt das Musterbuch des Mittelalters Eigenschaften, die wir besser aus der Geschichte seiner Gattung verstehen
können als aus der gleichzeitigen Buchillustration oder Wandmalerei.
4. Das Musterbuch als Typus.
Die Selbständigkeit des mittelalterlichen Künstlers tritt am deutlichsten in den sogenannten Skizzenbüchern zutage.
Schon ihr Charakter — Kopien nach fremdem Muster, die selbst wieder als Muster dienen sollen — zieht enge Grenzen
um den Begriff der Eigenschöpfung: sie beschränkt sich auf die Wahl der Vorbilder und die Einzelheiten der Nachbildung.
In beidem ist das Musterbuch dem fertigen Kunstwerk überlegen. Dort wird dem Künstler die Ikonographie vor-
geschrieben — hier schaltet er frei nach seiner Wahl; haftet den gleichmäßig vollendeten Produkten der Schreibstuben-
maler nicht selten etwas Einförmiges, Mechanisches an, so zeigen die Skizzenbücher durchwegs große Verschiedenheiten
in der Ausführung, dem Stile usw. Dennoch liegt auch dem Musterbuche eine Art Tradition zugrunde; wenn wir ein
Einzelnes richtig beurteilen wollen, müssen wir aus den wenigen erhaltenen Resten auf den prinzipiellen Charakter dieses
wichtigsten Werkstattbehelfs zu schließen versuchen.
Schon die lose äußere Form ist keineswegs ein Werk des Zufalles; auch die rauhen, ebenfalls unregelmäßigen
Pergamente des Villard de Honnecourt erinnern an wohlfeiles Übungsmaterial aus Schreibstuben — in der Tat zeigt die
Beschriftung unseres Büchleins, daß es vor und nach dem Zeichner einem Schreiber zu Übungszwecken dienen mußte.
Beide Bücher weisen Figuren im Falze auf, wurden also auf losen Blättern gearbeitet und erst nachträglich gebunden.
Hier wie dort sind später viele Blätter herausgeschnitten worden; bei der Pariser Handschrift, welche auf diese Weise
auf die Hälfte reduziert wurde, läßt sich nachweisen, daß gerade die wichtigsten Zeichnungen, und zum Teil noch im
XIII. Jahrhundert selbst, entfernt wurden. Diese häufigen Verstümmelungen deuten auf einen Werkstattbrauch hin. Das
Braunschweiger Skizzenbuch zeigt, wozu er diente: neben Folien, die aus dem Buche selbst herausgeschnitten wurden,
liegt ein hübsches Musterblatt in bunten Deckfarben, wohl um einige Jahrzehnte früher von einem andern Meister
geschaffen. Die Künstler haben demnach auch Exempla von fremder Hand — vielleicht sogar durch Tausch — gesammelt,
um sie gelegentlich zu verwenden. Wie das Buch des Villard in derselben pikardischen Bauhütte durch die Hände
mehrerer Meister gegangen ist,1 so sind andere, vor allem das englische,2 durch Zusammenarbeiten vieler Meister
entstanden. Die meisten weisen zumindest einzelne Skizzen von fremden Benützern aus späterer Zeit auf, so das unsere
(Abb. 3), das von Braunschweig und das isländische der Universitätsbibliothek in Kopenhagen.3
Xicht weniger als aus diesem vielgestalteten Äußeren spricht aus dem Stil dieser Sammlung ein Stücklein
bewegten Künstlerschicksals, das unser Interesse oft mehr gefangen nimmt als die zeichnerischen, meist stark im Hand-
werk befangenen Qualitäten solcher Dokumente. Die mannigfachen Unterschiede, die dem Ganzen — im Gegensatz zu
schablonenmäßigen Miniaturen — etwas Lebendiges verleihen, gehen mitunter auf die verschiedene Art der Vorbilder
zurück. Villards Feder läuft mit einer ganz andern Sicherheit über das Pergament, wenn er nach Malereien arbeitet, als
wenn er Skulpturen übersetzen muß. Bei anderen Kopisten schlägt wieder das Alter der Vorlage durch, auch wenn die
Unterschiede nicht immer gleich in die Jahrhunderte gehen wie bei dem isländischen Miniaturisten, dem Harry Fett An-
leihen aus romanischer, gotischer und der eigenen Zeit, dem früheren XV. Jahrhundert, nachgewiesen hat. Diese »similia«
i Ich gebe hier wie im folgenden keine Beweise für diese am Materiale selbst überprüfbaren Feststellungen, welche ich demnächst in einer
ausführlichen Arbeit begründen werde.
s The Walepole Society, 1924/25. Die übrigen angeführt bei J. Meder, Die Handzeichnung.
3 Harry Fett, En islandsk tegnebog fra middetalderen. Cliristiania 1910.