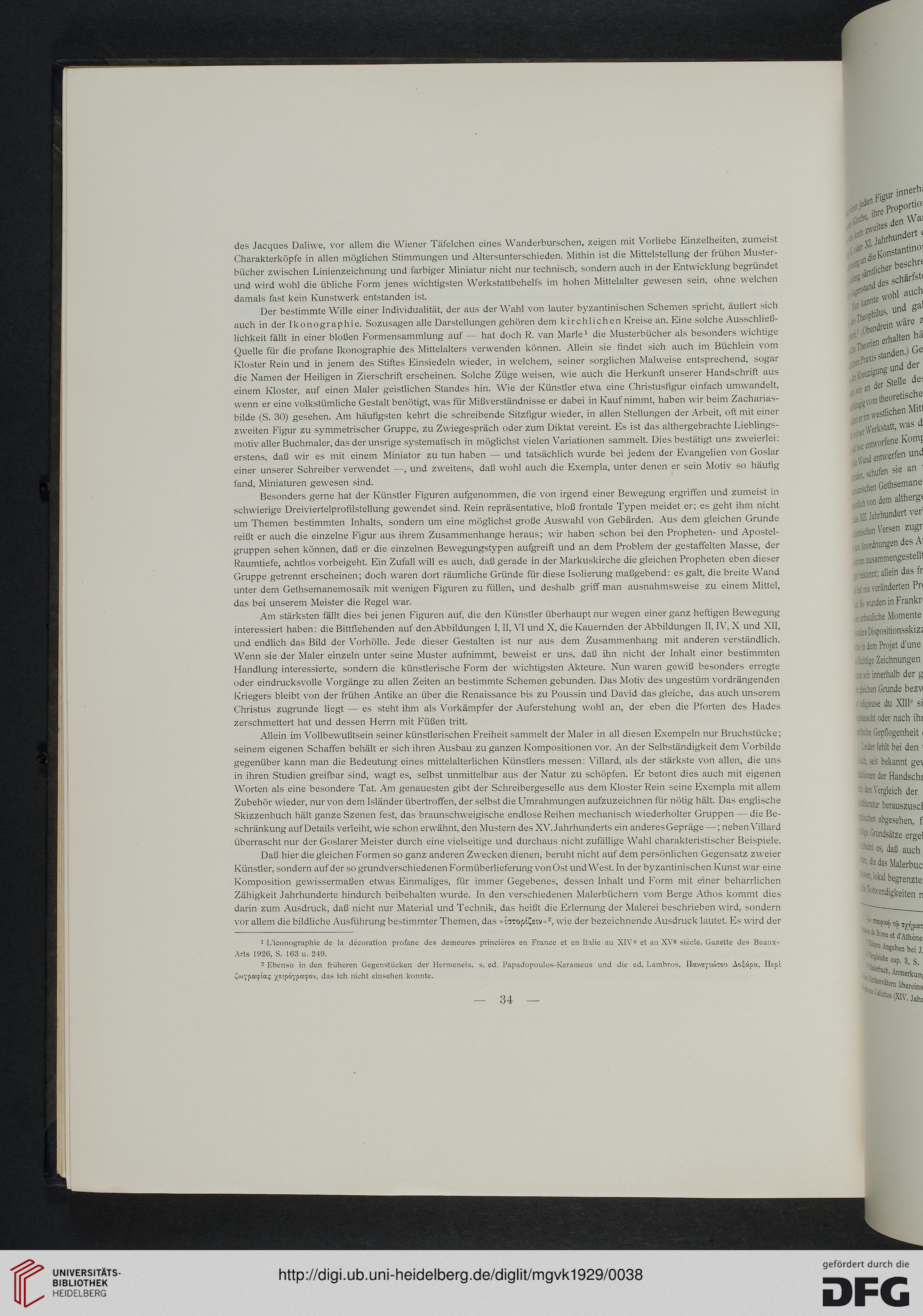des Jacques Daliwe, vor allem die Wiener Täfelchen eines Wanderburschen, zeigen mit Vorliebe Einzelheiten, zumeist
Charakterköpfe in allen möglichen Stimmungen und Altersunterschieden. Mithin ist die Mittelstellung der frühen Muster-
bücher zwischen Linienzeichnung und farbiger Miniatur nicht nur technisch, sondern auch in der Entwicklung begründet
und wird wohl die übliche Form jenes wichtigsten Werkstattbehelfs im hohen Mittelalter gewesen sein, ohne welchen
damals fast kein Kunstwerk entstanden ist.
Der bestimmte Wille einer Individualität, der aus der Wahl von lauter byzantinischen Schemen spricht, äußert sich
auch in der Ikonographie. Sozusagen alle Darstellungen gehören dem kirchlichen Kreise an. Eine solche Ausschließ-
lichkeit fällt in einer bloßen Formensammlung auf — hat doch R. van Marie1 die Musterbücher als besonders wichtige
Quelle für die profane Ikonographie des Mittelalters verwenden können. Allein sie findet sich auch im Büchlein vom
Kloster Rein und in jenem des Stiftes Einsiedeln wieder, in welchem, seiner sorglichen Malweise entsprechend, sogar
die Namen der Heiligen in Zierschrift erscheinen. Solche Züge weisen, wie auch die Herkunft unserer Handschrift aus
einem Kloster, auf einen Maler geistlichen Standes hin. Wie der Künstler etwa eine Christusfigur einfach umwandelt,
wenn er eine volkstümliche Gestalt benötigt, was für Mißverständnisse er dabei in Kauf nimmt, haben wir beim Zacharias-
bilde (S. 30) gesehen. Am häufigsten kehrt die schreibende Sitzfigur wieder, in allen Stellungen der Arbeit, oft mit einer
zweiten Figur zu symmetrischer Gruppe, zu Zwiegespräch oder zum Diktat vereint. Es ist das althergebrachte Lieblings-
motiv aller Buchmaler, das der unsrige systematisch in möglichst vielen Variationen sammelt. Dies bestätigt uns zweierlei:
erstens, daß wir es mit einem Miniator zu tun haben — und tatsächlich wurde bei jedem der Evangelien von Goslar
einer unserer Schreiber verwendet —, und zweitens, daß wohl auch die Exempla, unter denen er sein Motiv so häufig
fand, Miniaturen gewesen sind.
Besonders gerne hat der Künstler Figuren aufgenommen, die von irgend einer Bewegung ergriffen und zumeist in
schwierige Dreiviertelprofilstellung gewendet sind. Rein repräsentative, bloß frontale Typen meidet er; es geht ihm nicht
um Themen bestimmten Inhalts, sondern um eine möglichst große Auswahl von Gebärden. Aus dem gleichen Grunde
reißt er auch die einzelne Figur aus ihrem Zusammenhange heraus; wir haben schon bei den Propheten- und Apostel-
gruppen sehen können, daß er die einzelnen Bewegungstypen aufgreift und an dem Problem der gestaffelten Masse, der
Raumtiefe, achtlos vorbeigeht. Ein Zufall will es auch, daß gerade in der Markuskirche die gleichen Propheten eben dieser
Gruppe getrennt erscheinen; doch waren dort räumliche Gründe für diese Isolierung maßgebend: es galt, die breite Wand
unter dem Gethsemanemosaik mit wenigen Figuren zu füllen, und deshalb griff man ausnahmsweise zu einem Mittel,
das bei unserem Meister die Regel war.
Am stärksten fällt dies bei jenen Figuren auf, die den Künstler überhaupt nur wegen einer ganz heftigen Bewegung
interessiert haben: die Bittflehenden auf den Abbildungen I, II, VI und X, die Kauernden der Abbildungen II, IV, X und XII,
und endlich das Bild der Vorhölle. Jede dieser Gestalten ist nur aus dem Zusammenhang mit anderen verständlich.
Wenn sie der Maler einzeln unter seine Muster aufnimmt, beweist er uns, daß ihn nicht der Inhalt einer bestimmten
Handlung interessierte, sondern die künstlerische Form der wichtigsten Akteure. Nun waren gewiß besonders erregte
oder eindrucksvolle Vorgänge zu allen Zeiten an bestimmte Schemen gebunden. Das Motiv des ungestüm vordrängenden
Kriegers bleibt von der frühen Antike an über die Renaissance bis zu Poussin und David das gleiche, das auch unserem
Christus zugrunde liegt — es steht ihm als Vorkämpfer der Auferstehung wohl an, der eben die Pforten des Hades
zerschmettert hat und dessen Herrn mit Füßen tritt.
Allein im Vollbewußtsein seiner künstlerischen Freiheit sammelt der Maler in all diesen Exempeln nur Bruchstücke;
seinem eigenen Schaffen behält er sich ihren Ausbau zu ganzen Kompositionen vor. An der Selbständigkeit dem Vorbilde
gegenüber kann man die Bedeutung eines mittelalterlichen Künstlers messen: Villard, als der stärkste von allen, die uns
in ihren Studien greifbar sind, wagt es, selbst unmittelbar aus der Natur zu schöpfen. Er betont dies auch mit eigenen
Worten als eine besondere Tat. Am genauesten gibt der Schreibergeselle aus dem Kloster Rein seine Exempla mit allem
Zubehör wieder, nur von dem Isländer übertroffen, der selbst die Umrahmungen aufzuzeichnen für nötig hält. Das englische
Skizzenbuch hält ganze Szenen fest, das braunschweigische endlose Reihen mechanisch wiederholter Gruppen — die Be-
schränkung auf Details verleiht, wie schon erwähnt, den Mustern des XV. Jahrhunderts ein anderes Gepräge —; neben Villard
überrascht nur der Goslarer Meister durch eine vielseitige und durchaus nicht zufällige Wahl charakteristischer Beispiele.
Daß hier die gleichen Formen so ganz anderen Zwecken dienen, beruht nicht auf dem persönlichen Gegensatz zweier
Künstler, sondern auf der so grundverschiedenen Formüberlieferung von Ost und West. In der byzantinischen Kunst war eine
Komposition gewissermaßen etwas Einmaliges, für immer Gegebenes, dessen Inhalt und Form mit einer beharrlichen
Zähigkeit Jahrhunderte hindurch beibehalten wurde. In den verschiedenen Malerbüchern vom Berge Athos kommt dies
darin zum Ausdruck, daß nicht nur Material und Technik, das heißt die Erlernung der Malerei beschrieben wird, sondern
vor allem die bildliche Ausführung bestimmter Themen, das »iaioptCsiv«2, wie der bezeichnende Ausdruck lautet. Es wird der
I L'iconographie de la decoration profane des demeures princieres en France et en Italie au XlVe et au XV'e siecle. Gazette des Beaux-
Arts 1926, S. 163 u. 249.
- Ebenso in den früheren Gegenstücken der Hermeneia, s. ed. Papadopoulos-Kerameus und die ed. Lambros, Uma-/'.i!iT00 Ao£ipa, Ilspi
Ccufpcuptai; ^etpöypacpov, das ich nicht einsehen konnte.
— 34 —
-K Jahrhundert
^Konstant*0
*<cher beseht
* .desschärfst
'.l0bendrem
■„„ erhalten h
Theorien er""
' Ls standen.) &
theoretische
festlichen Mi«
Werkstatt, was
entworfene Korr
•siner
jhoc —
'.«andentwerfen un
^schufen sie an
, Gethsemane
^»ondemaltherg
Jahrhundert vet
'.^en Versen zugi
Anordnungen desA
(naisammengesteUl
bekannt; allein das fr
aie veränderten P:
1 So wurden in Franki
i abdiene Momente
irreDispositionsskiz
: r. dem Projet d'une
fettige Zeichnungen
■wir innerhalb der
-deichen Grunde bezv
"ijeuse du XIII1' s
anseht oder nach ih
nfedte Gepflogenheit
leider fehlt bei den
■i seit bekannt ge\
Änen der Handschi
"i den Vergleich der
Äratur herauszuscl
nen,
k Grundsätze ergel
es, daß auch
■adiedasMalerbuc
*«, lokal begrenzte
^Notwendigkeiten n
; *9t-Haben bei J
** cap. 3 s
'^■Anmericun,
:^»*m Übereins
Charakterköpfe in allen möglichen Stimmungen und Altersunterschieden. Mithin ist die Mittelstellung der frühen Muster-
bücher zwischen Linienzeichnung und farbiger Miniatur nicht nur technisch, sondern auch in der Entwicklung begründet
und wird wohl die übliche Form jenes wichtigsten Werkstattbehelfs im hohen Mittelalter gewesen sein, ohne welchen
damals fast kein Kunstwerk entstanden ist.
Der bestimmte Wille einer Individualität, der aus der Wahl von lauter byzantinischen Schemen spricht, äußert sich
auch in der Ikonographie. Sozusagen alle Darstellungen gehören dem kirchlichen Kreise an. Eine solche Ausschließ-
lichkeit fällt in einer bloßen Formensammlung auf — hat doch R. van Marie1 die Musterbücher als besonders wichtige
Quelle für die profane Ikonographie des Mittelalters verwenden können. Allein sie findet sich auch im Büchlein vom
Kloster Rein und in jenem des Stiftes Einsiedeln wieder, in welchem, seiner sorglichen Malweise entsprechend, sogar
die Namen der Heiligen in Zierschrift erscheinen. Solche Züge weisen, wie auch die Herkunft unserer Handschrift aus
einem Kloster, auf einen Maler geistlichen Standes hin. Wie der Künstler etwa eine Christusfigur einfach umwandelt,
wenn er eine volkstümliche Gestalt benötigt, was für Mißverständnisse er dabei in Kauf nimmt, haben wir beim Zacharias-
bilde (S. 30) gesehen. Am häufigsten kehrt die schreibende Sitzfigur wieder, in allen Stellungen der Arbeit, oft mit einer
zweiten Figur zu symmetrischer Gruppe, zu Zwiegespräch oder zum Diktat vereint. Es ist das althergebrachte Lieblings-
motiv aller Buchmaler, das der unsrige systematisch in möglichst vielen Variationen sammelt. Dies bestätigt uns zweierlei:
erstens, daß wir es mit einem Miniator zu tun haben — und tatsächlich wurde bei jedem der Evangelien von Goslar
einer unserer Schreiber verwendet —, und zweitens, daß wohl auch die Exempla, unter denen er sein Motiv so häufig
fand, Miniaturen gewesen sind.
Besonders gerne hat der Künstler Figuren aufgenommen, die von irgend einer Bewegung ergriffen und zumeist in
schwierige Dreiviertelprofilstellung gewendet sind. Rein repräsentative, bloß frontale Typen meidet er; es geht ihm nicht
um Themen bestimmten Inhalts, sondern um eine möglichst große Auswahl von Gebärden. Aus dem gleichen Grunde
reißt er auch die einzelne Figur aus ihrem Zusammenhange heraus; wir haben schon bei den Propheten- und Apostel-
gruppen sehen können, daß er die einzelnen Bewegungstypen aufgreift und an dem Problem der gestaffelten Masse, der
Raumtiefe, achtlos vorbeigeht. Ein Zufall will es auch, daß gerade in der Markuskirche die gleichen Propheten eben dieser
Gruppe getrennt erscheinen; doch waren dort räumliche Gründe für diese Isolierung maßgebend: es galt, die breite Wand
unter dem Gethsemanemosaik mit wenigen Figuren zu füllen, und deshalb griff man ausnahmsweise zu einem Mittel,
das bei unserem Meister die Regel war.
Am stärksten fällt dies bei jenen Figuren auf, die den Künstler überhaupt nur wegen einer ganz heftigen Bewegung
interessiert haben: die Bittflehenden auf den Abbildungen I, II, VI und X, die Kauernden der Abbildungen II, IV, X und XII,
und endlich das Bild der Vorhölle. Jede dieser Gestalten ist nur aus dem Zusammenhang mit anderen verständlich.
Wenn sie der Maler einzeln unter seine Muster aufnimmt, beweist er uns, daß ihn nicht der Inhalt einer bestimmten
Handlung interessierte, sondern die künstlerische Form der wichtigsten Akteure. Nun waren gewiß besonders erregte
oder eindrucksvolle Vorgänge zu allen Zeiten an bestimmte Schemen gebunden. Das Motiv des ungestüm vordrängenden
Kriegers bleibt von der frühen Antike an über die Renaissance bis zu Poussin und David das gleiche, das auch unserem
Christus zugrunde liegt — es steht ihm als Vorkämpfer der Auferstehung wohl an, der eben die Pforten des Hades
zerschmettert hat und dessen Herrn mit Füßen tritt.
Allein im Vollbewußtsein seiner künstlerischen Freiheit sammelt der Maler in all diesen Exempeln nur Bruchstücke;
seinem eigenen Schaffen behält er sich ihren Ausbau zu ganzen Kompositionen vor. An der Selbständigkeit dem Vorbilde
gegenüber kann man die Bedeutung eines mittelalterlichen Künstlers messen: Villard, als der stärkste von allen, die uns
in ihren Studien greifbar sind, wagt es, selbst unmittelbar aus der Natur zu schöpfen. Er betont dies auch mit eigenen
Worten als eine besondere Tat. Am genauesten gibt der Schreibergeselle aus dem Kloster Rein seine Exempla mit allem
Zubehör wieder, nur von dem Isländer übertroffen, der selbst die Umrahmungen aufzuzeichnen für nötig hält. Das englische
Skizzenbuch hält ganze Szenen fest, das braunschweigische endlose Reihen mechanisch wiederholter Gruppen — die Be-
schränkung auf Details verleiht, wie schon erwähnt, den Mustern des XV. Jahrhunderts ein anderes Gepräge —; neben Villard
überrascht nur der Goslarer Meister durch eine vielseitige und durchaus nicht zufällige Wahl charakteristischer Beispiele.
Daß hier die gleichen Formen so ganz anderen Zwecken dienen, beruht nicht auf dem persönlichen Gegensatz zweier
Künstler, sondern auf der so grundverschiedenen Formüberlieferung von Ost und West. In der byzantinischen Kunst war eine
Komposition gewissermaßen etwas Einmaliges, für immer Gegebenes, dessen Inhalt und Form mit einer beharrlichen
Zähigkeit Jahrhunderte hindurch beibehalten wurde. In den verschiedenen Malerbüchern vom Berge Athos kommt dies
darin zum Ausdruck, daß nicht nur Material und Technik, das heißt die Erlernung der Malerei beschrieben wird, sondern
vor allem die bildliche Ausführung bestimmter Themen, das »iaioptCsiv«2, wie der bezeichnende Ausdruck lautet. Es wird der
I L'iconographie de la decoration profane des demeures princieres en France et en Italie au XlVe et au XV'e siecle. Gazette des Beaux-
Arts 1926, S. 163 u. 249.
- Ebenso in den früheren Gegenstücken der Hermeneia, s. ed. Papadopoulos-Kerameus und die ed. Lambros, Uma-/'.i!iT00 Ao£ipa, Ilspi
Ccufpcuptai; ^etpöypacpov, das ich nicht einsehen konnte.
— 34 —
-K Jahrhundert
^Konstant*0
*<cher beseht
* .desschärfst
'.l0bendrem
■„„ erhalten h
Theorien er""
' Ls standen.) &
theoretische
festlichen Mi«
Werkstatt, was
entworfene Korr
•siner
jhoc —
'.«andentwerfen un
^schufen sie an
, Gethsemane
^»ondemaltherg
Jahrhundert vet
'.^en Versen zugi
Anordnungen desA
(naisammengesteUl
bekannt; allein das fr
aie veränderten P:
1 So wurden in Franki
i abdiene Momente
irreDispositionsskiz
: r. dem Projet d'une
fettige Zeichnungen
■wir innerhalb der
-deichen Grunde bezv
"ijeuse du XIII1' s
anseht oder nach ih
nfedte Gepflogenheit
leider fehlt bei den
■i seit bekannt ge\
Änen der Handschi
"i den Vergleich der
Äratur herauszuscl
nen,
k Grundsätze ergel
es, daß auch
■adiedasMalerbuc
*«, lokal begrenzte
^Notwendigkeiten n
; *9t-Haben bei J
** cap. 3 s
'^■Anmericun,
:^»*m Übereins