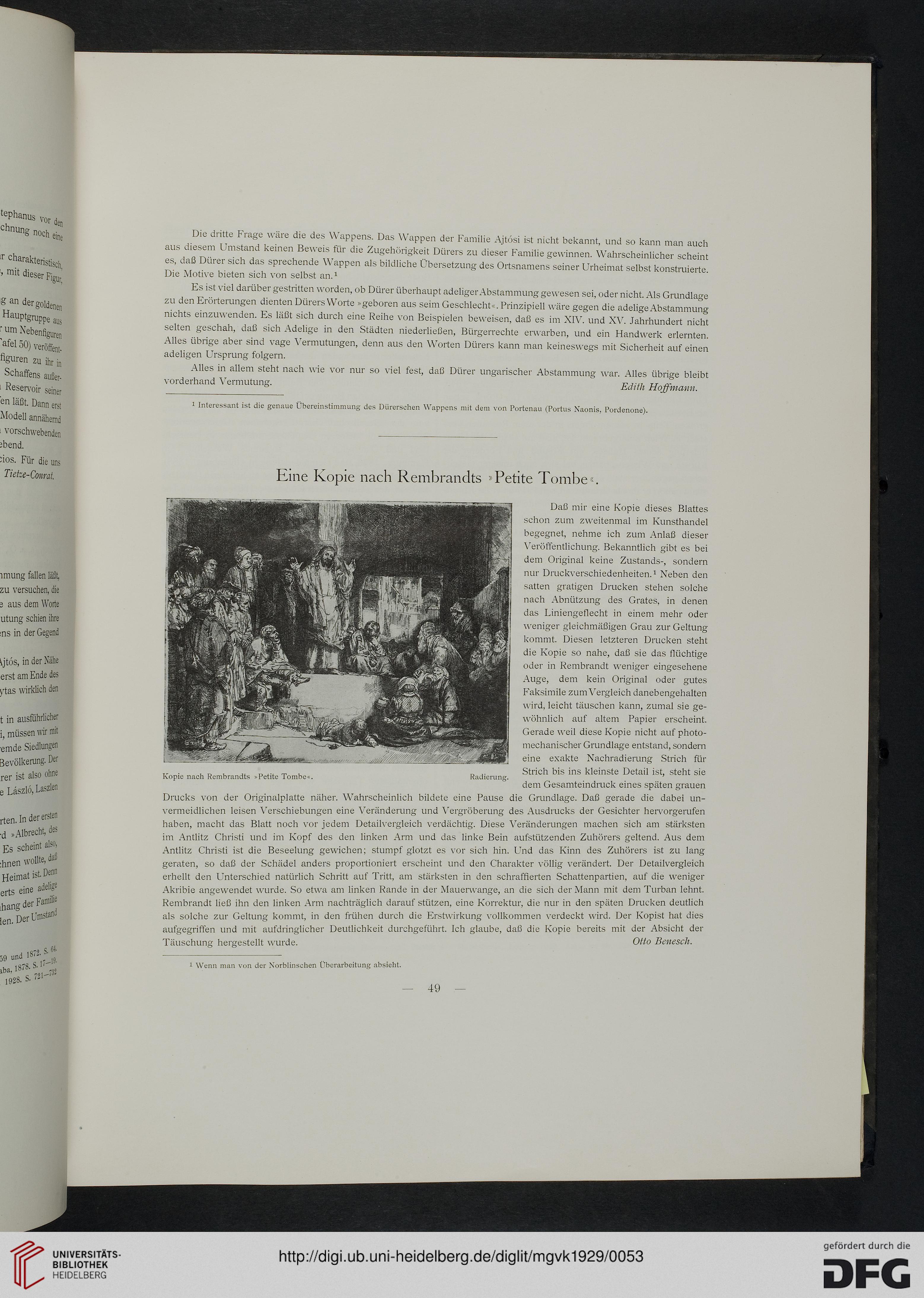tePhanus vor
chnungnocheil
eine
enstisch
ir charakti
.mit dieser FiÄ
lg an dergoldenen
Hauptgruppe aus
"um Nebenfiguren
afel 50) veröffent-
%uren zu ihr i„
Schaffens außer-
' Reservoir seiner
en läßt. Dann erst
Modell annähernd
i vorschwebenden
:bend.
:ios. Für die uns
Tietze-Cmrat.
lmung fallen läßt,
zu versuchen, die
3 aus dem Worte
utung schien ihre
:ns in der Gegend
tjtös, in der Nähe
erst am Ende des
ytas wirklich den
t in ausführlicher
i, müssen wir mit
■emde Siedlungen
Bevölkerung. Der
rer ist also ohne
eLäszlo.Laszlen
rten. In der ersten
■d »Albrecht, des
Es scheint also,
•hnen wollte, ^
Heimat ist- Den»
erts eine adelige
.hang der Fa<*
len-DerU^
j ,872. S.
1878. S-«'
,8. S. 72'"3'
Die dritte Frage wäre die des Wappens. Das Wappen der Familie Ajtösi ist nicht bekannt, und so kann man auch
aus diesem Umstand keinen Beweis für die Zugehörigkeit Dürers zu dieser Familie gewinnen. Wahrscheinlicher scheint
es, daß Dürer sich das sprechende Wappen als bildliche Übersetzung des Ortsnamens seiner Urheimat selbst konstruierte.
Die Motive bieten sich von selbst an.1
Es ist viel darüber gestritten worden, ob Dürer überhaupt adeliger Abstammung gewesen sei, oder nicht. Als Grundlage
zu den Erörterungen dienten Dürers Worte »geboren aus seim Geschlecht«. Prinzipiell wäre gegen die adelige Abstammung
nichts einzuwenden. Es läßt sich durch eine Reihe von Beispielen beweisen, daß es im XIV. und XV. Jahrhundert nicht
selten geschah, daß sich Adelige in den Städten niederließen, Bürgerrechte erwarben, und ein Handwerk erlernten.
Alles übrige aber sind vage Vermutungen, denn aus den Worten Dürers kann man keineswegs mit Sicherheit auf einen
adeligen Ursprung folgern.
Alles in allem steht nach wie vor nur so viel fest, daß Dürer ungarischer Abstammung war. Alles übrige bleibt
vorderhand Vermutung. Edith Hoffmann.
1 Interessant ist die genaue Übereinstimmung des Dürerschen Wappens mit dem von Portenau (Portus Kaonis, Pordenone).
Eine Kopie nach Rembrandts »Petite Tombe«.
Daß mir eine Kopie dieses Blattes
schon zum zweitenmal im Kunsthandel
begegnet, nehme ich zum Anlaß dieser
Veröffentlichung. Bekanntlich gibt es bei
dem Original keine Zustands-, sondern
nur Druckverschiedenheiten.1 Neben den
satten gratigen Drucken stehen solche
nach Abnützung des Grates, in denen
das Liniengeflecht in einem mehr oder
weniger gleichmäßigen Grau zur Geltung
kommt. Diesen letzteren Drucken steht
die Kopie so nahe, daß sie das flüchtige
oder in Rembrandt weniger eingesehene
Auge, dem kein Original oder gutes
Faksimile zum Vergleich danebengehalten
wird, leicht täuschen kann, zumal sie ge-
wöhnlich auf altem Papier erscheint.
Gerade weil diese Kopie nicht auf photo-
mechanischer Grundlage entstand, sondern
eine exakte Nachradierung Strich für
Strich bis ins kleinste Detail ist, steht sie
dem Gesamteindruck eines späten grauen
Drucks von der Originalplatte näher. Wahrscheinlich bildete eine Pause die Grundlage. Daß gerade die dabei un-
vermeidlichen leisen Verschiebungen eine Veränderung und Vergröberung des Ausdrucks der Gesichter hervorgerufen
haben, macht das Blatt noch vor jedem Detailvergleich verdächtig. Diese Veränderungen machen sich am stärksten
im Antlitz Christi und im Kopf des den linken Arm und das linke Bein aufstützenden Zuhörers geltend. Aus dem
Antlitz Christi ist die Beseelung gewichen; stumpf glotzt es vor sich hin. Und das Kinn des Zuhörers ist zu lang
geraten, so daß der Schädel anders proportioniert erscheint und den Charakter völlig verändert. Der Detailvergleich
erhellt den Unterschied natürlich Schritt auf Tritt, am stärksten in den schraffierten Schattenpartien, auf die weniger
Akribie angewendet wurde. So etwa am linken Rande in der Mauerwange, an die sich der Mann mit dem Turban lehnt.
Rembrandt ließ ihn den linken Arm nachträglich darauf stützen, eine Korrektur, die nur in den späten Drucken deutlich
als solche zur Geltung kommt, in den frühen durch die Erstwirkung vollkommen verdeckt wird. Der Kopist hat dies
aufgegriffen und mit aufdringlicher Deutlichkeit durchgeführt. Ich glaube, daß die Kopie bereits mit der Absicht der
Kopie nach Rembrandts »Petite Tombe«
Radierung.
iba
Täuschung hergestellt wurde.
i Wenn man von der Norblinschen Überarbeitung absieht.
Otto Benesch.
— 49
chnungnocheil
eine
enstisch
ir charakti
.mit dieser FiÄ
lg an dergoldenen
Hauptgruppe aus
"um Nebenfiguren
afel 50) veröffent-
%uren zu ihr i„
Schaffens außer-
' Reservoir seiner
en läßt. Dann erst
Modell annähernd
i vorschwebenden
:bend.
:ios. Für die uns
Tietze-Cmrat.
lmung fallen läßt,
zu versuchen, die
3 aus dem Worte
utung schien ihre
:ns in der Gegend
tjtös, in der Nähe
erst am Ende des
ytas wirklich den
t in ausführlicher
i, müssen wir mit
■emde Siedlungen
Bevölkerung. Der
rer ist also ohne
eLäszlo.Laszlen
rten. In der ersten
■d »Albrecht, des
Es scheint also,
•hnen wollte, ^
Heimat ist- Den»
erts eine adelige
.hang der Fa<*
len-DerU^
j ,872. S.
1878. S-«'
,8. S. 72'"3'
Die dritte Frage wäre die des Wappens. Das Wappen der Familie Ajtösi ist nicht bekannt, und so kann man auch
aus diesem Umstand keinen Beweis für die Zugehörigkeit Dürers zu dieser Familie gewinnen. Wahrscheinlicher scheint
es, daß Dürer sich das sprechende Wappen als bildliche Übersetzung des Ortsnamens seiner Urheimat selbst konstruierte.
Die Motive bieten sich von selbst an.1
Es ist viel darüber gestritten worden, ob Dürer überhaupt adeliger Abstammung gewesen sei, oder nicht. Als Grundlage
zu den Erörterungen dienten Dürers Worte »geboren aus seim Geschlecht«. Prinzipiell wäre gegen die adelige Abstammung
nichts einzuwenden. Es läßt sich durch eine Reihe von Beispielen beweisen, daß es im XIV. und XV. Jahrhundert nicht
selten geschah, daß sich Adelige in den Städten niederließen, Bürgerrechte erwarben, und ein Handwerk erlernten.
Alles übrige aber sind vage Vermutungen, denn aus den Worten Dürers kann man keineswegs mit Sicherheit auf einen
adeligen Ursprung folgern.
Alles in allem steht nach wie vor nur so viel fest, daß Dürer ungarischer Abstammung war. Alles übrige bleibt
vorderhand Vermutung. Edith Hoffmann.
1 Interessant ist die genaue Übereinstimmung des Dürerschen Wappens mit dem von Portenau (Portus Kaonis, Pordenone).
Eine Kopie nach Rembrandts »Petite Tombe«.
Daß mir eine Kopie dieses Blattes
schon zum zweitenmal im Kunsthandel
begegnet, nehme ich zum Anlaß dieser
Veröffentlichung. Bekanntlich gibt es bei
dem Original keine Zustands-, sondern
nur Druckverschiedenheiten.1 Neben den
satten gratigen Drucken stehen solche
nach Abnützung des Grates, in denen
das Liniengeflecht in einem mehr oder
weniger gleichmäßigen Grau zur Geltung
kommt. Diesen letzteren Drucken steht
die Kopie so nahe, daß sie das flüchtige
oder in Rembrandt weniger eingesehene
Auge, dem kein Original oder gutes
Faksimile zum Vergleich danebengehalten
wird, leicht täuschen kann, zumal sie ge-
wöhnlich auf altem Papier erscheint.
Gerade weil diese Kopie nicht auf photo-
mechanischer Grundlage entstand, sondern
eine exakte Nachradierung Strich für
Strich bis ins kleinste Detail ist, steht sie
dem Gesamteindruck eines späten grauen
Drucks von der Originalplatte näher. Wahrscheinlich bildete eine Pause die Grundlage. Daß gerade die dabei un-
vermeidlichen leisen Verschiebungen eine Veränderung und Vergröberung des Ausdrucks der Gesichter hervorgerufen
haben, macht das Blatt noch vor jedem Detailvergleich verdächtig. Diese Veränderungen machen sich am stärksten
im Antlitz Christi und im Kopf des den linken Arm und das linke Bein aufstützenden Zuhörers geltend. Aus dem
Antlitz Christi ist die Beseelung gewichen; stumpf glotzt es vor sich hin. Und das Kinn des Zuhörers ist zu lang
geraten, so daß der Schädel anders proportioniert erscheint und den Charakter völlig verändert. Der Detailvergleich
erhellt den Unterschied natürlich Schritt auf Tritt, am stärksten in den schraffierten Schattenpartien, auf die weniger
Akribie angewendet wurde. So etwa am linken Rande in der Mauerwange, an die sich der Mann mit dem Turban lehnt.
Rembrandt ließ ihn den linken Arm nachträglich darauf stützen, eine Korrektur, die nur in den späten Drucken deutlich
als solche zur Geltung kommt, in den frühen durch die Erstwirkung vollkommen verdeckt wird. Der Kopist hat dies
aufgegriffen und mit aufdringlicher Deutlichkeit durchgeführt. Ich glaube, daß die Kopie bereits mit der Absicht der
Kopie nach Rembrandts »Petite Tombe«
Radierung.
iba
Täuschung hergestellt wurde.
i Wenn man von der Norblinschen Überarbeitung absieht.
Otto Benesch.
— 49