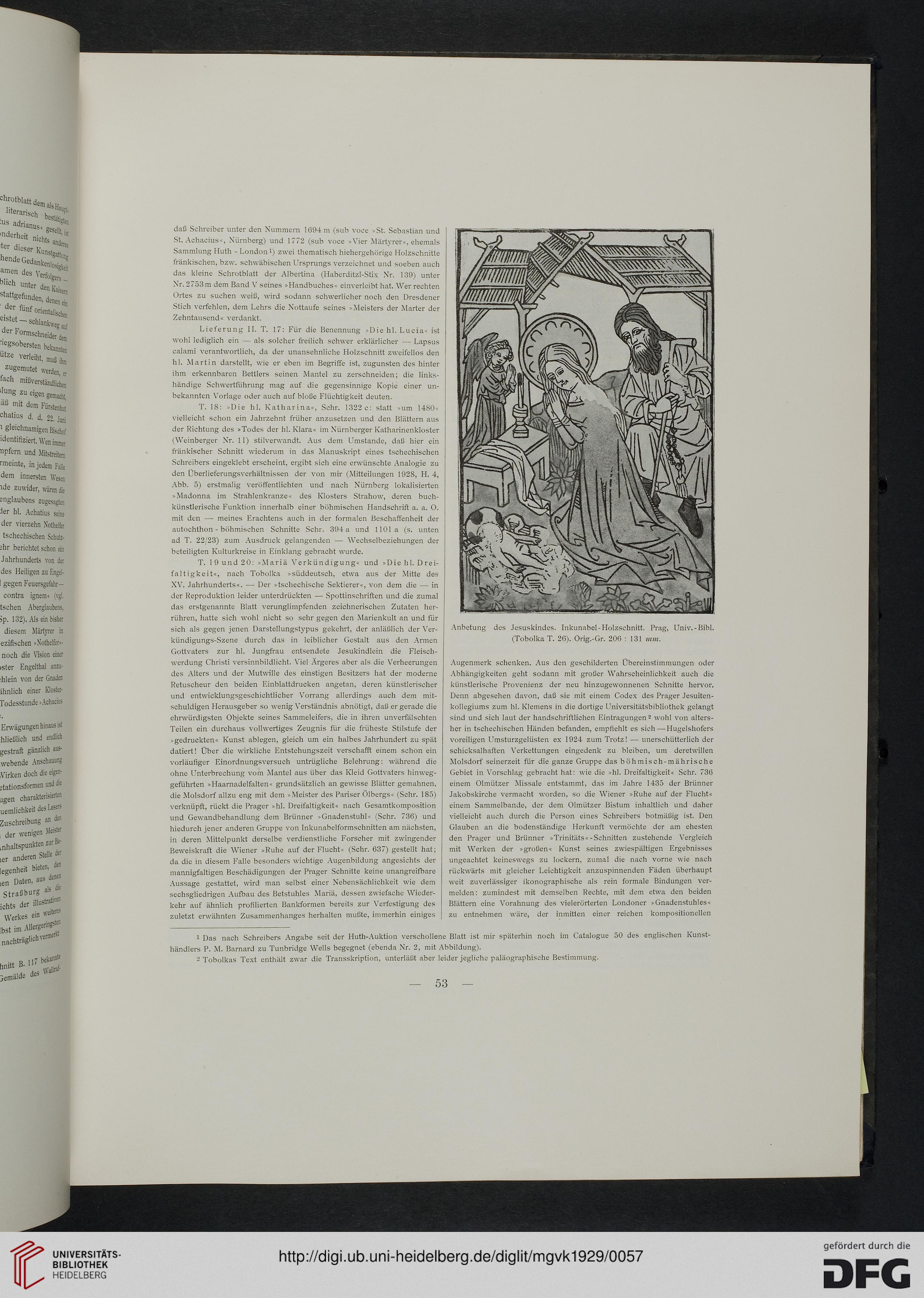daß Schreiber unter den Nummern 1694 m (sub voce »St. Sebastian und
St. Achacius«, Nürnberg) und 1772 (sub voce »Vier Märtyrer«, ehemals
Sammlung Huth - London *) zwei thematisch hiehergehörige Holzschnitte
fränkischen, bzw. schwäbischen Ursprungs verzeichnet und soeben auch
das kleine Schrotblatt der Albertina (Haberditzl-Stix Nr. 139) unter
Nr. 2753m dem Band V seines »Handbuches« einverleibt hat. Wer rechten
Ortes zu suchen weiß, wird sodann schwerlicher noch den Dresdener
Stich verfehlen, dem Lehrs die Nottaufe seines »Meisters der Marter der
Zehntausend« verdankt.
Lieferung II. T. 17: Für die Benennung »Die hl. Lucia« ist
wohl lediglich ein — als solcher freilich schwer erklärlicher — Lapsus
calami verantwortlich, da der unansehnliche Holzschnitt zweifellos den
hl. Martin darstellt, wie er eben im Begriffe ist, zugunsten des hinter
ihm erkennbaren Bettlers seinen Mantel zu zerschneiden; die links-
händige Schwertführimg mag auf die gegensinnige Kopie einer un-
bekannten Vorlage oder auch auf bloße Flüchtigkeit deuten.
T. 18: »Die hl. Katharina«, Sehr. 1322 c: statt «um 1480«
vielleicht schon ein Jahrzehnt früher anzusetzen und den Blättern aus
der Richtung des »Todes der hl. Klara« im Nürnberger Katharinenkloster
(Weinberger Nr. 11) stilverwandt. Aus dem Umstände, daß hier ein
fränkischer Schnitt wiederum in das Manuskript eines tschechischen
Schreibers eingeklebt erscheint, ergibt sich eine erwünschte Analogie zu
den Überlieferungsverhältnissen der von mir (Mitteilungen 1928, H. 4,
Abb. 5) erstmalig veröffentlichten und nach Nürnberg lokalisierten
»Madonna im Strahlenkranze« des Klosters Strahow, deren buch-
künstlerische Funktion innerhalb einer böhmischen Handschrift a. a. 0.
mit den — meines Erachtens auch in der formalen Beschaffenheit der
autochthon - böhmischen Schnitte Sehr. 394 a und 1101a (s. unten
ad T. 22/23) zum Ausdruck gelangenden — Wechselbeziehungen der
beteiligten Kulturkreise in Einklang gebracht wurde.
T. 19 und 20: »Maria Verkündigung« und »Die hl. Drei-
faltigkeit«, nach Tobolka »süddeutsch, etwa aus der Mitte des
XV. Jahrhunderts«. — Der »tschechische Sektierer«, von dem die — in
der Reproduktion leider unterdrückten — Spottinschriften und die zumal
das erstgenannte Blatt verunglimpfenden zeichnerischen Zutaten her-
rühren, hatte sich wohl nicht so sehr gegen den Marienkult an und für
sich als gegen jenen Darstellungstypus gekehrt, der anläßlich der Ver-
kündigungs-Szene durch das in leiblicher Gestalt aus den Armen
Gottvaters zur hl. Jungfrau entsendete Jesukindlein die Fleisch-
werdung Christi versinnbildlicht. Viel Ärgeres aber als die Verheerungen
des Alters und der Mutwille des einstigen Besitzers hat der moderne
Retuscheur den beiden Einblattdrucken angetan, deren künstlerischer
und entwicklungsgeschichtlicher Vorrang allerdings auch dem mit-
schuldigen Herausgeber so wenig Verständnis abnötigt, daß er gerade die
ehrwürdigsten Objekte seines Sammeleifers, die in ihren unverfälschten
Teilen ein durchaus vollwertiges Zeugnis für die früheste Stilstufe der
«gedruckten« Kunst ablegen, gleich um ein halbes Jahrhundert zu spät
datiert! Über die wirkliche Entstehungszeit verschafft einem schon ein
vorläufiger Einordnungsversuch untrügliche Belehrung: während die
ohne Unterbrechung vom Mantel aus über das Kleid Gottvaters hinweg-
geführten »Haarnadelfalten« grundsätzlich an gewisse Blätter gemahnen,
die Molsdorf allzu eng mit dem »Meister des Pariser Ölbergs« (Sehr. 185)
verknüpft, rückt die Prager »hl. Dreifaltigkeit« nach Gesamtkomposition
und Gewandbehandlung dem Brünner »Gnadenstuhl« (Sehr. 736) und
hiedurch jener anderen Gruppe von Inkunabelformschnitten am nächsten,
in deren Mittelpunkt derselbe verdienstliche Forscher mit zwingender
Beweiskraft die Wiener »Ruhe auf der Flucht« (Sehr. 637) gestellt hat;
da die in diesem Falle besonders wichtige Augenbildung angesichts der
mannigfaltigen Beschädigungen der Prager Schnitte keine unangreifbare
Aussage gestattet, wird man selbst einer Nebensächlichkeit wie dem
sechsgliedrigen Aufbau des Betstuhles Mariä, dessen zwiefache Wieder-
kehr auf ähnlich profilierten Bankformen bereits zur Verfestigung des
zuletzt erwähnten Zusammenhanges herhalten mußte, immerhin einiges
Anbetung des Jesuskindes. Inkunabel - Holzschnitt. Prag, Univ. - Bibl.
(Tobolka T. 26). Orig.-Gr. 206 : 131 mm.
Augenmerk schenken. Aus den geschilderten Übereinstimmungen oder
Abhängigkeiten geht sodann mit großer Wahrscheinlichkeit auch die
künstlerische Provenienz der neu hinzugewonnenen Schnitte hervor.
Denn abgesehen davon, daß sie mit einem Codex des Prager Jesuiten-
kollegiums zum hl. Klemens in die dortige Universitätsbibliothek gelangt
sind und sich laut der handschriftlichen Eintragungen " wohl von alters-
her in tschechischen Händen befanden, empfiehlt es sich—Hugelshofers
voreiligen Umsturzgelüsten ex 1924 zum Trotz! — unerschütterlich der
schicksalhaften Verkettungen eingedenk zu bleiben, um deretwillen
Molsdorf seinerzeit für die ganze Gruppe das böhmisch-mährische
Gebiet in Vorschlag gebracht hat: wie die »hl. Dreifaltigkeit« Sehr. 736
einem Olmützer Missale entstammt, das im Jahre 1435 der Brünner
Jakobskirche vermacht worden, so die Wiener »Ruhe auf der Flucht«
einem Sammelbande, der dem Olmützer Bistum inhaltlich und daher
vielleicht auch durch die Person eines Schreibers botmäßig ist. Den
Glauben an die bodenständige Herkunft vermöchte der am ehesten
den Präger und Brünner »Trinitäts«-Schnitten zustehende Vergleich
mit Werken der »großen« Kunst seines zwiespältigen Ergebnisses
ungeachtet keineswegs zu lockern, zumal die nach vorne wie nach
rückwärts mit gleicher Leichtigkeit anzuspinnenden Fäden überhaupt
weit zuverlässiger ikonographische als rein formale Bindungen ver-
melden: zumindest mit demselben Rechte, mit dem etwa den beiden
Blättern eine Vorahnung des vielerörterten Londoner »Gnadenstuhles«
zu entnehmen wäre, der inmitten einer reichen kompositioneilen
1 Das nach Schreibers Angabe seit der Huth-Auktion verschollene Blatt ist mir späterhin noch im Catalogue 50 des englischen Kunst-
händlers P. M. Barnard zu Tunbridge Wells begegnet (ebenda Nr. 2, mit Abbildung).
2 Tobolkas Text enthält zwar die Transskription, unterläßt aber leider jegliche paläographische Bestimmung.
St. Achacius«, Nürnberg) und 1772 (sub voce »Vier Märtyrer«, ehemals
Sammlung Huth - London *) zwei thematisch hiehergehörige Holzschnitte
fränkischen, bzw. schwäbischen Ursprungs verzeichnet und soeben auch
das kleine Schrotblatt der Albertina (Haberditzl-Stix Nr. 139) unter
Nr. 2753m dem Band V seines »Handbuches« einverleibt hat. Wer rechten
Ortes zu suchen weiß, wird sodann schwerlicher noch den Dresdener
Stich verfehlen, dem Lehrs die Nottaufe seines »Meisters der Marter der
Zehntausend« verdankt.
Lieferung II. T. 17: Für die Benennung »Die hl. Lucia« ist
wohl lediglich ein — als solcher freilich schwer erklärlicher — Lapsus
calami verantwortlich, da der unansehnliche Holzschnitt zweifellos den
hl. Martin darstellt, wie er eben im Begriffe ist, zugunsten des hinter
ihm erkennbaren Bettlers seinen Mantel zu zerschneiden; die links-
händige Schwertführimg mag auf die gegensinnige Kopie einer un-
bekannten Vorlage oder auch auf bloße Flüchtigkeit deuten.
T. 18: »Die hl. Katharina«, Sehr. 1322 c: statt «um 1480«
vielleicht schon ein Jahrzehnt früher anzusetzen und den Blättern aus
der Richtung des »Todes der hl. Klara« im Nürnberger Katharinenkloster
(Weinberger Nr. 11) stilverwandt. Aus dem Umstände, daß hier ein
fränkischer Schnitt wiederum in das Manuskript eines tschechischen
Schreibers eingeklebt erscheint, ergibt sich eine erwünschte Analogie zu
den Überlieferungsverhältnissen der von mir (Mitteilungen 1928, H. 4,
Abb. 5) erstmalig veröffentlichten und nach Nürnberg lokalisierten
»Madonna im Strahlenkranze« des Klosters Strahow, deren buch-
künstlerische Funktion innerhalb einer böhmischen Handschrift a. a. 0.
mit den — meines Erachtens auch in der formalen Beschaffenheit der
autochthon - böhmischen Schnitte Sehr. 394 a und 1101a (s. unten
ad T. 22/23) zum Ausdruck gelangenden — Wechselbeziehungen der
beteiligten Kulturkreise in Einklang gebracht wurde.
T. 19 und 20: »Maria Verkündigung« und »Die hl. Drei-
faltigkeit«, nach Tobolka »süddeutsch, etwa aus der Mitte des
XV. Jahrhunderts«. — Der »tschechische Sektierer«, von dem die — in
der Reproduktion leider unterdrückten — Spottinschriften und die zumal
das erstgenannte Blatt verunglimpfenden zeichnerischen Zutaten her-
rühren, hatte sich wohl nicht so sehr gegen den Marienkult an und für
sich als gegen jenen Darstellungstypus gekehrt, der anläßlich der Ver-
kündigungs-Szene durch das in leiblicher Gestalt aus den Armen
Gottvaters zur hl. Jungfrau entsendete Jesukindlein die Fleisch-
werdung Christi versinnbildlicht. Viel Ärgeres aber als die Verheerungen
des Alters und der Mutwille des einstigen Besitzers hat der moderne
Retuscheur den beiden Einblattdrucken angetan, deren künstlerischer
und entwicklungsgeschichtlicher Vorrang allerdings auch dem mit-
schuldigen Herausgeber so wenig Verständnis abnötigt, daß er gerade die
ehrwürdigsten Objekte seines Sammeleifers, die in ihren unverfälschten
Teilen ein durchaus vollwertiges Zeugnis für die früheste Stilstufe der
«gedruckten« Kunst ablegen, gleich um ein halbes Jahrhundert zu spät
datiert! Über die wirkliche Entstehungszeit verschafft einem schon ein
vorläufiger Einordnungsversuch untrügliche Belehrung: während die
ohne Unterbrechung vom Mantel aus über das Kleid Gottvaters hinweg-
geführten »Haarnadelfalten« grundsätzlich an gewisse Blätter gemahnen,
die Molsdorf allzu eng mit dem »Meister des Pariser Ölbergs« (Sehr. 185)
verknüpft, rückt die Prager »hl. Dreifaltigkeit« nach Gesamtkomposition
und Gewandbehandlung dem Brünner »Gnadenstuhl« (Sehr. 736) und
hiedurch jener anderen Gruppe von Inkunabelformschnitten am nächsten,
in deren Mittelpunkt derselbe verdienstliche Forscher mit zwingender
Beweiskraft die Wiener »Ruhe auf der Flucht« (Sehr. 637) gestellt hat;
da die in diesem Falle besonders wichtige Augenbildung angesichts der
mannigfaltigen Beschädigungen der Prager Schnitte keine unangreifbare
Aussage gestattet, wird man selbst einer Nebensächlichkeit wie dem
sechsgliedrigen Aufbau des Betstuhles Mariä, dessen zwiefache Wieder-
kehr auf ähnlich profilierten Bankformen bereits zur Verfestigung des
zuletzt erwähnten Zusammenhanges herhalten mußte, immerhin einiges
Anbetung des Jesuskindes. Inkunabel - Holzschnitt. Prag, Univ. - Bibl.
(Tobolka T. 26). Orig.-Gr. 206 : 131 mm.
Augenmerk schenken. Aus den geschilderten Übereinstimmungen oder
Abhängigkeiten geht sodann mit großer Wahrscheinlichkeit auch die
künstlerische Provenienz der neu hinzugewonnenen Schnitte hervor.
Denn abgesehen davon, daß sie mit einem Codex des Prager Jesuiten-
kollegiums zum hl. Klemens in die dortige Universitätsbibliothek gelangt
sind und sich laut der handschriftlichen Eintragungen " wohl von alters-
her in tschechischen Händen befanden, empfiehlt es sich—Hugelshofers
voreiligen Umsturzgelüsten ex 1924 zum Trotz! — unerschütterlich der
schicksalhaften Verkettungen eingedenk zu bleiben, um deretwillen
Molsdorf seinerzeit für die ganze Gruppe das böhmisch-mährische
Gebiet in Vorschlag gebracht hat: wie die »hl. Dreifaltigkeit« Sehr. 736
einem Olmützer Missale entstammt, das im Jahre 1435 der Brünner
Jakobskirche vermacht worden, so die Wiener »Ruhe auf der Flucht«
einem Sammelbande, der dem Olmützer Bistum inhaltlich und daher
vielleicht auch durch die Person eines Schreibers botmäßig ist. Den
Glauben an die bodenständige Herkunft vermöchte der am ehesten
den Präger und Brünner »Trinitäts«-Schnitten zustehende Vergleich
mit Werken der »großen« Kunst seines zwiespältigen Ergebnisses
ungeachtet keineswegs zu lockern, zumal die nach vorne wie nach
rückwärts mit gleicher Leichtigkeit anzuspinnenden Fäden überhaupt
weit zuverlässiger ikonographische als rein formale Bindungen ver-
melden: zumindest mit demselben Rechte, mit dem etwa den beiden
Blättern eine Vorahnung des vielerörterten Londoner »Gnadenstuhles«
zu entnehmen wäre, der inmitten einer reichen kompositioneilen
1 Das nach Schreibers Angabe seit der Huth-Auktion verschollene Blatt ist mir späterhin noch im Catalogue 50 des englischen Kunst-
händlers P. M. Barnard zu Tunbridge Wells begegnet (ebenda Nr. 2, mit Abbildung).
2 Tobolkas Text enthält zwar die Transskription, unterläßt aber leider jegliche paläographische Bestimmung.