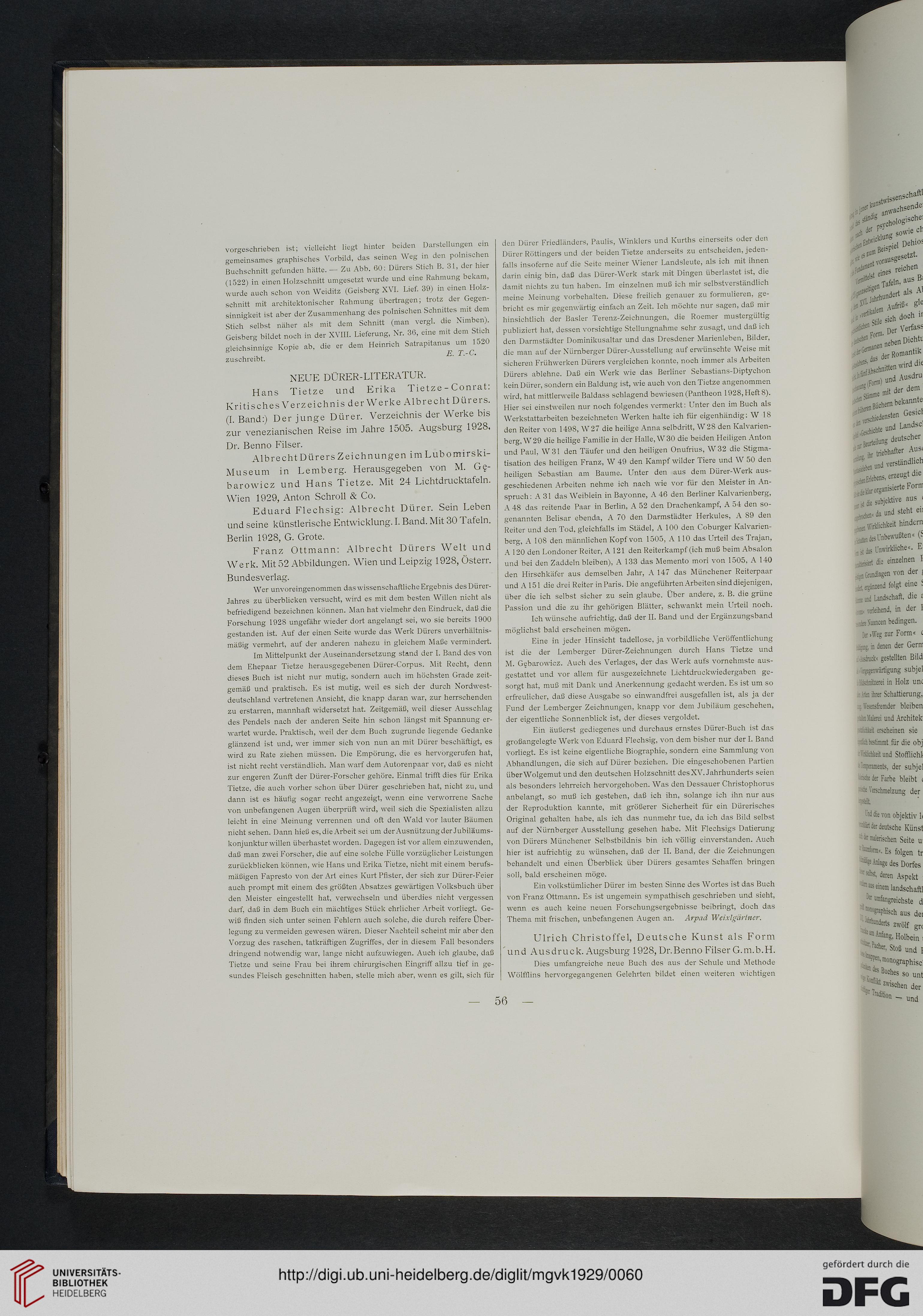vorgeschrieben ist; vielleicht liegt hinter beiden Dursteilungen ein
gemeinsames graphisches Vorbild, das seinen Weg in den polnischen
Buchschnitt gefunden hätte. — Zu Abb. 60: Dürers Stich B. 31, der hier
(1522) in einen Holzschnitt umgesetzt wurde und eine Rahmung bekam,
wurde auch schon von Weiditz (Geisberg XVI. Lief. 39) in einen Holz-
schnitt mit architektonischer Rahmung übertragen; trotz der Gegen-
sinnigkeit ist aber der Zusammenhang des polnischen Schnittes mit dem
Stich selbst näher als mit dem Schnitt (man vergl. die Nimben).
Geisberg bildet noch in der XVIII. Lieferung, Nr. 36, eine mit dem Stich
gleichsinnige Kopie ab, die er dem Heinrich Satrapilanus um 1520
zuschreibt. K T-'C-
NEUE DÜRER-LITERATUR.
Hans Tietze und Erika Tietze - Conrat:
Kritisches Verzeichnis der Werke Albrecht Dürers.
(I. Band:) Der junge Dürer. Verzeichnis der Werke bis
zur venezianischen Reise im Jahre 1505. Augsburg 1928,
Dr. Benno Filser.
Albrecht Dürers Zeichnungen im Lubomirski-
Museum in Lemberg. Herausgegeben von M. G$-
barowicz und Hans Tietze. Mit 24 Lichtdrucktafeln.
Wien 1929, Anton Schroll & Co.
Eduard Flechsig: Albrecht Dürer. Sein Leben
und seine künstlerische Entwicklung. I. Band. Mit 30 Tafeln.
Berlin 1928, G. Grote.
Franz Ottmann: Albrecht Dürers Welt und
Werk. Mit52 Abbildungen. Wien und Leipzig 1928, Österr.
Bundesverlag.
Wer unvoreingenommen das wissenschaftliche Ergebnis des Dürer-
Jahres zu überblicken versucht, wird es mit dem besten Willen nicht als
befriedigend bezeichnen können. Man hat vielmehr den Eindruck, daÜ die
Forschung 192S ungefähr wieder dort angelangt sei, wo sie bereits 1900
gestanden ist. Auf der einen Seite wurde das Werk Dürers unverhältnis-
mäßig vermehrt, auf der anderen nahezu in gleichem Maße vermindert.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand der I. Band des von
dem Ehepaar Tietze herausgegebenen Dürer-Corpus. Mit Recht, denn
dieses Buch ist nicht nur mutig, sondern auch im höchsten Grade zeit-
gemäß und praktisch. Es ist mutig, weil es sich der durch Nordwest-
deutschland vertretenen Ansicht, die knapp daran war, zur herrschenden
zu erstarren, mannhaft widersetzt hat. Zeitgemäß, weil dieser Ausschlag
des Pendels nach der anderen Seite hin schon längst mit Spannung er-
wartet wurde. Praktisch, weil der dem Buch zugrunde liegende Gedanke
glänzend ist und, wer immer sich von nun an mit Dürer beschäftigt, es
wird zu Rate ziehen müssen. Die Empörung, die es hervorgerufen hat,
ist nicht recht verständlich. Man warf dem Autorenpaar vor, daß es nicht
zur engeren Zunft der Dürer-Forscher gehöre. Einmal trifft dies für Erika
Tietze. die auch vorher schon über Dürer geschrieben hat, nicht zu, und
dann ist es häufig sogar recht angezeigt, wenn eine verworrene Sache
von unbefangenen Augen überprüft wird, weil sich die Spezialisten allzu
leicht in eine Meinung verrennen und oft den Wald vor lauter Bäumen
nicht sehen. Dann hieß es, die Arbeit sei um der Ausnützung der Jubiläums-
konjunktur willen überhastet worden. Dagegen ist vor allem einzuwenden,
daß man zwei Forscher, die auf eine solche Fülle vorzüglicher Leistungen
zurückblicken können, wie Hans und Erika Tietze, nicht mit einem berufs-
mäßigen Fapresto von der Art eines Kurt Pfisler, der sich zur Dürer-Feier
auch prompt mit einem des größten Absatzes gewärtigen Volksbuch über
den Meister eingestellt hat, verwechseln und überdies nicht vergessen
darf, daß in dem Buch ein mächtiges Stück ehrlicher Arbeit vorliegt. Ge-
wiß finden sich unter seinen Fehlern auch solche, die durch reifere Über-
legung zu vermeiden gewesen wären. Dieser Nachteil scheint mir aber den
Vorzug des raschen, tatkräftigen Zugriffes, der in diesem Fall besonders
dringend notwendig war, lange nicht aufzuwiegen. Auch ich glaube, daß
Tietze und seine Frau bei ihrem chirurgischen Eingriff allzu tief in ge-
sundes Fleisch geschnitten haben, stelle mich aber, wenn es gilt, sich für
den Dürer Friedländcrs, Paulis, Winklers und Kurths einerseits oder den
Dürer Röttingers und der beiden Tietze anderseits zu entscheiden, jeden-
falls insoferne auf die Seite meiner Wiener Landsleute, als ich mit ihnen
darin einig bin, daß das Dürer-Werk stark mit Dingen überlastet ist, die
damit nichts zu tun haben. Im einzelnen muß ich mir selbstverständlich
meine Meinung vorbehalten. Diese freilich genauer zu formulieren, ge-
bricht es mir gegenwärtig einfach an Zeit. Ich möchte nur sagen, daß mir
hinsichtlich der Basler Terenz-Zeichnungen, die Roemer mustergültig
publiziert hat, dessen vorsichtige Stellungnahme sehr zusagt, und daß ich
den Darmstädter Dominikusaltar und das Dresdener Marienleben, Bilder,
die man auf der Nürnberger Dürer-Ausstellung auf erwünschte Weise mit
sicheren Frühwerken Dürers vergleichen konnte, noch immer als Arbeiten
Dürers ablehne. Daß ein Werk wie das Berliner Sebastians-Diptychon
kein Dürer, sondern ein Baidung ist, wie auch von den Tietze angenommen
wird, hat mittlerweile Baldass schlagend bewiesen (Pantheon 1928, Heft 8).
Hier sei einstweilen nur noch folgendes vermerkt: Unter den im Buch als
Werkstattarbeiten bezeichneten Werken halte ich für eigenhändig: W 18
den Reiter von 1498, W27 die heilige Anna selbdritt, W2S den Kalvarien-
berg. W29 die heilige Familie in der Halle, W 30 die beiden Heiligen Anton
und Paul. W31 den Täufer und den heiligen Onufrius, W32 die Stigma-
tisation des heiligen Franz, W 49 den Kampf wilder Tiere und W 50 den
heiligen Sebastian am Baume. Unter den aus dem Dürer-Werk aus-
geschiedenen Arbeiten nehme ich nach wie vor für den Meister in An-
spruch : A 31 das Weiblein in Bavonne, A 46 den Berliner Kalvarienberg,
A 48 das reitende Paar in Berlin, A 52 den Drachenkampf, A 54 den so-
genannten Beiisar ebenda, A 70 den Darmstädter Herkules, A 89 den
Reiter und den Tod, gleichfalls im Stadel, A 100 den Coburger Kalvarien-
berg, A 108 den männlichen Kopf von 1505, A 110 das Urteil des Trajan,
A 120 den Londoner Reiter, A 121 den Reiterkampf (ich muß beim Absalon
und bei den Zaddeln bleiben), A 133 das Memento mori von 1505, A 140
den Hirschkäfer aus demselben Jahr, A 147 das Münchener Reiterpaar
und A 151 die drei Reiter in Paris. Die angeführten Arbeiten sind diejenigen,
über die ich selbst sicher zu sein glaube. Über andere, z. B. die grüne
Passion und die zu ihr gehörigen Blätter, schwankt mein Urteil noch.
Ich wünsche aufrichtig, daß der II. Band und der Ergänzungsband
möglichst bald erscheinen mögen.
Eine in jeder Hinsicht tadellose, ja vorbildliche Veröffentlichung
ist die der Lemberger Dürer-Zeichnungen durch Hans Tietze und
M. Gebarowicz. Auch des Verlages, der das Werk aufs vornehmste aus-
gestattet und vor allem für ausgezeichnete Lichtdruckwiedergaben ge-
sorgt hat, muß mit Dank und Anerkennung gedacht werden. Es ist um so
erfreulicher, daß diese Ausgabe so einwandfrei ausgefallen ist, als ja der
Fund der Lemberger Zeichnungen, knapp vor dem Jubiläum geschehen,
der eigentliche Sonnenblick ist, der dieses vergoldet.
Ein äußerst gediegenes und durchaus ernstes Dürer-Buch ist das
großangelegte Werk von Eduard Flechsig, von dem bisher nur der I. Band
vorliegt. Es ist keine eigentliche Biographie, sondern eine Sammlung von
Abhandlungen, die sich auf Dürer beziehen. Die eingeschobenen Partien
überWoIgemut und den deutschen Holzschnitt des XV. Jahrhunderts seien
als besonders lehrreich hervorgehoben. Was den Dessauer Christophorus
anbelangt, so muß ich gestehen, daß ich ihn, solange ich ihn nur aus
der Reproduktion kannte, mit größerer Sicherheit für ein Dürerisches
Original gehalten habe, als ich das nunmehr tue, da ich das Bild selbst
auf der Nürnberger Ausstellung gesehen habe. Mit Flechsigs Datierung
von Dürers Münchener Selbstbildnis bin ich völlig einverstanden. Auch
hier ist aufrichtig zu wünschen, daß der IL Band, der die Zeichnungen
behandelt und einen Überblick über Dürers gesamtes Schaffen bringen
soll, bald erscheinen möge.
Ein volkstümlicher Dürer im besten Sinne des Wortes ist das Buch
von Franz Ottmann. Es ist ungemein sympathisch geschrieben und sieht,
wenn es auch keine neuen Forschungsergebnisse beibringt, doch das
Thema mit frischen, unbefangenen Augen an. Arpad Weixlgärtner.
Ulrich Christoffel, Deutsche Kunst als Form
und Ausdruck. Augsburg 1928, Dr.Benno Filser G.m.b.H.
Dies umfangreiche neue Buch des aus der Schule und Methode
Wölfllins hervorgegangenen Gelehrten bildet einen weiteren wichtigen
Hrissenschaft1
„erWn* h«nde
CS50**
" Beispiel D*<«
i'fJ sich doch, .
i**' Der Verfaß
:>*lFOrffl,„! n Dicht,
. stimme mit «r
; feisten Gcsict
■?*h.eundUndsc
, deutscher
r Ausi
ländlich
ihr
,<!*»»«<'»rsl
JWS, erzeugte
„Unorganisierte Fora
-stie subjektive aus .
^ da und steht eil
mrklichkeit hindern
^ des »wußten« (5
.s Iis Unwirkliche.. E
jfeiHt * einzelnen I
Gnindlagen von der |
giftend folgt eine !
od Landschaft, die :
■i verleihend, in der I
■st Saucen bedingen.
M »Weg zur Form« (
_-;} in Jenen der Gent
'lataek« gestellten Bild
irtigimg subjel
:Mmlzerei in Holz um
■'r~ ihrer Schattierung,
. feiisfremder bleiben
.2 Malerei und Architek
-dieit erscheinen sie
-1 bestimmt für die obj
tUkA und Stofflich!
'qsnmeats, der subjel
■"-•ii Jet Farbe bleibt i
der
56
U die von objektiv 1.
"* der deutsche Künst
Malerischen Seite u
"*■>•■ Es folgen tr
% .Wage des Dorfes
deren Aspekt
einem landschaftl
^ umfangreichste d
":'%aphisch aus de,
'^»derts Wölf gr,
Holbein
*P*,SMundI
;*.m0nographisc
< !SB*sso unt
gehender
gemeinsames graphisches Vorbild, das seinen Weg in den polnischen
Buchschnitt gefunden hätte. — Zu Abb. 60: Dürers Stich B. 31, der hier
(1522) in einen Holzschnitt umgesetzt wurde und eine Rahmung bekam,
wurde auch schon von Weiditz (Geisberg XVI. Lief. 39) in einen Holz-
schnitt mit architektonischer Rahmung übertragen; trotz der Gegen-
sinnigkeit ist aber der Zusammenhang des polnischen Schnittes mit dem
Stich selbst näher als mit dem Schnitt (man vergl. die Nimben).
Geisberg bildet noch in der XVIII. Lieferung, Nr. 36, eine mit dem Stich
gleichsinnige Kopie ab, die er dem Heinrich Satrapilanus um 1520
zuschreibt. K T-'C-
NEUE DÜRER-LITERATUR.
Hans Tietze und Erika Tietze - Conrat:
Kritisches Verzeichnis der Werke Albrecht Dürers.
(I. Band:) Der junge Dürer. Verzeichnis der Werke bis
zur venezianischen Reise im Jahre 1505. Augsburg 1928,
Dr. Benno Filser.
Albrecht Dürers Zeichnungen im Lubomirski-
Museum in Lemberg. Herausgegeben von M. G$-
barowicz und Hans Tietze. Mit 24 Lichtdrucktafeln.
Wien 1929, Anton Schroll & Co.
Eduard Flechsig: Albrecht Dürer. Sein Leben
und seine künstlerische Entwicklung. I. Band. Mit 30 Tafeln.
Berlin 1928, G. Grote.
Franz Ottmann: Albrecht Dürers Welt und
Werk. Mit52 Abbildungen. Wien und Leipzig 1928, Österr.
Bundesverlag.
Wer unvoreingenommen das wissenschaftliche Ergebnis des Dürer-
Jahres zu überblicken versucht, wird es mit dem besten Willen nicht als
befriedigend bezeichnen können. Man hat vielmehr den Eindruck, daÜ die
Forschung 192S ungefähr wieder dort angelangt sei, wo sie bereits 1900
gestanden ist. Auf der einen Seite wurde das Werk Dürers unverhältnis-
mäßig vermehrt, auf der anderen nahezu in gleichem Maße vermindert.
Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung stand der I. Band des von
dem Ehepaar Tietze herausgegebenen Dürer-Corpus. Mit Recht, denn
dieses Buch ist nicht nur mutig, sondern auch im höchsten Grade zeit-
gemäß und praktisch. Es ist mutig, weil es sich der durch Nordwest-
deutschland vertretenen Ansicht, die knapp daran war, zur herrschenden
zu erstarren, mannhaft widersetzt hat. Zeitgemäß, weil dieser Ausschlag
des Pendels nach der anderen Seite hin schon längst mit Spannung er-
wartet wurde. Praktisch, weil der dem Buch zugrunde liegende Gedanke
glänzend ist und, wer immer sich von nun an mit Dürer beschäftigt, es
wird zu Rate ziehen müssen. Die Empörung, die es hervorgerufen hat,
ist nicht recht verständlich. Man warf dem Autorenpaar vor, daß es nicht
zur engeren Zunft der Dürer-Forscher gehöre. Einmal trifft dies für Erika
Tietze. die auch vorher schon über Dürer geschrieben hat, nicht zu, und
dann ist es häufig sogar recht angezeigt, wenn eine verworrene Sache
von unbefangenen Augen überprüft wird, weil sich die Spezialisten allzu
leicht in eine Meinung verrennen und oft den Wald vor lauter Bäumen
nicht sehen. Dann hieß es, die Arbeit sei um der Ausnützung der Jubiläums-
konjunktur willen überhastet worden. Dagegen ist vor allem einzuwenden,
daß man zwei Forscher, die auf eine solche Fülle vorzüglicher Leistungen
zurückblicken können, wie Hans und Erika Tietze, nicht mit einem berufs-
mäßigen Fapresto von der Art eines Kurt Pfisler, der sich zur Dürer-Feier
auch prompt mit einem des größten Absatzes gewärtigen Volksbuch über
den Meister eingestellt hat, verwechseln und überdies nicht vergessen
darf, daß in dem Buch ein mächtiges Stück ehrlicher Arbeit vorliegt. Ge-
wiß finden sich unter seinen Fehlern auch solche, die durch reifere Über-
legung zu vermeiden gewesen wären. Dieser Nachteil scheint mir aber den
Vorzug des raschen, tatkräftigen Zugriffes, der in diesem Fall besonders
dringend notwendig war, lange nicht aufzuwiegen. Auch ich glaube, daß
Tietze und seine Frau bei ihrem chirurgischen Eingriff allzu tief in ge-
sundes Fleisch geschnitten haben, stelle mich aber, wenn es gilt, sich für
den Dürer Friedländcrs, Paulis, Winklers und Kurths einerseits oder den
Dürer Röttingers und der beiden Tietze anderseits zu entscheiden, jeden-
falls insoferne auf die Seite meiner Wiener Landsleute, als ich mit ihnen
darin einig bin, daß das Dürer-Werk stark mit Dingen überlastet ist, die
damit nichts zu tun haben. Im einzelnen muß ich mir selbstverständlich
meine Meinung vorbehalten. Diese freilich genauer zu formulieren, ge-
bricht es mir gegenwärtig einfach an Zeit. Ich möchte nur sagen, daß mir
hinsichtlich der Basler Terenz-Zeichnungen, die Roemer mustergültig
publiziert hat, dessen vorsichtige Stellungnahme sehr zusagt, und daß ich
den Darmstädter Dominikusaltar und das Dresdener Marienleben, Bilder,
die man auf der Nürnberger Dürer-Ausstellung auf erwünschte Weise mit
sicheren Frühwerken Dürers vergleichen konnte, noch immer als Arbeiten
Dürers ablehne. Daß ein Werk wie das Berliner Sebastians-Diptychon
kein Dürer, sondern ein Baidung ist, wie auch von den Tietze angenommen
wird, hat mittlerweile Baldass schlagend bewiesen (Pantheon 1928, Heft 8).
Hier sei einstweilen nur noch folgendes vermerkt: Unter den im Buch als
Werkstattarbeiten bezeichneten Werken halte ich für eigenhändig: W 18
den Reiter von 1498, W27 die heilige Anna selbdritt, W2S den Kalvarien-
berg. W29 die heilige Familie in der Halle, W 30 die beiden Heiligen Anton
und Paul. W31 den Täufer und den heiligen Onufrius, W32 die Stigma-
tisation des heiligen Franz, W 49 den Kampf wilder Tiere und W 50 den
heiligen Sebastian am Baume. Unter den aus dem Dürer-Werk aus-
geschiedenen Arbeiten nehme ich nach wie vor für den Meister in An-
spruch : A 31 das Weiblein in Bavonne, A 46 den Berliner Kalvarienberg,
A 48 das reitende Paar in Berlin, A 52 den Drachenkampf, A 54 den so-
genannten Beiisar ebenda, A 70 den Darmstädter Herkules, A 89 den
Reiter und den Tod, gleichfalls im Stadel, A 100 den Coburger Kalvarien-
berg, A 108 den männlichen Kopf von 1505, A 110 das Urteil des Trajan,
A 120 den Londoner Reiter, A 121 den Reiterkampf (ich muß beim Absalon
und bei den Zaddeln bleiben), A 133 das Memento mori von 1505, A 140
den Hirschkäfer aus demselben Jahr, A 147 das Münchener Reiterpaar
und A 151 die drei Reiter in Paris. Die angeführten Arbeiten sind diejenigen,
über die ich selbst sicher zu sein glaube. Über andere, z. B. die grüne
Passion und die zu ihr gehörigen Blätter, schwankt mein Urteil noch.
Ich wünsche aufrichtig, daß der II. Band und der Ergänzungsband
möglichst bald erscheinen mögen.
Eine in jeder Hinsicht tadellose, ja vorbildliche Veröffentlichung
ist die der Lemberger Dürer-Zeichnungen durch Hans Tietze und
M. Gebarowicz. Auch des Verlages, der das Werk aufs vornehmste aus-
gestattet und vor allem für ausgezeichnete Lichtdruckwiedergaben ge-
sorgt hat, muß mit Dank und Anerkennung gedacht werden. Es ist um so
erfreulicher, daß diese Ausgabe so einwandfrei ausgefallen ist, als ja der
Fund der Lemberger Zeichnungen, knapp vor dem Jubiläum geschehen,
der eigentliche Sonnenblick ist, der dieses vergoldet.
Ein äußerst gediegenes und durchaus ernstes Dürer-Buch ist das
großangelegte Werk von Eduard Flechsig, von dem bisher nur der I. Band
vorliegt. Es ist keine eigentliche Biographie, sondern eine Sammlung von
Abhandlungen, die sich auf Dürer beziehen. Die eingeschobenen Partien
überWoIgemut und den deutschen Holzschnitt des XV. Jahrhunderts seien
als besonders lehrreich hervorgehoben. Was den Dessauer Christophorus
anbelangt, so muß ich gestehen, daß ich ihn, solange ich ihn nur aus
der Reproduktion kannte, mit größerer Sicherheit für ein Dürerisches
Original gehalten habe, als ich das nunmehr tue, da ich das Bild selbst
auf der Nürnberger Ausstellung gesehen habe. Mit Flechsigs Datierung
von Dürers Münchener Selbstbildnis bin ich völlig einverstanden. Auch
hier ist aufrichtig zu wünschen, daß der IL Band, der die Zeichnungen
behandelt und einen Überblick über Dürers gesamtes Schaffen bringen
soll, bald erscheinen möge.
Ein volkstümlicher Dürer im besten Sinne des Wortes ist das Buch
von Franz Ottmann. Es ist ungemein sympathisch geschrieben und sieht,
wenn es auch keine neuen Forschungsergebnisse beibringt, doch das
Thema mit frischen, unbefangenen Augen an. Arpad Weixlgärtner.
Ulrich Christoffel, Deutsche Kunst als Form
und Ausdruck. Augsburg 1928, Dr.Benno Filser G.m.b.H.
Dies umfangreiche neue Buch des aus der Schule und Methode
Wölfllins hervorgegangenen Gelehrten bildet einen weiteren wichtigen
Hrissenschaft1
„erWn* h«nde
CS50**
" Beispiel D*<«
i'fJ sich doch, .
i**' Der Verfaß
:>*lFOrffl,„! n Dicht,
. stimme mit «r
; feisten Gcsict
■?*h.eundUndsc
, deutscher
r Ausi
ländlich
ihr
,<!*»»«<'»rsl
JWS, erzeugte
„Unorganisierte Fora
-stie subjektive aus .
^ da und steht eil
mrklichkeit hindern
^ des »wußten« (5
.s Iis Unwirkliche.. E
jfeiHt * einzelnen I
Gnindlagen von der |
giftend folgt eine !
od Landschaft, die :
■i verleihend, in der I
■st Saucen bedingen.
M »Weg zur Form« (
_-;} in Jenen der Gent
'lataek« gestellten Bild
irtigimg subjel
:Mmlzerei in Holz um
■'r~ ihrer Schattierung,
. feiisfremder bleiben
.2 Malerei und Architek
-dieit erscheinen sie
-1 bestimmt für die obj
tUkA und Stofflich!
'qsnmeats, der subjel
■"-•ii Jet Farbe bleibt i
der
56
U die von objektiv 1.
"* der deutsche Künst
Malerischen Seite u
"*■>•■ Es folgen tr
% .Wage des Dorfes
deren Aspekt
einem landschaftl
^ umfangreichste d
":'%aphisch aus de,
'^»derts Wölf gr,
Holbein
*P*,SMundI
;*.m0nographisc
< !SB*sso unt
gehender