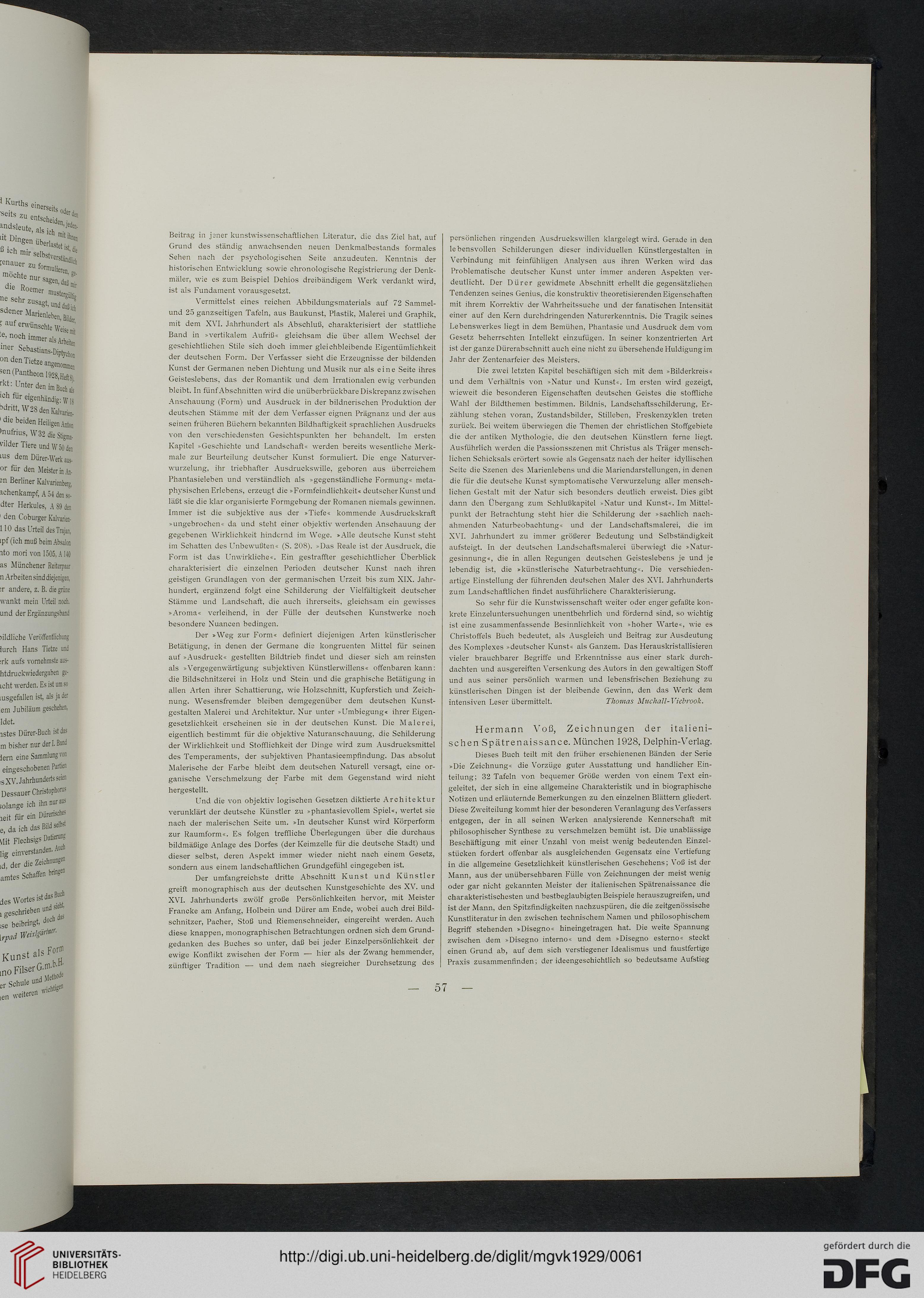ands,eute, als ich ,W»
»tßi,,,, *' %
. Senuberlasteti
tenau"*«formu :4,ti
J;n;rMarien,ebeniB^
>Mfenvü„sehteWei^
•e'nochlmmerals
»en (Pantheon 1928,Heft8)
^^•nterdenimBuch*
'ch für eigenhändig: w IS
^ritt,W28denKalvarie,
*e beiden Heiligen Anton
>nufrius,W32 diestig«.
rilder Tiere und W 50 den
ius dem Dürer-Werk «us-
or für den Meister in An-
sn Berliner Kalvarienbtrr,
achenkampf, A 54 den so-
fter Herkules, A 89 dm
den Coburger Kalviriet-
110 das Urteil desTrajan,
ipf (ich muß beim Absalon
ito mori von 1505, A140
as Münchener Reiterpaar
n Arbeiten sind diejenigen,
:r andere, z. B. die glitt
wankt mein Urteil noch,
und der Ergänzungsband
)ildliche Veröffentlichung
lurch Hans Hetze und
rk aufs vornehmste aus-
htdruckwiedergaben gl-
icht werden. Es ist umso
usgefallen ist, als ja dir
em Jubiläum geschehe
ldet.
istes Dürer-Buch ist das
m bisher nur der I. Band
lern eine Sammlung von
eingeschobenen Partim
s XV. Jahrhunderts seit«
Dessauer Christophoras
-olangeichihnnuraus
ieit für ein Dürens*«
e da ich das Bild sefct
Mit Flecbsigs Daüeruns
,ig einverstanden. Au*
d der die Zeichnungen
amtes Schaffen bnage»
des Wortes
geschrieben und *
s! beibringt, doe^
rpad W*0*
Kunst als ^
a Schule und I
Beitrag in janer kunstwissenschaftlichen Literatur, die das Ziel hat, auf
Grund des ständig anwachsenden neuen Denkmalbestands formales
Sehen nach der psychologischen Seite anzudeuten. Kenntnis der
historischen Entwicklung sowie chronologische Registrierung der Denk-
mäler, wie es zum Beispiel Dehios dreibändigem Werk verdankt wird,
ist als Fundament vorausgesetzt.
Vermittelst eines reichen Abbildungsmaterials auf 72 Sammel-
und 25 ganzseitigen Tafeln, aus Baukunst, Plastik. Malerei und Graphik,
mit dem XVI. Jahrhundert als Abschluß, charakterisiert der stattliche
Band in »vertikalem Aufriß« gleichsam die über allem Wechsel der
geschichtlichen Stile sich doch immer gleichbleibende Eigentümlichkeit
der deutschen Form. Der Verfasser sieht die Erzeugnisse der bildenden
Kunst der Germanen neben Dichtung und Musik nur als eine Seite ihres
Geisteslebens, das der Romantik und dem Irrationalen ewig verbunden
bleibt. In fünf Abschnitten wird die unüberbrückbare Diskrepanz zwischen
Anschauung (Form) und Ausdruck in der bildnerischen Produktion der
deutschen Stämme mit der dem Verfasser eignen Prägnanz und der aus
seinen früheren Büchern bekannten Bildhaftigkeit sprachlichen Ausdrucks
von den verschiedensten Gesichtspunkten her behandelt. Im ersten
Kapitel -Geschichte und Landschaft« werden bereits wesentliche Merk-
male zur Beurteilung deutscher Kunst formuliert. Die enge Naturver-
wurzelung, ihr triebhafter Ausdruckswille, geboren aus überreichem
Phantasieleben und verständlich als »gegenständliche Formung« meta-
physischen Ericbens, erzeugt die »Formfeindlichkeit« deutscher Kunst und
läßt sie die klar organisierte Formgebung der Romanen niemals gewinnen.
Immer ist die subjektive aus der »Tiefe« kommende Ausdruckskraft
»ungebrochen« da und steht einer objektiv wertenden Anschauung der
gegebenen Wirklichkeit hindernd im Wege. »Alle deutsche Kunst steht
im Schatten des Unbewußten« (S. 208). »Das Reale ist der Ausdruck, die
Form ist das Unwirkliche«. Ein gestraffter geschichtlicher Überblick
charakterisiert die einzelnen Perioden deutscher Kunst nach ihren
geistigen Grundlagen von der germanischen Urzeit bis zum XIX. Jahr-
hundert, ergänzend folgt eine Schilderung der Vielfältigkeit deutscher
Stämme und Landschaft, die auch ihrerseits, gleichsam ein gewisses
»Aroma« verleihend, in der Fülle der deutschen Kunstwerke noch
besondere Nuancen bedingen.
Der »Weg zur Form« definiert diejenigen Arten künstlerischer
Betätigung, in denen der Germane die kongruenten Mittel für seinen
auf »Ausdruck« gestellten Bildtrieb findet und dieser sich am reinsten
als »Vergegenwärtigung subjektiven Künstlerwillens« offenbaren kann-,
die Bildschnitzerei in Holz und Stein und die graphische Betätigung in
allen Arten ihrer Schattierung, wie Holzschnitt, Kupferstich und Zeich-
nung. Wesensfremder bleiben demgegenüber dem deutschen Kunst-
gestalten Malerei und Architektur. Nur unter »Umbiegung« ihrer Eigen-
gesetzlichkeit erscheinen sie in der deutschen Kunst. Die Malerei,
eigentlich bestimmt für die objektive Naturanschauung, die Schilderung
der Wirklichkeit und Stofflichkeit der Dinge wird zum Ausdrucksmittel
des Temperaments, der subjektiven Phantasieempfindung. Das absolut
Malerische der Farbe bleibt dem deutschen Naturell versagt, eine or-
ganische Verschmelzung der Farbe mit dem Gegenstand wird nicht
hergestellt.
Und die von objektiv logischen Gesetzen diktierte Architektur
verunklärt der deutsche Künstler zu »phantasievollem Spiel«, wertet sie
nach der malerischen Seite um. »In deutscher Kunst wird Körperform
zur Raumform«. Es folgen treffliche Überlegungen über die durchaus
bildmäßige Anlage des Dorfes (der Keimzelle für die deutsche Stadt) und
dieser selbst, deren Aspekt immer wieder nicht nach einem Gesetz,
sondern aus einem landschaftlichen Grundgefühl eingegeben ist.
Der umfangreichste dritte Abschnitt Kunst und Künstler
greift monographisch aus der deutschen Kunstgeschichte des XV. und
XVI. Jahrhunderts zwölf große Persönlichkeiten hervor, mit Meister
Francke am Anfang, Holbein und Dürer am Ende, wobei auch drei Bild-
schnitzer, Pacher, Stoß und Riemenschneider, eingereiht werden. Auch
diese knappen, monographischen Betrachtungen ordnen sich dem Grund-
gedanken des Buches so unter, daß bei jeder Einzelpersönlichkeit der
ewige Konflikt zwischen der Form — hier als der Zwang hemmender,
zünftiger Tradition — und dem nach siegreicher Durchsetzung des
persönlichen ringenden Ausdruckswillen klargelegt wird. Gerade in den
lebensvollen Schilderungen dieser individuellen Künstlergestalten in
Verbindung mit feinfühligen Analysen aus ihren Werken wird das
Problematische deutscher Kunst unter immer anderen Aspekten ver-
deutlicht. Der Dürer gewidmete Abschnitt erhellt die gegensätzlichen
Tendenzen seines Genius, die konstruktiv theoretisierenden Eigenschaften
mit ihrem Korrektiv der Wahrheitssuche und der fanatischen Intensität
einer auf den Kern durchdringenden Naturerkenntnis. Die Tragik seines
Lebenswerkes liegt in dem Bemühen, Phantasie und Ausdruck dem vom
Gesetz beherrschten Intellekt einzufügen. In seiner konzentrierten Art
ist der ganze Dürerabschnitt auch eine nicht zu übersehende Huldigung im
Jahr der Zentenarfeier des Meisters.
Die zwei letzten Kapitel beschäftigen sich mit dem »Bilderkreis«
und dem Verhältnis von »Natur und Kunst«. Im ersten wird gezeigt,
wieweit die besonderen Eigenschaften deutschen Geistes die stoffliche
Wahl der Bildthemen bestimmen. Bildnis, Landschaftsschilderung, Er-
zählung stehen voran, Zustandsbilder, Stilleben. Freskenzyklen treten
zurück. Bei weitem überwiegen die Themen der christlichen Stoffgebiete
die der antiken Mythologie, die den deutschen Künstlern ferne liegt.
Ausführlich werden die Passionsszenen mit Christus als Träger mensch-
lichen Schicksals erörtert sowie als Gegensatz nach der heiter idyllischen
Seite die Szenen des Marienlebens und die Mariendarstellungen, in denen
die für die deutsche Kunst symptomatische Verwurzelung aller mensch-
lichen Gestalt mit der Natur sich besonders deutlich erweist. Dies gibt
dann den Übergang zum Schlußkapitel »Natur und Kunst«. Im Mittel-
punkt der Betrachtung steht hier die Schilderung der »sachlich nach-
ahmenden Naturbeobachtung« und der Landschaftsmalerei, die im
XVI. Jahrhundert zu immer größerer Bedeutung und Selbständigkeit
aufsteigt. In der deutschen Landschaftsmalerei überwiegt die »Natur-
gesinnung«, die in allen Regungen deutschen Geisteslebens je und je
lebendig ist, die »künstlerische Naturbetrachtung«. Die verschieden-
artige Einstellung der führenden deutschen Maler des XVI. Jahrhunderts
zum Landschaftlichen findet ausführlichere Charakterisierung.
So sehr für die Kunstwissenschaft weiter oder enger gefaßte kon-
krete Einzeluntersuchungen unentbehrlich und fördernd sind, so wichtig
ist eine zusammenfassende Besinnlichkeit von »hoher Warte«, wie es
Christoffels Buch bedeutet, als Ausgleich und Beitrag zur Ausdeutung
des Komplexes »deutscher Kunst« als Ganzem. Das Herauskristallisieren
vieler brauchbarer Begriffe und Erkenntnisse aus einer stark durch-
dachten und ausgereiften Versenkung des Autors in den gewaltigen Stoff
und aus seiner persönlich warmen und lebensfrischen Beziehung zu
künstlerischen Dingen ist der bleibende Gewinn, den das Werk dem
intensiven Leser übermittelt. Thomas MuchaU-Vicbrook.
Hermann Yoß, Zeichnungen der italieni-
schen Spätrenaissance. München 1928, Delphin-Verlag.
Dieses Buch teilt mit den früher erschienenen Bänden der Serie
»Die Zeichnung« die Vorzüge guter Ausstattung und handlicher Ein-
teilung; 32 Tafeln von bequemer Größe werden von einem Text ein-
geleitet, der sich in eine allgemeine Charakteristik und in biographische
Notizen und erläuternde Bemerkungen zu den einzelnen Blättern gliedert.
Diese Zweiteilung kommt hier der besonderen Veranlagung des Verfassers
entgegen, der in all seinen Werken analysierende Kennerschaft mit
philosophischer Synthese zu verschmelzen bemüht ist. Die unablässige
Beschäftigung mit einer Unzahl von meist wenig bedeutenden Einzel-
stücken fordert offenbar als ausgleichenden Gegensatz eine Vertiefung
in die allgemeine Gesetzlichkeit künstlerischen Geschehens; Voß ist der
Mann, aus der unübersehbaren Fülle von Zeichnungen der meist wenig
oder gar nicht gekannten Meister der italienischen Spätrenaissance die
charakteristischesten und bestbeglaubigten Beispiele herauszugreifen, und
ist der Mann, den Spitzfindigkeiten nachzuspüren, die die zeitgenössische
Kunstliteratur in den zwischen technischem Namen und philosophischem
Begriff stehenden »Disegno« hineingetragen hat. Die weite Spannung
zwischen dem »Disegno interno« und dem »Disegno esterno« steckt
einen Grund ab, auf dem sich verstiegener Idealismus und faustfertige
Praxis zusammenfinden: der ideengeschichtlich so bedeutsame Aufstieg
en weiteren
wichtig
— 57 —
»tßi,,,, *' %
. Senuberlasteti
tenau"*«formu :4,ti
J;n;rMarien,ebeniB^
>Mfenvü„sehteWei^
•e'nochlmmerals
»en (Pantheon 1928,Heft8)
^^•nterdenimBuch*
'ch für eigenhändig: w IS
^ritt,W28denKalvarie,
*e beiden Heiligen Anton
>nufrius,W32 diestig«.
rilder Tiere und W 50 den
ius dem Dürer-Werk «us-
or für den Meister in An-
sn Berliner Kalvarienbtrr,
achenkampf, A 54 den so-
fter Herkules, A 89 dm
den Coburger Kalviriet-
110 das Urteil desTrajan,
ipf (ich muß beim Absalon
ito mori von 1505, A140
as Münchener Reiterpaar
n Arbeiten sind diejenigen,
:r andere, z. B. die glitt
wankt mein Urteil noch,
und der Ergänzungsband
)ildliche Veröffentlichung
lurch Hans Hetze und
rk aufs vornehmste aus-
htdruckwiedergaben gl-
icht werden. Es ist umso
usgefallen ist, als ja dir
em Jubiläum geschehe
ldet.
istes Dürer-Buch ist das
m bisher nur der I. Band
lern eine Sammlung von
eingeschobenen Partim
s XV. Jahrhunderts seit«
Dessauer Christophoras
-olangeichihnnuraus
ieit für ein Dürens*«
e da ich das Bild sefct
Mit Flecbsigs Daüeruns
,ig einverstanden. Au*
d der die Zeichnungen
amtes Schaffen bnage»
des Wortes
geschrieben und *
s! beibringt, doe^
rpad W*0*
Kunst als ^
a Schule und I
Beitrag in janer kunstwissenschaftlichen Literatur, die das Ziel hat, auf
Grund des ständig anwachsenden neuen Denkmalbestands formales
Sehen nach der psychologischen Seite anzudeuten. Kenntnis der
historischen Entwicklung sowie chronologische Registrierung der Denk-
mäler, wie es zum Beispiel Dehios dreibändigem Werk verdankt wird,
ist als Fundament vorausgesetzt.
Vermittelst eines reichen Abbildungsmaterials auf 72 Sammel-
und 25 ganzseitigen Tafeln, aus Baukunst, Plastik. Malerei und Graphik,
mit dem XVI. Jahrhundert als Abschluß, charakterisiert der stattliche
Band in »vertikalem Aufriß« gleichsam die über allem Wechsel der
geschichtlichen Stile sich doch immer gleichbleibende Eigentümlichkeit
der deutschen Form. Der Verfasser sieht die Erzeugnisse der bildenden
Kunst der Germanen neben Dichtung und Musik nur als eine Seite ihres
Geisteslebens, das der Romantik und dem Irrationalen ewig verbunden
bleibt. In fünf Abschnitten wird die unüberbrückbare Diskrepanz zwischen
Anschauung (Form) und Ausdruck in der bildnerischen Produktion der
deutschen Stämme mit der dem Verfasser eignen Prägnanz und der aus
seinen früheren Büchern bekannten Bildhaftigkeit sprachlichen Ausdrucks
von den verschiedensten Gesichtspunkten her behandelt. Im ersten
Kapitel -Geschichte und Landschaft« werden bereits wesentliche Merk-
male zur Beurteilung deutscher Kunst formuliert. Die enge Naturver-
wurzelung, ihr triebhafter Ausdruckswille, geboren aus überreichem
Phantasieleben und verständlich als »gegenständliche Formung« meta-
physischen Ericbens, erzeugt die »Formfeindlichkeit« deutscher Kunst und
läßt sie die klar organisierte Formgebung der Romanen niemals gewinnen.
Immer ist die subjektive aus der »Tiefe« kommende Ausdruckskraft
»ungebrochen« da und steht einer objektiv wertenden Anschauung der
gegebenen Wirklichkeit hindernd im Wege. »Alle deutsche Kunst steht
im Schatten des Unbewußten« (S. 208). »Das Reale ist der Ausdruck, die
Form ist das Unwirkliche«. Ein gestraffter geschichtlicher Überblick
charakterisiert die einzelnen Perioden deutscher Kunst nach ihren
geistigen Grundlagen von der germanischen Urzeit bis zum XIX. Jahr-
hundert, ergänzend folgt eine Schilderung der Vielfältigkeit deutscher
Stämme und Landschaft, die auch ihrerseits, gleichsam ein gewisses
»Aroma« verleihend, in der Fülle der deutschen Kunstwerke noch
besondere Nuancen bedingen.
Der »Weg zur Form« definiert diejenigen Arten künstlerischer
Betätigung, in denen der Germane die kongruenten Mittel für seinen
auf »Ausdruck« gestellten Bildtrieb findet und dieser sich am reinsten
als »Vergegenwärtigung subjektiven Künstlerwillens« offenbaren kann-,
die Bildschnitzerei in Holz und Stein und die graphische Betätigung in
allen Arten ihrer Schattierung, wie Holzschnitt, Kupferstich und Zeich-
nung. Wesensfremder bleiben demgegenüber dem deutschen Kunst-
gestalten Malerei und Architektur. Nur unter »Umbiegung« ihrer Eigen-
gesetzlichkeit erscheinen sie in der deutschen Kunst. Die Malerei,
eigentlich bestimmt für die objektive Naturanschauung, die Schilderung
der Wirklichkeit und Stofflichkeit der Dinge wird zum Ausdrucksmittel
des Temperaments, der subjektiven Phantasieempfindung. Das absolut
Malerische der Farbe bleibt dem deutschen Naturell versagt, eine or-
ganische Verschmelzung der Farbe mit dem Gegenstand wird nicht
hergestellt.
Und die von objektiv logischen Gesetzen diktierte Architektur
verunklärt der deutsche Künstler zu »phantasievollem Spiel«, wertet sie
nach der malerischen Seite um. »In deutscher Kunst wird Körperform
zur Raumform«. Es folgen treffliche Überlegungen über die durchaus
bildmäßige Anlage des Dorfes (der Keimzelle für die deutsche Stadt) und
dieser selbst, deren Aspekt immer wieder nicht nach einem Gesetz,
sondern aus einem landschaftlichen Grundgefühl eingegeben ist.
Der umfangreichste dritte Abschnitt Kunst und Künstler
greift monographisch aus der deutschen Kunstgeschichte des XV. und
XVI. Jahrhunderts zwölf große Persönlichkeiten hervor, mit Meister
Francke am Anfang, Holbein und Dürer am Ende, wobei auch drei Bild-
schnitzer, Pacher, Stoß und Riemenschneider, eingereiht werden. Auch
diese knappen, monographischen Betrachtungen ordnen sich dem Grund-
gedanken des Buches so unter, daß bei jeder Einzelpersönlichkeit der
ewige Konflikt zwischen der Form — hier als der Zwang hemmender,
zünftiger Tradition — und dem nach siegreicher Durchsetzung des
persönlichen ringenden Ausdruckswillen klargelegt wird. Gerade in den
lebensvollen Schilderungen dieser individuellen Künstlergestalten in
Verbindung mit feinfühligen Analysen aus ihren Werken wird das
Problematische deutscher Kunst unter immer anderen Aspekten ver-
deutlicht. Der Dürer gewidmete Abschnitt erhellt die gegensätzlichen
Tendenzen seines Genius, die konstruktiv theoretisierenden Eigenschaften
mit ihrem Korrektiv der Wahrheitssuche und der fanatischen Intensität
einer auf den Kern durchdringenden Naturerkenntnis. Die Tragik seines
Lebenswerkes liegt in dem Bemühen, Phantasie und Ausdruck dem vom
Gesetz beherrschten Intellekt einzufügen. In seiner konzentrierten Art
ist der ganze Dürerabschnitt auch eine nicht zu übersehende Huldigung im
Jahr der Zentenarfeier des Meisters.
Die zwei letzten Kapitel beschäftigen sich mit dem »Bilderkreis«
und dem Verhältnis von »Natur und Kunst«. Im ersten wird gezeigt,
wieweit die besonderen Eigenschaften deutschen Geistes die stoffliche
Wahl der Bildthemen bestimmen. Bildnis, Landschaftsschilderung, Er-
zählung stehen voran, Zustandsbilder, Stilleben. Freskenzyklen treten
zurück. Bei weitem überwiegen die Themen der christlichen Stoffgebiete
die der antiken Mythologie, die den deutschen Künstlern ferne liegt.
Ausführlich werden die Passionsszenen mit Christus als Träger mensch-
lichen Schicksals erörtert sowie als Gegensatz nach der heiter idyllischen
Seite die Szenen des Marienlebens und die Mariendarstellungen, in denen
die für die deutsche Kunst symptomatische Verwurzelung aller mensch-
lichen Gestalt mit der Natur sich besonders deutlich erweist. Dies gibt
dann den Übergang zum Schlußkapitel »Natur und Kunst«. Im Mittel-
punkt der Betrachtung steht hier die Schilderung der »sachlich nach-
ahmenden Naturbeobachtung« und der Landschaftsmalerei, die im
XVI. Jahrhundert zu immer größerer Bedeutung und Selbständigkeit
aufsteigt. In der deutschen Landschaftsmalerei überwiegt die »Natur-
gesinnung«, die in allen Regungen deutschen Geisteslebens je und je
lebendig ist, die »künstlerische Naturbetrachtung«. Die verschieden-
artige Einstellung der führenden deutschen Maler des XVI. Jahrhunderts
zum Landschaftlichen findet ausführlichere Charakterisierung.
So sehr für die Kunstwissenschaft weiter oder enger gefaßte kon-
krete Einzeluntersuchungen unentbehrlich und fördernd sind, so wichtig
ist eine zusammenfassende Besinnlichkeit von »hoher Warte«, wie es
Christoffels Buch bedeutet, als Ausgleich und Beitrag zur Ausdeutung
des Komplexes »deutscher Kunst« als Ganzem. Das Herauskristallisieren
vieler brauchbarer Begriffe und Erkenntnisse aus einer stark durch-
dachten und ausgereiften Versenkung des Autors in den gewaltigen Stoff
und aus seiner persönlich warmen und lebensfrischen Beziehung zu
künstlerischen Dingen ist der bleibende Gewinn, den das Werk dem
intensiven Leser übermittelt. Thomas MuchaU-Vicbrook.
Hermann Yoß, Zeichnungen der italieni-
schen Spätrenaissance. München 1928, Delphin-Verlag.
Dieses Buch teilt mit den früher erschienenen Bänden der Serie
»Die Zeichnung« die Vorzüge guter Ausstattung und handlicher Ein-
teilung; 32 Tafeln von bequemer Größe werden von einem Text ein-
geleitet, der sich in eine allgemeine Charakteristik und in biographische
Notizen und erläuternde Bemerkungen zu den einzelnen Blättern gliedert.
Diese Zweiteilung kommt hier der besonderen Veranlagung des Verfassers
entgegen, der in all seinen Werken analysierende Kennerschaft mit
philosophischer Synthese zu verschmelzen bemüht ist. Die unablässige
Beschäftigung mit einer Unzahl von meist wenig bedeutenden Einzel-
stücken fordert offenbar als ausgleichenden Gegensatz eine Vertiefung
in die allgemeine Gesetzlichkeit künstlerischen Geschehens; Voß ist der
Mann, aus der unübersehbaren Fülle von Zeichnungen der meist wenig
oder gar nicht gekannten Meister der italienischen Spätrenaissance die
charakteristischesten und bestbeglaubigten Beispiele herauszugreifen, und
ist der Mann, den Spitzfindigkeiten nachzuspüren, die die zeitgenössische
Kunstliteratur in den zwischen technischem Namen und philosophischem
Begriff stehenden »Disegno« hineingetragen hat. Die weite Spannung
zwischen dem »Disegno interno« und dem »Disegno esterno« steckt
einen Grund ab, auf dem sich verstiegener Idealismus und faustfertige
Praxis zusammenfinden: der ideengeschichtlich so bedeutsame Aufstieg
en weiteren
wichtig
— 57 —