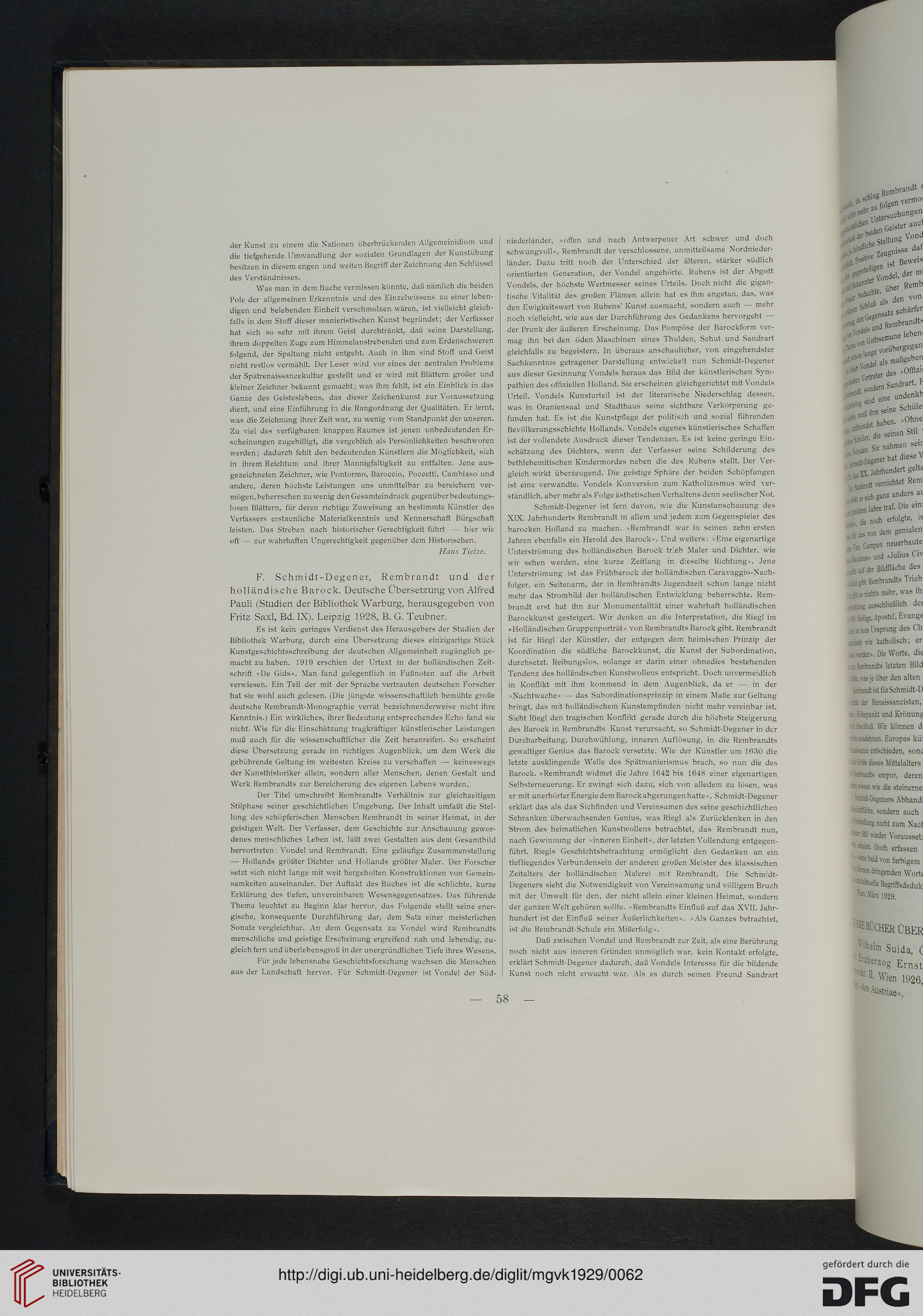der Kunst zu einem die Nationen überbrückenden Allgemeinidiom und
die tiefgehende Umwandlung der sozialen Grundlagen der Kunstübung
besitzen in diesem engen und weiten Begriff der Zeichnung den Schlüssel
des Verständnisses.
Was man in dem Buche vermissen konnte, daß nämlich die beiden
Pole der allgemeinen Erkenntnis und des Einzelwissens zu einer leben-
digen und belebenden Einheit verschmolzen wären, ist vielleicht gleich-
falls in dem Stoff dieser manieristischen Kunst begründet; der Verfasser
hat sich so sehr mit ihrem Geist durchtränkt, daß seine Darstellung,
ihrem doppelten Zuge zum Himmelanstrebenden und zum Erdenschweren
folgend, der Spaltung nicht entgeht. Auch in ihm sind Stoff und Geist
nicht restlos vermählt. Der Leser wird vor eines der zentralen Probleme
der Spätrenaissancekultur gestellt und er wird mit Blättern großer und
kleiner Zeichner bekannt gemacht; was ihm fehlt, ist ein Einblick in das
Ganze des Geisteslebens, das dieser Zeichenkunst zur Voraussetzung
dient, und eine Einführung in die Rangordnung der Qualitäten. Er lernt,
was die Zeichnung ihrer Zeit war, zu wenig vom Standpunkt der unseren.
Zu viel des verfügbaren knappen Raumes ist jenen unbedeutenden Er-
scheinungen zugebilligt, die vergeblich als Persönlichkeiten beschworen
werden; dadurch fehlt den bedeutenden Künstlern die Möglichkeit, sich
in ihrem Reichtum und ihrer Mannigfaltigkeit zu entfalten. Jene aus-
gezeichneten Zeichner, wie Pontormo, Baroccio, Poccetti, Cambiaso und
andere, deren höchste Leistungen uns unmittelbar zu bereichern ver-
mögen,beherrschen zuwenig den Gesamteindruck gegenüber bedeutungs-
losen Blättern, für deren richtige Zuweisung an bestimmte Künstler des
Verfassers erstaunliche Materialkenntnis und Kennerschaft Bürgschaft
leisten. Das Streben nach historischer Gerechtigkeit führt — hier wie
oft — zur wahrhaften Ungerechtigkeit gegenüber dem Historischen.
Hans Tietze.
F. Schmidt-Degener, Rembrandt und der
holländische Barock. Deutsche Übersetzung von Alfred
Pauli (Studien der Bibliothek Warburg, herausgegeben von
Fritz Saxl, Bd. IX). Leipzig 1928, B. G. Teubner.
Es ist kein geringes Verdienst des Herausgebers der Studien der
Bibliothek Warburg, durch eine Übersetzung dieses einzigartige Stück
Kunstgeschichtsschreibung der deutschen Allgemeinheit zugänglich ge-
macht zu haben. 1919 erschien der Urtext in der holländischen Zeit-
schrift >De Gids«. Man fand gelegentlich in Fußnoten auf die Arbeit
verwiesen. Ein Teil der mit der Sprache vertrauten deutschen Forscher
hat sie wohl auch gelesen. (Die jüngste wissenschaftlich bemühte große
deutsche Rembrandt-Monographie verrät bezeichnenderweise nicht ihre
Kenntnis.) Ein wirkliches, ihrer Bedeutung entsprechendes Echo fand sie
nicht. Wie für die Einschätzung tragkräftiger künstlerischer Leistungen
muß auch für die wissenschaftlicher die Zeit heranreifen. So erscheint
diese Übersetzung gerade im richtigen Augenblick, um dem Werk die
gebührende Geltung im weitesten Kreise zu verschaffen — keineswegs
der Kunsthistoriker allein, sondern aller Menschen, denen Gestalt und
Werk Rembrandts zur Bereicherung des eigenen Lebens wurden.
Der Titel umschreibt Rembrandts Verhältnis zur gleichzeitigen
Stilphase seiner geschichtlichen Umgebung. Der Inhalt umfaßt die Stel-
lung des schöpferischen Menschen Rembrandt in seiner Heimat, in der
geistigen Welt. Der Verfasser, dem Geschichte zur Anschauung gewor-
denes menschliches Leben ist, läßt zwei Gestalten aus dem Gesamtbild
hervortreten: Vondel und Rembrandt. Eine geläufige Zusammenstellung
— Hollands größter Dichter und Hollands größter Maler. Der Forscher
setzt sich nicht lange mit weit hergeholten Konstruktionen von Gemein-
samkeiten auseinander. Der Auftakt des Buches ist die schlichte, kurze
Erklärung des tiefen, unvereinbaren Wesensgegensatzes. Das führende
Thema leuchtet zu Beginn klar hervor, das Folgende stellt seine ener-
gische, konsequente Durchführung dar, dem Satz einer meisterlichen
Sonate vergleichbar. An dem Gegensatz zu Vondel wird Rembrandts
menschliche und geistige Erscheinung ergreifend nah und lebendig, zu-
gleich fern und überlebensgroß in der unergründlichen Tiefe ihres Wesens.
Für jede lebensnahe Geschichtsforschung wachsen die Menschen
aus der Landschaft hervor. Für Schmidt-Degener ist Vondel der Süd-
niederländer, »offen und nach Antwerpener Art schwer und doch
schwungvoll«, Rembrandt der verschlossene, unmitteilsame Nordnieder-
lander. Dazu tritt noch der Unterschied der älteren, stärker südlich
orientierten Generation, der Vondel angehörte. Rubens ist der Abgott
Vondels, der höchste Wertmesser seines Urteils. Doch nicht die gigan-
tische Vitalität des großen Flamen allein hat es ihm angetan, das, was
den Ewigkeitswert von Rubens' Kunst ausmacht, sondern auch — mehr
noch vielleicht, wie aus der Durchführung des Gedankens hervorgeht —
der Prunk der äußeren Erscheinung. Das Pompöse der Barockform ver-
mag ihn bei den üden Maschinen eines Thulden, Schut und Sandrart
gleichfalls zu begeistern. In überaus anschaulicher, von eingehendster
Sachkenntnis getragener Darstellung entwickelt nun Schmidt-Degener
aus dieser Gesinnung Vondels heraus das Bild der künstlerischen Sym-
pathien des offiziellen Holland. Sie erscheinen gleichgerichtet mit Vondels
Urteil. Vondels Kunsturteil ist der literarische Niederschlag dessen,
was in Oraniensaal und Stadthaus seine sichtbare Verkörperung ge-
funden hat. Es ist die Kunstpflege der politisch und sozial führenden
Bevölkerungsschichte Hollands. Vondels eigenes künstlerisches Schaffen
ist der vollendete Ausdruck dieser Tendenzen. Es ist keine geringe Ein-
sehätzung des Dichters, wenn der Verfasser seine Schilderung des
bethlehemitischen Kindermordes neben die des Rubens stellt. Der Ver-
gleich wirkt überzeugend. Die geistige Sphäre der beiden Schöpfungen
ist eine verwandte. Vondels Konversion zum Katholizismus wird ver-
standlich, aber mehr als Folge ästhetischen Verhaltens denn seelischer Not.
Schmidt-Degener ist fern davon, wie die Kunstanschauung des
XIX. Jahrhunderts Rembrandt in allem und jedem zum Gegenspieler des
barocken Holland zu machen. »Rembrandt war in seinen zehn ersten
Jahren ebenfalls ein Herold des Barock«. Und weiters: »Eine eigenartige
Unterströmung des holländischen Barock trieb Maler und Dichter, wie
wir sehen werden, eine kurze Zeitlang in dieselbe Richtung«. Jene
Unterströmung ist das Frühbarock der holländischen Caravaggio-Xach-
folger, ein Seitenarm, der in Rembrandts Jugendzeit schon lange nicht
mehr das Strombild der holländischen Entwicklung beherrschte. Rem-
brandt erst hat ihn zur Monumentalität einer wahrhaft holländischen
Barockkunst gesteigert. Wir denken an die Interpretation, die Riegl im
»■Holländischen Gruppenporträt« von Rembrandts Barock gibt. Rembrandt
ist für Riegl der Künstler, der entgegen dem heimischen Prinzip der
Koordination die südliche Barockkunst, die Kunst der Subordination,
durchsetzt. Reibungslos, solange er darin einer ohnedies bestehenden
Tendenz des holländischen Kunstwollens entspricht. Doch unvermeidlich
in Konflikt mit ihm kommend in dem Augenblick, da er — in der
»Nachtwache« — das Subordinationsprinzip in einem Maße zur Geltung
bringt, das mit holländischem Kunstempfinden nicht mehr vereinbar ist.
Sieht Riegl den tragischen Konflikt gerade durch die höchste Steigerung
des Barock in Rembrandts Kunst verursacht, so Schmidt-Degener in der
Durcharbeitung, Durchwühlung, inneren Auflösung, in die Rembrandts
gewaltiger Genius das Barock versetzte. Wie der Künstler um 1630 die
letzte ausklingende Welle des Spätmanierismus brach, so nun die des
Barock. »Rembrandt widmet die Jahre 1642 bis 164S einer eigenartigen
Selbsterneuerung. Er zwingt sich dazu, sich von alledem zu lösen, was
er mit unerhörter Energie dem Barock abgerungen hatte«. Schmidt-Degener
erklärt das als das Sichfinden und Vereinsamen des seine geschichtlichen
Schranken überwachsenden Genius, was Riegl als Zurücklenken in den
Strom des heimatlichen Kunstwollens betrachtet, das Rembrandt nun,
nach Gewinnung der »inneren Einheit«, der letzten Vollendung entgegen-
führt. Riegls Geschichtsbetrachtung ermöglicht den Gedanken an ein
tiefliegendes Verbundensein der anderen großen Meister des klassischen
Zeitalters der holländischen Malerei mit Rembrandt. Die Schmidt-
Degeners sieht die Notwendigkeit von Vereinsamung und völligem Bruch
mit der Umwelt für den, der nicht allein einer kleinen Heimat, sondern
der ganzen Welt gehören sollte. »Rembrandts Einfluß auf das XVII. Jahr-
hundert ist der Einfluß seiner Äußerlichkeiten«. »Als Ganzes betrachtet,
ist die Rembrandt-Schule ein Mißerfolg«.
Daß zwischen Vondel und Rembrandt zur Zeit, als eine Berührung
noch nicht aus inneren Gründen unmöglich war, kein Kontakt erfolgte,
erklärt Schmidt-Degener dadurch, daß Vondels Interesse für die bildende
Kunst noch nicht erwacht war. Als es durch seinen Freund Sandrart
feiten
.«Rembrand'
Stellung Von
VondA der m
J^'fL über Rem"
>bt * de"
^ad Re^randt
"vorubergegan
-denkt
,lB«»i^eine Schüle
Isdftr. die semen
:>.D«generhatd,ese
„-.j, XX. Jahrhundert gelte
f^o« vernichtet Rem
.«ersiehganz anders ai
^ Jahre traf. Die ein
.> die noch erfolgte, i
3j,'iUsvondem genialen
",Vu Campen neuerbaute
'y^us. und «Julius Ci\
^iBäufder Büdfläche des
dgibl Rembrandts Trieb
; s« es nichts mehr, was ih
Kttog ausschließlich der
S! Heilige, Apostel, Evange
ai er mm Ursprung des Ch
,-3sth irie katholisch; er
r.rerden<. Die Worte, die
-Jenbrandts letzten Bild
"iae. was je über den alten
■sbimdlistfurSchmidt-D
m der Renaissancisten,
-• JEhepunkt und Krönung
r.fecMuß. Wir können d
:'iausdehnen. Europas küi
Usance entschieden, sonc
- Grüfe dieses Mittelalters
'nutts empor, deren
' Äsen wie die steinerne
üiidt-Degeners Abhand:
'■äittöie. sondern auch
'Stellung nicht zum Nacl
«USB wieder Vorausset
5 *nt Doch erfassen
;-»ntbald vor, farbigem
dringenden Wort.
'"-aktuelle
'■«■März 1929,
riffsdeduk
ÜBER
58
^BÜCHER
/'*lm Suida, (
Erztlerz°g Ernst
*11 Wien 1926,
■>Arä Austriae«.
die tiefgehende Umwandlung der sozialen Grundlagen der Kunstübung
besitzen in diesem engen und weiten Begriff der Zeichnung den Schlüssel
des Verständnisses.
Was man in dem Buche vermissen konnte, daß nämlich die beiden
Pole der allgemeinen Erkenntnis und des Einzelwissens zu einer leben-
digen und belebenden Einheit verschmolzen wären, ist vielleicht gleich-
falls in dem Stoff dieser manieristischen Kunst begründet; der Verfasser
hat sich so sehr mit ihrem Geist durchtränkt, daß seine Darstellung,
ihrem doppelten Zuge zum Himmelanstrebenden und zum Erdenschweren
folgend, der Spaltung nicht entgeht. Auch in ihm sind Stoff und Geist
nicht restlos vermählt. Der Leser wird vor eines der zentralen Probleme
der Spätrenaissancekultur gestellt und er wird mit Blättern großer und
kleiner Zeichner bekannt gemacht; was ihm fehlt, ist ein Einblick in das
Ganze des Geisteslebens, das dieser Zeichenkunst zur Voraussetzung
dient, und eine Einführung in die Rangordnung der Qualitäten. Er lernt,
was die Zeichnung ihrer Zeit war, zu wenig vom Standpunkt der unseren.
Zu viel des verfügbaren knappen Raumes ist jenen unbedeutenden Er-
scheinungen zugebilligt, die vergeblich als Persönlichkeiten beschworen
werden; dadurch fehlt den bedeutenden Künstlern die Möglichkeit, sich
in ihrem Reichtum und ihrer Mannigfaltigkeit zu entfalten. Jene aus-
gezeichneten Zeichner, wie Pontormo, Baroccio, Poccetti, Cambiaso und
andere, deren höchste Leistungen uns unmittelbar zu bereichern ver-
mögen,beherrschen zuwenig den Gesamteindruck gegenüber bedeutungs-
losen Blättern, für deren richtige Zuweisung an bestimmte Künstler des
Verfassers erstaunliche Materialkenntnis und Kennerschaft Bürgschaft
leisten. Das Streben nach historischer Gerechtigkeit führt — hier wie
oft — zur wahrhaften Ungerechtigkeit gegenüber dem Historischen.
Hans Tietze.
F. Schmidt-Degener, Rembrandt und der
holländische Barock. Deutsche Übersetzung von Alfred
Pauli (Studien der Bibliothek Warburg, herausgegeben von
Fritz Saxl, Bd. IX). Leipzig 1928, B. G. Teubner.
Es ist kein geringes Verdienst des Herausgebers der Studien der
Bibliothek Warburg, durch eine Übersetzung dieses einzigartige Stück
Kunstgeschichtsschreibung der deutschen Allgemeinheit zugänglich ge-
macht zu haben. 1919 erschien der Urtext in der holländischen Zeit-
schrift >De Gids«. Man fand gelegentlich in Fußnoten auf die Arbeit
verwiesen. Ein Teil der mit der Sprache vertrauten deutschen Forscher
hat sie wohl auch gelesen. (Die jüngste wissenschaftlich bemühte große
deutsche Rembrandt-Monographie verrät bezeichnenderweise nicht ihre
Kenntnis.) Ein wirkliches, ihrer Bedeutung entsprechendes Echo fand sie
nicht. Wie für die Einschätzung tragkräftiger künstlerischer Leistungen
muß auch für die wissenschaftlicher die Zeit heranreifen. So erscheint
diese Übersetzung gerade im richtigen Augenblick, um dem Werk die
gebührende Geltung im weitesten Kreise zu verschaffen — keineswegs
der Kunsthistoriker allein, sondern aller Menschen, denen Gestalt und
Werk Rembrandts zur Bereicherung des eigenen Lebens wurden.
Der Titel umschreibt Rembrandts Verhältnis zur gleichzeitigen
Stilphase seiner geschichtlichen Umgebung. Der Inhalt umfaßt die Stel-
lung des schöpferischen Menschen Rembrandt in seiner Heimat, in der
geistigen Welt. Der Verfasser, dem Geschichte zur Anschauung gewor-
denes menschliches Leben ist, läßt zwei Gestalten aus dem Gesamtbild
hervortreten: Vondel und Rembrandt. Eine geläufige Zusammenstellung
— Hollands größter Dichter und Hollands größter Maler. Der Forscher
setzt sich nicht lange mit weit hergeholten Konstruktionen von Gemein-
samkeiten auseinander. Der Auftakt des Buches ist die schlichte, kurze
Erklärung des tiefen, unvereinbaren Wesensgegensatzes. Das führende
Thema leuchtet zu Beginn klar hervor, das Folgende stellt seine ener-
gische, konsequente Durchführung dar, dem Satz einer meisterlichen
Sonate vergleichbar. An dem Gegensatz zu Vondel wird Rembrandts
menschliche und geistige Erscheinung ergreifend nah und lebendig, zu-
gleich fern und überlebensgroß in der unergründlichen Tiefe ihres Wesens.
Für jede lebensnahe Geschichtsforschung wachsen die Menschen
aus der Landschaft hervor. Für Schmidt-Degener ist Vondel der Süd-
niederländer, »offen und nach Antwerpener Art schwer und doch
schwungvoll«, Rembrandt der verschlossene, unmitteilsame Nordnieder-
lander. Dazu tritt noch der Unterschied der älteren, stärker südlich
orientierten Generation, der Vondel angehörte. Rubens ist der Abgott
Vondels, der höchste Wertmesser seines Urteils. Doch nicht die gigan-
tische Vitalität des großen Flamen allein hat es ihm angetan, das, was
den Ewigkeitswert von Rubens' Kunst ausmacht, sondern auch — mehr
noch vielleicht, wie aus der Durchführung des Gedankens hervorgeht —
der Prunk der äußeren Erscheinung. Das Pompöse der Barockform ver-
mag ihn bei den üden Maschinen eines Thulden, Schut und Sandrart
gleichfalls zu begeistern. In überaus anschaulicher, von eingehendster
Sachkenntnis getragener Darstellung entwickelt nun Schmidt-Degener
aus dieser Gesinnung Vondels heraus das Bild der künstlerischen Sym-
pathien des offiziellen Holland. Sie erscheinen gleichgerichtet mit Vondels
Urteil. Vondels Kunsturteil ist der literarische Niederschlag dessen,
was in Oraniensaal und Stadthaus seine sichtbare Verkörperung ge-
funden hat. Es ist die Kunstpflege der politisch und sozial führenden
Bevölkerungsschichte Hollands. Vondels eigenes künstlerisches Schaffen
ist der vollendete Ausdruck dieser Tendenzen. Es ist keine geringe Ein-
sehätzung des Dichters, wenn der Verfasser seine Schilderung des
bethlehemitischen Kindermordes neben die des Rubens stellt. Der Ver-
gleich wirkt überzeugend. Die geistige Sphäre der beiden Schöpfungen
ist eine verwandte. Vondels Konversion zum Katholizismus wird ver-
standlich, aber mehr als Folge ästhetischen Verhaltens denn seelischer Not.
Schmidt-Degener ist fern davon, wie die Kunstanschauung des
XIX. Jahrhunderts Rembrandt in allem und jedem zum Gegenspieler des
barocken Holland zu machen. »Rembrandt war in seinen zehn ersten
Jahren ebenfalls ein Herold des Barock«. Und weiters: »Eine eigenartige
Unterströmung des holländischen Barock trieb Maler und Dichter, wie
wir sehen werden, eine kurze Zeitlang in dieselbe Richtung«. Jene
Unterströmung ist das Frühbarock der holländischen Caravaggio-Xach-
folger, ein Seitenarm, der in Rembrandts Jugendzeit schon lange nicht
mehr das Strombild der holländischen Entwicklung beherrschte. Rem-
brandt erst hat ihn zur Monumentalität einer wahrhaft holländischen
Barockkunst gesteigert. Wir denken an die Interpretation, die Riegl im
»■Holländischen Gruppenporträt« von Rembrandts Barock gibt. Rembrandt
ist für Riegl der Künstler, der entgegen dem heimischen Prinzip der
Koordination die südliche Barockkunst, die Kunst der Subordination,
durchsetzt. Reibungslos, solange er darin einer ohnedies bestehenden
Tendenz des holländischen Kunstwollens entspricht. Doch unvermeidlich
in Konflikt mit ihm kommend in dem Augenblick, da er — in der
»Nachtwache« — das Subordinationsprinzip in einem Maße zur Geltung
bringt, das mit holländischem Kunstempfinden nicht mehr vereinbar ist.
Sieht Riegl den tragischen Konflikt gerade durch die höchste Steigerung
des Barock in Rembrandts Kunst verursacht, so Schmidt-Degener in der
Durcharbeitung, Durchwühlung, inneren Auflösung, in die Rembrandts
gewaltiger Genius das Barock versetzte. Wie der Künstler um 1630 die
letzte ausklingende Welle des Spätmanierismus brach, so nun die des
Barock. »Rembrandt widmet die Jahre 1642 bis 164S einer eigenartigen
Selbsterneuerung. Er zwingt sich dazu, sich von alledem zu lösen, was
er mit unerhörter Energie dem Barock abgerungen hatte«. Schmidt-Degener
erklärt das als das Sichfinden und Vereinsamen des seine geschichtlichen
Schranken überwachsenden Genius, was Riegl als Zurücklenken in den
Strom des heimatlichen Kunstwollens betrachtet, das Rembrandt nun,
nach Gewinnung der »inneren Einheit«, der letzten Vollendung entgegen-
führt. Riegls Geschichtsbetrachtung ermöglicht den Gedanken an ein
tiefliegendes Verbundensein der anderen großen Meister des klassischen
Zeitalters der holländischen Malerei mit Rembrandt. Die Schmidt-
Degeners sieht die Notwendigkeit von Vereinsamung und völligem Bruch
mit der Umwelt für den, der nicht allein einer kleinen Heimat, sondern
der ganzen Welt gehören sollte. »Rembrandts Einfluß auf das XVII. Jahr-
hundert ist der Einfluß seiner Äußerlichkeiten«. »Als Ganzes betrachtet,
ist die Rembrandt-Schule ein Mißerfolg«.
Daß zwischen Vondel und Rembrandt zur Zeit, als eine Berührung
noch nicht aus inneren Gründen unmöglich war, kein Kontakt erfolgte,
erklärt Schmidt-Degener dadurch, daß Vondels Interesse für die bildende
Kunst noch nicht erwacht war. Als es durch seinen Freund Sandrart
feiten
.«Rembrand'
Stellung Von
VondA der m
J^'fL über Rem"
>bt * de"
^ad Re^randt
"vorubergegan
-denkt
,lB«»i^eine Schüle
Isdftr. die semen
:>.D«generhatd,ese
„-.j, XX. Jahrhundert gelte
f^o« vernichtet Rem
.«ersiehganz anders ai
^ Jahre traf. Die ein
.> die noch erfolgte, i
3j,'iUsvondem genialen
",Vu Campen neuerbaute
'y^us. und «Julius Ci\
^iBäufder Büdfläche des
dgibl Rembrandts Trieb
; s« es nichts mehr, was ih
Kttog ausschließlich der
S! Heilige, Apostel, Evange
ai er mm Ursprung des Ch
,-3sth irie katholisch; er
r.rerden<. Die Worte, die
-Jenbrandts letzten Bild
"iae. was je über den alten
■sbimdlistfurSchmidt-D
m der Renaissancisten,
-• JEhepunkt und Krönung
r.fecMuß. Wir können d
:'iausdehnen. Europas küi
Usance entschieden, sonc
- Grüfe dieses Mittelalters
'nutts empor, deren
' Äsen wie die steinerne
üiidt-Degeners Abhand:
'■äittöie. sondern auch
'Stellung nicht zum Nacl
«USB wieder Vorausset
5 *nt Doch erfassen
;-»ntbald vor, farbigem
dringenden Wort.
'"-aktuelle
'■«■März 1929,
riffsdeduk
ÜBER
58
^BÜCHER
/'*lm Suida, (
Erztlerz°g Ernst
*11 Wien 1926,
■>Arä Austriae«.