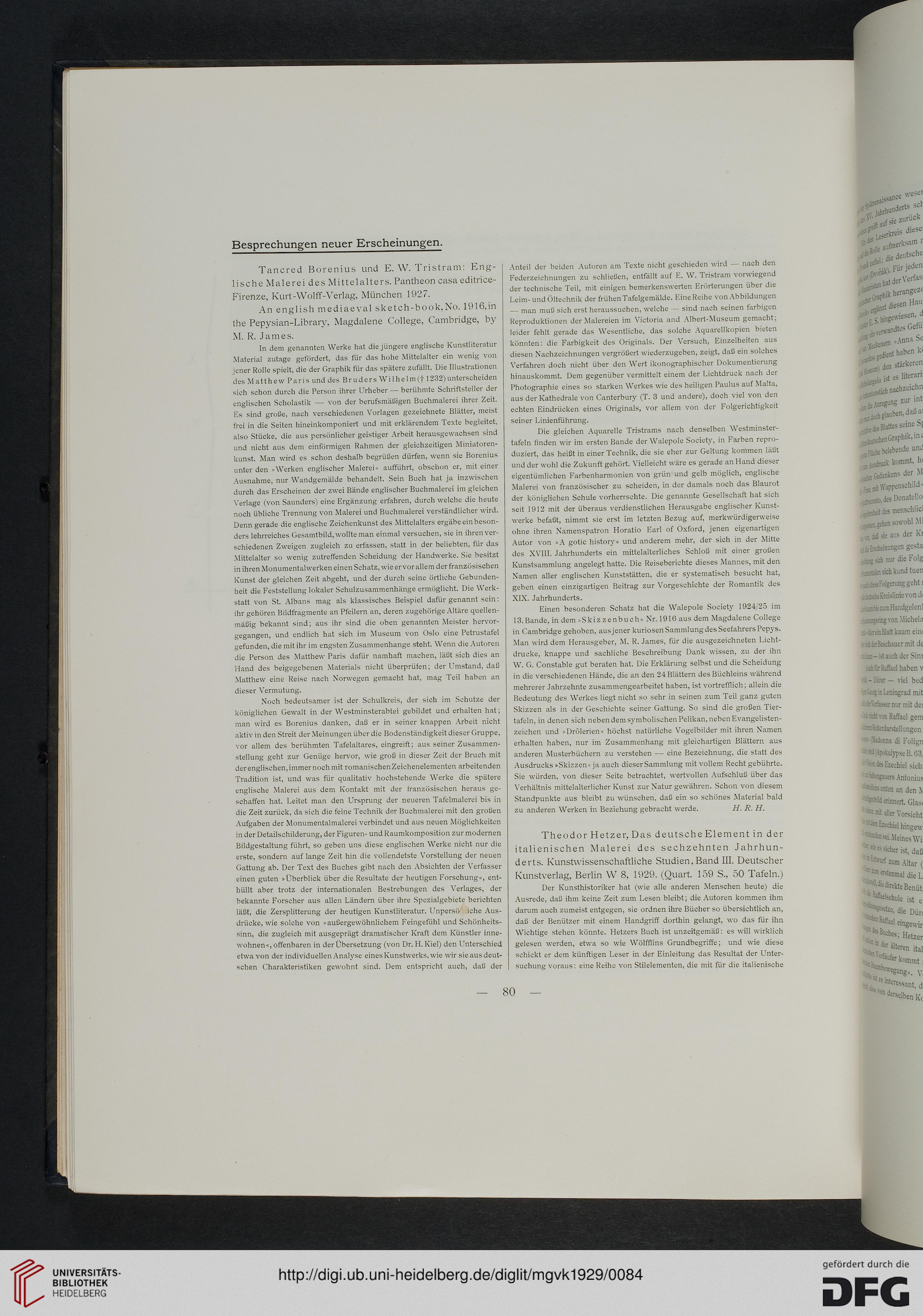Besprechungen neuer Erscheinungen.
Tancred Borenius und E. W. Tristram: Eng-
lische Malerei des Mittelalters. Pantheon casa editrice-
Firenze, Kurt-Wolff-Verlag, München 1927.
An english mediaeval sketch-book,No. 1916,in
the Pepysian-Library, Magdalene College, Cambridge, by
M. R. James.
In dem genannten Werke hat die jüngere englische Kunstliteratur
Material zutage gefördert, das für das hohe Mittelalter ein wenig von
jener Rolle spielt, die der Graphik für das spätere zufallt. Die Illustrationen
des Matthew Paris und des Bruders Wilhelm(f 1232)unterscheiden
sich schon durch die Person ihrer Urheber— berühmte Schriftsteller der
englischen Scholastik — von der berufsmäßigen Buchmalerei ihrer Zeit.
Es sind große, nach verschiedenen Vorlagen gezeichnete Blätter, meist
frei in die Seiten hineinkomponiert und mit erklärendem Texte begleitet,
also Stücke, die aus personlicher geistiger Arbeit herausgewachsen sind
und nicht aus dem einförmigen Rahmen der gleichzeitigen Miniatoren-
kunst. Man wird es schon deshalb begrüßen dürfen, wenn sie Borenius
unter den »Werken englischer Malerei- aufführt, obschon er, mit einer
Ausnahme, nur Wandgemälde behandelt. Sein Buch hat ja inzwischen
durch das Erscheinen der zwei Bände englischer Buchmalerei im gleichen
Verlage (von Saunders) eine Ergänzung erfahren, durch welche die heute
noch übliche Trennung von Malerei und Buchmalerei verständlicher wird.
Denn gerade die englische Zeichenkunst des Mittelalters ergäbe einbeson-
ders lehrreiches Gesamtbild, wollte man einmal versuchen, sie in ihren ver-
schiedenen Zweigen zugleich zu erfassen, statt in der beliebten, für das
Mittelalter so wenig zutreffenden Scheidung der Handwerke. Sie besitzt
in ihren Monumentalwerken einen Schatz, wie er vor allem der französischen
Kunst der gleichen Zeit abgeht, und der durch seine örtliche Gebunden-
heit die Feststellung lokaler Schulzusammenhänge ermöglicht. Die Werk-
statt von St. Albans mag als klassisches Beispiel dafür genannt sein:
ihr gehören Bildfragmente an Pfeilern an, deren zugehörige Altäre quellen-
mäßig bekannt sind; aus ihr sind die oben genannten Meister hervor-
gegangen, und endlich hat sich im Museum von Oslo eine Petrustafel
gefunden, die mit ihr im engsten Zusammenhange steht. Wenn die Autoren
die Person des Matthew Paris dafür namhaft machen, läßt sich dies an
Hand des beigegebenen Materials nicht überprüfen; der Umstand, daß
Matthew eine Reise nach Norwegen gemacht hat, mag Teil haben an
dieser Vermutung.
Noch bedeutsamer ist der Schulkreis, der sich im Schutze der
königlichen Gewalt in der Westminsterabtei gebildet und erhalten hat;
man wird es Borenius danken, daß er in seiner knappen Arbeit nicht
aktiv in den Streit der Meinungen über die Bodenständigkeit dieser Gruppe,
vor allem des berühmten Tafelaltares, eingreift; aus seiner Zusammen-
stellung geht zur Genüge hervor, wie groß in dieser Zeit der Bruch mit
der englischen, immer noch mit romanischenZeichenelementen arbeitenden
Tradition ist, und was für qualitativ hochstehende Werke die spätere
englische Malerei aus dem Kontakt mit der tranzösischen heraus ge-
schaffen hat. Leitet man den Ursprung der neueren Tafelmalerei bis in
die Zeit zurück, da sich die feine Technik der Buchmalerei mit den großen
Aufgaben der Monumentalmalerei verbindet und aus neuen Möglichkeiten
in der Detailschilderung, der Figuren- und Raumkomposition zur modernen
Bildgestaltung führt, so geben uns diese englischen Werke nicht nur die
erste, sondern auf lange Zeit hin die vollendetste Vorstellung der neuen
Gattung ab. Der Text des Buches gibt nach den Absichten der Verfasser
einen guten >Überblick über die Resultate der heutigen Forschung«, ent-
hüllt aber trotz der internationalen Bestrebungen des Verlages, der
bekannte Forscher aus allen Ländern über ihre Spezialgebiete berichten
läßt, die Zersplitterung der heutigen Kunstliteratur. Unpersö .iche Aus-
drücke, wie solche von »außergewöhnlichem Feingefühl und Schönheits-
sinn, die zugleich mit ausgeprägt dramatischer Kraft dem Künstler inne-
wohnen«, offenbaren in der Übersetzung (von Dr. H. Kiel) den Unterschied
etwa von der individuellen Analyse eines Kunstwerks, wie wir sie aus deut-
schen Charakteristiken gewohnt sind. Dem entspricht auch, daß der
Anteil der beiden Autoren am Texte nicht geschieden wird — nach den
Federzeichnungen zu schließen, entfällt auf F.. W. Tristram vorwiegend
der technische Teil, mit einigen bemerkenswerten Erörterungen über die
Leim-und Ültechnik der frühenTafelgemälde. Eine Reihe von Abbildungen
— man muß sich erst heraussuchen, welche — sind nach seinen farbigen
Reproduktionen der Malereien im Victoria and Albert-Museum gemacht;
leider fehlt gerade das Wesentliche, das solche Aquarellkopien bieten
könnten: die Farbigkeit des Originals. Der Versuch, Einzelheiten aus
diesen Nachzeichnungen vergrößert wiederzugeben, zeigt, daß ein solches
Verfahren doch nicht über den Wert ikonographischer Dokumentierung
hinauskommt. Dem gegenüber vermittelt einem der Lichtdruck nach der
Photographie eines so starken Werkes wie des heiligen Paulus auf Malta,
aus der Kathedrale von Canterbury (T. 3 und andere), doch viel von den
echten Eindrücken eines Originals, vor allem von der Folgerichtigkeit
seiner Linienführung.
Die gleichen Aquarelle Tristrams nach denselben Westminster-
tafeln finden wir im ersten Bande der Walepole Society, in Farben repro-
duziert, das heißt in einer Technik, die sie eher zur Geltung kommen läßt
und der wohl die Zukunft gehört. Vielleicht wäre es gerade an Hand dieser
eigentümlichen Farbenharmonien von grün und gelb möglich, englische
Malerei von französischer zu scheiden, in der damals noch das Blaurot
der königlichen Schule vorherrschte. Die genannte Gesellschaft hat sich
seit 1012 mit der überaus verdienstlichen Herausgabe englischer Kunst-
werke befaßt, nimmt sie erst im letzten Bezug auf, merkwürdigerweise
ohne ihren Namenspatron Horatio Earl of Oxford, jenen eigenartigen
Autor von »A gotic history« und anderem mehr, der sich in der Mitte
des XVIII. Jahrhunderts ein mittelalterliches Schloß mit einer großen
Kunstsammlung angelegt hatte. Die Reiseberichte dieses Mannes, mit den
Namen aller englischen Kunststätten, die er systematisch besucht hat,
geben einen einzigartigen Beitrag zur Vorgeschichte der Romantik des
XIX. Jahrhunderts.
Einen besonderen Schatz hat die Walepole Society 1924 25 im
13. Bande, in dem -S kiz zenbuch< Nr. 1916 aus dem Magdalene College
in Cambridge gehoben, aus jener kuriosen Sammlungdes Seefahrers Pepys.
Man wird dem Herausgeber, M. R. James, für die ausgezeichneten Licht-
drucke, knappe und sachliche Beschreibung Dank wissen, zu der ihn
W. G. Constable gut beraten hat. Die Erklärung selbst und die Scheidung
in die verschiedenen Hände, die an den 24 Blättern des Büchleins während
mehrerer Jahrzehnte zusammengearbeitet haben, ist vortrefflich; allein die
Bedeutung des Werkes liegt nicht so sehr in seinen zum Teil ganz guten
Skizzen als in der Geschichte seiner Gattung. So sind die großen Tier-
tafeln, in denen sich neben dem symbolischen Pelikan, neben Evangelisten-
zeichen und >Drölerien« höchst natürliche Vogelbilder mit ihren Namen
erhalten haben, nur im Zusammenhang mit gleichartigen Blättern aus
anderen Musterbüchern zu verstehen — eine Bezeichnung, die statt des
Ausdrucks »Skizzen- ja auch dieserSammlung mit vollem Recht gebührte.
Sie würden, von dieser Seite betrachtet, wertvollen Aufschluß über das
Verhältnis mittelalterlicher Kunst zur Natur gewähren. Schon von diesem
Standpunkte aus bleibt zu wünschen, daß ein so schönes Material bald
zu anderen Werken in Beziehung gebracht werde. H. R. H.
TheodorHetzer, Das de uts che Element in der
italienischen Malerei des sechzehnten Jahrhun-
derts. Kunstwissenschaftliche Studien, Band III. Deutscher
Kunstverlag, Berlin W 8, 1929. (Quart. 159 S., 50 Tafeln.)
Der Kunsthistoriker hat (wie alle anderen Menschen heute) die
Ausrede, daß ihm keine Zeit zum Lesen bleibt; die Autoren kommen ihm
darum auch zumeist entgegen, sie ordnen ihre Bücher so übersichtlich an,
daß der Benützer mit einem Handgriff dorthin gelangt, wo das für ihn
Wichtige stehen könnte. Hetzers Buch ist unzeitgemäß: es will wirklich
gelesen werden, etwa so wie Wolfflins Grundbegriffe; und wie diese
schickt er dem künftigen Leser in der Einleitung das Resultat der Unter-
suchung voraus: eine Reihe von Stilelementen, die mit für die italienische
80 —
-die**'
^.hingewiesen
-Anna
5»istesl,ter;
-^hglaaben.daC
^d«Blattes seine
^FStht belebende
jj.lisdnick kommt,
[ja Gedmkens der
'j,i»itWappensch;
^MesDonate
'^tobtädes mensch]
i56»a,gt»en sowohl
. jtdilsie aus der
;äfelKinungeri ges
jag sich nur die Fo
-jaaita sich kund tue
■JistFolgerunggeht
>is* freiste von
^iiabiszumHandgelenl
r-^mgsring von MicheUi
-j-üereinBlatt kaum e
.-äierBesebauer mit
:m- ist auch der,Sir
.aSrRaffael haben
Dürer — viel bei
;:fatg in Leningrad m
^Verfasser nur mit d)
^iaehtvon Raftael ge:
■asleäerdarstellunge
»(Iladonna di Folif
-^(Apokalypse B.Ii
-'SM des Ezechiel sie„
^-Sebongauers Antoniu
-^ft» unten an den
%Hd erinnert. Gla
stornit aller Vorsicht
^«n Ezechiel hinge«
**iseLMemesW
7*« sicher ist, dal
:3E«t»urf zum Altar
erstenmal die
"^■tekteBenöt
J * fe&elschule ist e
die Dü
:*3«affaelei„gew-
"^te; Hetze,
^vorr derselben K
Tancred Borenius und E. W. Tristram: Eng-
lische Malerei des Mittelalters. Pantheon casa editrice-
Firenze, Kurt-Wolff-Verlag, München 1927.
An english mediaeval sketch-book,No. 1916,in
the Pepysian-Library, Magdalene College, Cambridge, by
M. R. James.
In dem genannten Werke hat die jüngere englische Kunstliteratur
Material zutage gefördert, das für das hohe Mittelalter ein wenig von
jener Rolle spielt, die der Graphik für das spätere zufallt. Die Illustrationen
des Matthew Paris und des Bruders Wilhelm(f 1232)unterscheiden
sich schon durch die Person ihrer Urheber— berühmte Schriftsteller der
englischen Scholastik — von der berufsmäßigen Buchmalerei ihrer Zeit.
Es sind große, nach verschiedenen Vorlagen gezeichnete Blätter, meist
frei in die Seiten hineinkomponiert und mit erklärendem Texte begleitet,
also Stücke, die aus personlicher geistiger Arbeit herausgewachsen sind
und nicht aus dem einförmigen Rahmen der gleichzeitigen Miniatoren-
kunst. Man wird es schon deshalb begrüßen dürfen, wenn sie Borenius
unter den »Werken englischer Malerei- aufführt, obschon er, mit einer
Ausnahme, nur Wandgemälde behandelt. Sein Buch hat ja inzwischen
durch das Erscheinen der zwei Bände englischer Buchmalerei im gleichen
Verlage (von Saunders) eine Ergänzung erfahren, durch welche die heute
noch übliche Trennung von Malerei und Buchmalerei verständlicher wird.
Denn gerade die englische Zeichenkunst des Mittelalters ergäbe einbeson-
ders lehrreiches Gesamtbild, wollte man einmal versuchen, sie in ihren ver-
schiedenen Zweigen zugleich zu erfassen, statt in der beliebten, für das
Mittelalter so wenig zutreffenden Scheidung der Handwerke. Sie besitzt
in ihren Monumentalwerken einen Schatz, wie er vor allem der französischen
Kunst der gleichen Zeit abgeht, und der durch seine örtliche Gebunden-
heit die Feststellung lokaler Schulzusammenhänge ermöglicht. Die Werk-
statt von St. Albans mag als klassisches Beispiel dafür genannt sein:
ihr gehören Bildfragmente an Pfeilern an, deren zugehörige Altäre quellen-
mäßig bekannt sind; aus ihr sind die oben genannten Meister hervor-
gegangen, und endlich hat sich im Museum von Oslo eine Petrustafel
gefunden, die mit ihr im engsten Zusammenhange steht. Wenn die Autoren
die Person des Matthew Paris dafür namhaft machen, läßt sich dies an
Hand des beigegebenen Materials nicht überprüfen; der Umstand, daß
Matthew eine Reise nach Norwegen gemacht hat, mag Teil haben an
dieser Vermutung.
Noch bedeutsamer ist der Schulkreis, der sich im Schutze der
königlichen Gewalt in der Westminsterabtei gebildet und erhalten hat;
man wird es Borenius danken, daß er in seiner knappen Arbeit nicht
aktiv in den Streit der Meinungen über die Bodenständigkeit dieser Gruppe,
vor allem des berühmten Tafelaltares, eingreift; aus seiner Zusammen-
stellung geht zur Genüge hervor, wie groß in dieser Zeit der Bruch mit
der englischen, immer noch mit romanischenZeichenelementen arbeitenden
Tradition ist, und was für qualitativ hochstehende Werke die spätere
englische Malerei aus dem Kontakt mit der tranzösischen heraus ge-
schaffen hat. Leitet man den Ursprung der neueren Tafelmalerei bis in
die Zeit zurück, da sich die feine Technik der Buchmalerei mit den großen
Aufgaben der Monumentalmalerei verbindet und aus neuen Möglichkeiten
in der Detailschilderung, der Figuren- und Raumkomposition zur modernen
Bildgestaltung führt, so geben uns diese englischen Werke nicht nur die
erste, sondern auf lange Zeit hin die vollendetste Vorstellung der neuen
Gattung ab. Der Text des Buches gibt nach den Absichten der Verfasser
einen guten >Überblick über die Resultate der heutigen Forschung«, ent-
hüllt aber trotz der internationalen Bestrebungen des Verlages, der
bekannte Forscher aus allen Ländern über ihre Spezialgebiete berichten
läßt, die Zersplitterung der heutigen Kunstliteratur. Unpersö .iche Aus-
drücke, wie solche von »außergewöhnlichem Feingefühl und Schönheits-
sinn, die zugleich mit ausgeprägt dramatischer Kraft dem Künstler inne-
wohnen«, offenbaren in der Übersetzung (von Dr. H. Kiel) den Unterschied
etwa von der individuellen Analyse eines Kunstwerks, wie wir sie aus deut-
schen Charakteristiken gewohnt sind. Dem entspricht auch, daß der
Anteil der beiden Autoren am Texte nicht geschieden wird — nach den
Federzeichnungen zu schließen, entfällt auf F.. W. Tristram vorwiegend
der technische Teil, mit einigen bemerkenswerten Erörterungen über die
Leim-und Ültechnik der frühenTafelgemälde. Eine Reihe von Abbildungen
— man muß sich erst heraussuchen, welche — sind nach seinen farbigen
Reproduktionen der Malereien im Victoria and Albert-Museum gemacht;
leider fehlt gerade das Wesentliche, das solche Aquarellkopien bieten
könnten: die Farbigkeit des Originals. Der Versuch, Einzelheiten aus
diesen Nachzeichnungen vergrößert wiederzugeben, zeigt, daß ein solches
Verfahren doch nicht über den Wert ikonographischer Dokumentierung
hinauskommt. Dem gegenüber vermittelt einem der Lichtdruck nach der
Photographie eines so starken Werkes wie des heiligen Paulus auf Malta,
aus der Kathedrale von Canterbury (T. 3 und andere), doch viel von den
echten Eindrücken eines Originals, vor allem von der Folgerichtigkeit
seiner Linienführung.
Die gleichen Aquarelle Tristrams nach denselben Westminster-
tafeln finden wir im ersten Bande der Walepole Society, in Farben repro-
duziert, das heißt in einer Technik, die sie eher zur Geltung kommen läßt
und der wohl die Zukunft gehört. Vielleicht wäre es gerade an Hand dieser
eigentümlichen Farbenharmonien von grün und gelb möglich, englische
Malerei von französischer zu scheiden, in der damals noch das Blaurot
der königlichen Schule vorherrschte. Die genannte Gesellschaft hat sich
seit 1012 mit der überaus verdienstlichen Herausgabe englischer Kunst-
werke befaßt, nimmt sie erst im letzten Bezug auf, merkwürdigerweise
ohne ihren Namenspatron Horatio Earl of Oxford, jenen eigenartigen
Autor von »A gotic history« und anderem mehr, der sich in der Mitte
des XVIII. Jahrhunderts ein mittelalterliches Schloß mit einer großen
Kunstsammlung angelegt hatte. Die Reiseberichte dieses Mannes, mit den
Namen aller englischen Kunststätten, die er systematisch besucht hat,
geben einen einzigartigen Beitrag zur Vorgeschichte der Romantik des
XIX. Jahrhunderts.
Einen besonderen Schatz hat die Walepole Society 1924 25 im
13. Bande, in dem -S kiz zenbuch< Nr. 1916 aus dem Magdalene College
in Cambridge gehoben, aus jener kuriosen Sammlungdes Seefahrers Pepys.
Man wird dem Herausgeber, M. R. James, für die ausgezeichneten Licht-
drucke, knappe und sachliche Beschreibung Dank wissen, zu der ihn
W. G. Constable gut beraten hat. Die Erklärung selbst und die Scheidung
in die verschiedenen Hände, die an den 24 Blättern des Büchleins während
mehrerer Jahrzehnte zusammengearbeitet haben, ist vortrefflich; allein die
Bedeutung des Werkes liegt nicht so sehr in seinen zum Teil ganz guten
Skizzen als in der Geschichte seiner Gattung. So sind die großen Tier-
tafeln, in denen sich neben dem symbolischen Pelikan, neben Evangelisten-
zeichen und >Drölerien« höchst natürliche Vogelbilder mit ihren Namen
erhalten haben, nur im Zusammenhang mit gleichartigen Blättern aus
anderen Musterbüchern zu verstehen — eine Bezeichnung, die statt des
Ausdrucks »Skizzen- ja auch dieserSammlung mit vollem Recht gebührte.
Sie würden, von dieser Seite betrachtet, wertvollen Aufschluß über das
Verhältnis mittelalterlicher Kunst zur Natur gewähren. Schon von diesem
Standpunkte aus bleibt zu wünschen, daß ein so schönes Material bald
zu anderen Werken in Beziehung gebracht werde. H. R. H.
TheodorHetzer, Das de uts che Element in der
italienischen Malerei des sechzehnten Jahrhun-
derts. Kunstwissenschaftliche Studien, Band III. Deutscher
Kunstverlag, Berlin W 8, 1929. (Quart. 159 S., 50 Tafeln.)
Der Kunsthistoriker hat (wie alle anderen Menschen heute) die
Ausrede, daß ihm keine Zeit zum Lesen bleibt; die Autoren kommen ihm
darum auch zumeist entgegen, sie ordnen ihre Bücher so übersichtlich an,
daß der Benützer mit einem Handgriff dorthin gelangt, wo das für ihn
Wichtige stehen könnte. Hetzers Buch ist unzeitgemäß: es will wirklich
gelesen werden, etwa so wie Wolfflins Grundbegriffe; und wie diese
schickt er dem künftigen Leser in der Einleitung das Resultat der Unter-
suchung voraus: eine Reihe von Stilelementen, die mit für die italienische
80 —
-die**'
^.hingewiesen
-Anna
5»istesl,ter;
-^hglaaben.daC
^d«Blattes seine
^FStht belebende
jj.lisdnick kommt,
[ja Gedmkens der
'j,i»itWappensch;
^MesDonate
'^tobtädes mensch]
i56»a,gt»en sowohl
. jtdilsie aus der
;äfelKinungeri ges
jag sich nur die Fo
-jaaita sich kund tue
■JistFolgerunggeht
>is* freiste von
^iiabiszumHandgelenl
r-^mgsring von MicheUi
-j-üereinBlatt kaum e
.-äierBesebauer mit
:m- ist auch der,Sir
.aSrRaffael haben
Dürer — viel bei
;:fatg in Leningrad m
^Verfasser nur mit d)
^iaehtvon Raftael ge:
■asleäerdarstellunge
»(Iladonna di Folif
-^(Apokalypse B.Ii
-'SM des Ezechiel sie„
^-Sebongauers Antoniu
-^ft» unten an den
%Hd erinnert. Gla
stornit aller Vorsicht
^«n Ezechiel hinge«
**iseLMemesW
7*« sicher ist, dal
:3E«t»urf zum Altar
erstenmal die
"^■tekteBenöt
J * fe&elschule ist e
die Dü
:*3«affaelei„gew-
"^te; Hetze,
^vorr derselben K