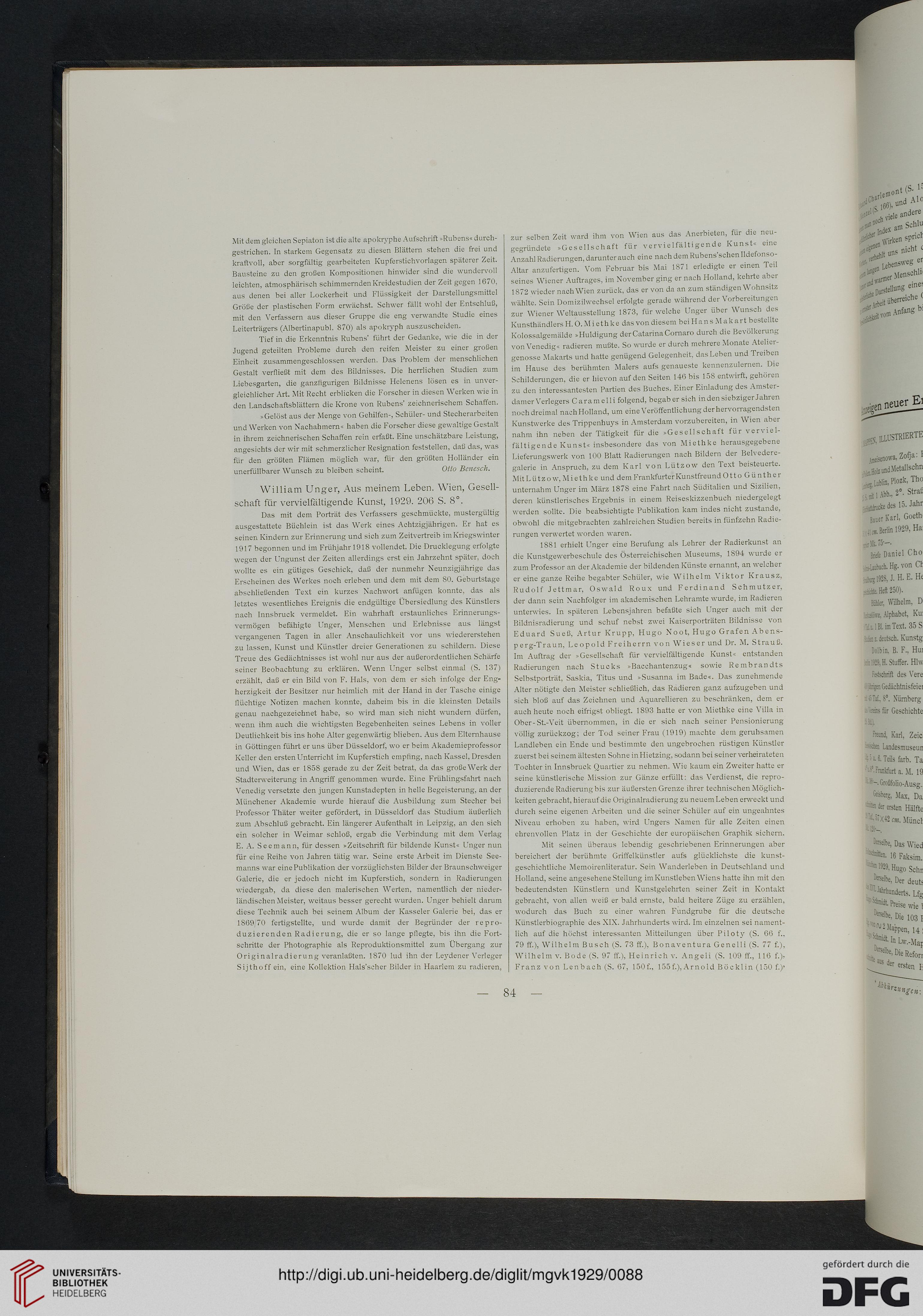Mit dem gleichen Sepiaton ist die alte apokryphe Aufschrift .Rubens« durch-
gestrichen. In starkem Gegensatz zu diesen Blättern stehen die frei und
kraftvoll, aber sorgfaltig gearbeiteten Kupferstichvorlagen späterer Zeit.
Bausteine zu den großen Kompositionen hinwider sind die wundervoll
leichten, atmosphärisch schimmernden Kreidestudien der Zeit gegen 1670,
aus denen bei aller Lockerheit und Flüssigkeit der Darstellungsmittel
Größe der plastischen Form erwächst. Schwer fällt wohl der Entschluß,
mit den Verfassern aus dieser Gruppe die eng verwandte Studie eines
Leiterträgers (Albertinapubl. 870) als apokryph auszuscheiden.
Tief in die Erkenntnis Rubens' führt der Gedanke, wie die in der
Jugend geteilten Probleme durch den reifen Meister zu einer großen
Einheit zusammengeschlossen werden. Das Problem der menschlichen
Gestalt verfließt mit dem des Bildnisses. Die herrlichen Studien zum
Liebesgarten, die ganzhgurigen Bildnisse Helenens lösen es in unver-
gleichlicher Art. Mit Recht erblicken die Forscher in diesen Werken wie in
den Landschaftsblättern die Krone von Rubens' zeichnerischem Schaffen.
»Gelöst aus der Menge von Gehilfen-, Schüler- und Stecherarbeiten
und Werken von Nachahmern« haben die Forscher diese gewaltige Gestalt
in ihrem zeichnerischen Schaffen rein erfaßt. Eine unschätzbare Leistung,
angesichts der wir mit schmerzlicher Resignation feststellen, daß das, was
für den größten Flämen möglich war, für den größten Holländer ein
unerfüllbarer Wunsch zu bleiben scheint. Otto Baicsch.
William Unger, Aus meinem Leben. Wien, Gesell-
schaft für vervielfältigende Kunst, 1929. 206 S. 8°.
Das mit dem Porträt des Verfassers geschmückte, mustergültig
ausgestattete Büchlein ist das Werk eines Achtzigjährigen. Er hat es
seinen Kindern zur Erinnerung und sich zum Zeitvertreib im Kriegs winter
1917 begonnen und im Frühjahr 1918 vollendet. Die Drucklegung erfolgte
wegen der Ungunst der Zeiten allerdings erst ein Jahrzehnt später, doch
wollte es ein gütiges Geschick, daß der nunmehr Neunzigjährige das
Erscheinen des Werkes noch erleben und dem mit dem SO. Geburtstage
abschließenden Text ein kurzes Nachwort anfügen konnte, das als
letztes wesentliches Ereignis die endgültige Übersiedlung des Künstlers
nach Innsbruck vermeldet. Ein wahrhaft erstaunliches Erinnerungs-
vermögen befähigte Unger, Menschen und Erlebnisse aus längst
vergangenen Tagen in aller Anschaulichkeit vor uns wiedererstehen
zu lassen, Kunst und Künstler dreier Generationen zu schildern. Diese
Treue des Gedächtnisses ist wohl nur aus der außerordentlichen Scharfe
seiner Beobachtung zu erklären. Wenn Unger selbst einmal (S. 137)
erzählt, daß er ein Bild von F. Hals, von dem er sich infoige der Eng-
herzigkeit der Besitzer nur heimlich mit der Hand in der Tasche einige
flüchtige Notizen machen konnte, daheim bis in die kleinsten Details
genau nachgezeichnet habe, so wird man sich nicht wundern dürfen,
wenn ihm auch die wichtigsten Begebenheiten seines Lebens in voller
Deutlichkeit bis ins hohe Alter gegenwärtig blieben. Aus dem Elternhause
in Göttingen führt er uns über Düsseldorf, wo er beim Akademieprofessor
Keller den ersten Unterricht im Kupferstich empfing, nach Kassel, Dresden
und Wien, das er 1858 gerade zu der Zeit betrat, da das große Werk der
Stadterweiterung in Angriff genommen wurde. Eine Frühlingsfahrt nach
Venedig versetzte den jungen Kunstadepten in helle Begeisterung, an der
Münchener Akademie wurde hierauf die Ausbildung zum Stecher bei
Professor Thäter weiter gefördert, in Düsseldorf das Studium äußerlich
zum Abschluß gebracht. Ein längerer Aufenthalt in Leipzig, an den sich
ein solcher in Weimar schloß, ergab die Verbindung mit dem Verlag
E. A. Seemann, für dessen »Zeitschrift für bildende Kunst« Unger nun
für eine Reihe von Jahren tätig war. Seine erste Arbeit im Dienste See-
manns war eine Publikation der vorzüglichsten Bilder der Braunschweiger
Galerie, die er jedoch nicht im Kupferstich, sondern in Radierungen
wiedergab, da diese den malerischen Werten, namentlich der nieder-
ländischen Meister, weitaus besser gerecht wurden. Unger behielt darum
diese Technik auch bei seinem Album der Kasseler Galerie bei, das er
1869 70 fertigstellte, und wurde damit der Begründer der repro-
duzierenden Radierung, die er so lange pflegte, bis ihn die Fort-
schritte der Photographie als Reproduktionsmittel zum Übergang zur
Originalradierung veranlaßten. 1870 lud ihn der Leydener Verleger
Sijthoff ein, eine Kollektion Hals'scher Bilder in Haarlem zu radieren,
zur selben Zeit ward ihm von Wien aus das Anerbieten, für die neu-
gegründete »Gesellschaft für vervielfältigende Kunst« eine
Anzahl Radierungen, darunter auch eine nach dem Rubcns'schen Ildefonso-
Altar anzufertigen. Vom Februar bis Mai 1871 erledigte er einen Teil
seines Wiener Auftrages, im November ging er nach Holland, kehrte aber
1872 wieder nach Wien zurück, das er von da an zum ständigen Wohnsitz
wählte. Sein Domizilwechsel erfolgte gerade während der Vorbereitungen
zur Wiener Weltausstellung 1873, für welche Unger über Wunsch des
Kunsthändlers H. O. M i et h k e das von diesem bei H a n s M a k a rt bestellte
Kolossalgemälde »Huldigung derCatarinaCornaro durch die Bevölkerung
von Venedig« radieren mußte. So wurde er durch mehrere Monate Atelier-
genosse Makarts und hatte genügend Gelegenheit, das Leben und Treiben
im Hause des berühmten Malers aufs genaueste kennenzulernen. Die
Schilderungen, die er hievon auf den Seiten 146 bis 158 entwirft, gehören
zu den interessantesten Partien des Buches. Einer Einladung des Amster-
damer Verlegers Caramelli folgend, begab er sich in den siebziger Jahren
noch dreimal nachHolland, um eine Veröffentlichung derhervorragendsten
Kunstwerke des Trippenhuys in Amsterdam vorzubereiten, in Wien aber
nahm ihn neben der Tätigkeit für die »Gesellschaft für verviel-
fältigende Kunst« insbesondere das von Miethke herausgegebene
Lieferungswerk von 100 Blatt Radierungen nach Bildern der Belvedere-
galerie in Anspruch, zu dem Karl von Lützow den Text beisteuerte.
Mit Lütz o\v. Miethke und dem Frankfurter Kunstfreund Otto Günther
unternahm Unger im März 1878 eine Fahrt nach Süditalien und Sizilien,
deren künstlerisches Ergebnis in einem Reiseskizzenbuch niedergelegt
werden sollte. Die beabsichtigte Publikation kam indes nicht zustande,
obwohl die mitgebrachten zahlreichen Studien bereits in fünfzehn Radie-
rungen verwertet worden waren.
1881 erhielt Unger eine Berufung als Lehrer der Radierkunst an
die Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums, 1894 wurde er
zum Professor an der Akademie der bildenden Künste ernannt, an welcher
er eine ganze Reihe begabter Schüler, wie Wilhelm Viktor Krausz,
Rudolf Jettmar, Oswald Roux und Ferdinand Schmutzer,
der dann sein Nachfolger im akademischen Lehramte wurde, im Radieren
unterwies. In späteren Lebensjahren befaßte sich Unger auch mit der
Bildnisradierung und schuf nebst zwei Kaiserporträten Bildnisse von
Eduard Sueß, Artur Krupp, Hugo Noot, Hugo Grafen Abens-
p erg-Traun, Leopold Freiherrn von Wies e r und Dr. M. Strau ß.
Im Auftrag der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst* entstanden
Radierungen nach Stucks »Bacchantenzug« sowie Re mb ran dts
Selbstporträt, Saskia, Titus und »Susanna im Bade«. Das zunehmende
Alter nötigte den Meister schließlich, das Radieren ganz aufzugeben und
sich bloß auf das Zeichnen und Aquarellieren zu beschränken, dem er
auch heute noch eifrigst obliegt. 1893 hatte er von Miethke eine Villa in
Ober-St.-Veit übernommen, in die er sich nach seiner Pensionierung
völlig zurückzog; der Tod seiner Frau (1919) machte dem geruhsamen
Landleben ein Ende und bestimmte den ungebrochen rüstigen Künstler
zuerst bei seinem ältesten Sohne in Hietzing, sodann bei seiner verheirateten
Tochter in Innsbruck Quartier zu nehmen. Wie kaum ein Zweiter hatte er
seine künstlerische Mission zur Gänze erfüllt: das Verdienst, die repro-
duzierende Radierung bis zur äußersten Grenze ihrer technischen Möglich-
keiten gebracht, hierauf die Originalradierung zu neuem Leben erweckt und
durch seine eigenen Arbeiten und die seiner Schüler auf ein ungeahntes
Niveau erhoben zu haben, wird Ungers Namen für alle Zeiten einen
ehrenvollen Platz in der Geschichte der europäischen Graphik sichern.
Mit seinen überaus lebendig geschriebenen Erinnerungen aber
bereichert der berühmte Griffelkünstler aufs glücklichste die kunst-
geschichtliche Memoirenliteratur. Sein Wanderleben in Deutschland und
Holland, seine angesehene Stellung imKunstleben Wiens hatte ihn mit den
bedeutendsten Künstlern und Kunstgelehrten seiner Zeit in Kontakt
gebracht, von allen weiß er bald ernste, bald heitere Züge zu erzählen,
wodurch das Buch zu einer wahren Fundgrube für die deutsche
Künstlerbiographie des XIX. Jahrhunderts wird. Im einzelnen sei nament-
lich auf die höchst interessanten Mitteilungen über Piloty (S. 66 f..
79 ff.), Wilhelm Busch (S. 73 ff.), Bonaventura Genelli (S. 77 f.).
Wilhelm v. Bode (S. 97 ff.), Heinrich v. Angeli (S. 109 ff., 116 f.>
Franz von Lenbach (S. 67, 150f., 155f.), Arnold Böcklin (150 f.)'
gestrichen. In starkem Gegensatz zu diesen Blättern stehen die frei und
kraftvoll, aber sorgfaltig gearbeiteten Kupferstichvorlagen späterer Zeit.
Bausteine zu den großen Kompositionen hinwider sind die wundervoll
leichten, atmosphärisch schimmernden Kreidestudien der Zeit gegen 1670,
aus denen bei aller Lockerheit und Flüssigkeit der Darstellungsmittel
Größe der plastischen Form erwächst. Schwer fällt wohl der Entschluß,
mit den Verfassern aus dieser Gruppe die eng verwandte Studie eines
Leiterträgers (Albertinapubl. 870) als apokryph auszuscheiden.
Tief in die Erkenntnis Rubens' führt der Gedanke, wie die in der
Jugend geteilten Probleme durch den reifen Meister zu einer großen
Einheit zusammengeschlossen werden. Das Problem der menschlichen
Gestalt verfließt mit dem des Bildnisses. Die herrlichen Studien zum
Liebesgarten, die ganzhgurigen Bildnisse Helenens lösen es in unver-
gleichlicher Art. Mit Recht erblicken die Forscher in diesen Werken wie in
den Landschaftsblättern die Krone von Rubens' zeichnerischem Schaffen.
»Gelöst aus der Menge von Gehilfen-, Schüler- und Stecherarbeiten
und Werken von Nachahmern« haben die Forscher diese gewaltige Gestalt
in ihrem zeichnerischen Schaffen rein erfaßt. Eine unschätzbare Leistung,
angesichts der wir mit schmerzlicher Resignation feststellen, daß das, was
für den größten Flämen möglich war, für den größten Holländer ein
unerfüllbarer Wunsch zu bleiben scheint. Otto Baicsch.
William Unger, Aus meinem Leben. Wien, Gesell-
schaft für vervielfältigende Kunst, 1929. 206 S. 8°.
Das mit dem Porträt des Verfassers geschmückte, mustergültig
ausgestattete Büchlein ist das Werk eines Achtzigjährigen. Er hat es
seinen Kindern zur Erinnerung und sich zum Zeitvertreib im Kriegs winter
1917 begonnen und im Frühjahr 1918 vollendet. Die Drucklegung erfolgte
wegen der Ungunst der Zeiten allerdings erst ein Jahrzehnt später, doch
wollte es ein gütiges Geschick, daß der nunmehr Neunzigjährige das
Erscheinen des Werkes noch erleben und dem mit dem SO. Geburtstage
abschließenden Text ein kurzes Nachwort anfügen konnte, das als
letztes wesentliches Ereignis die endgültige Übersiedlung des Künstlers
nach Innsbruck vermeldet. Ein wahrhaft erstaunliches Erinnerungs-
vermögen befähigte Unger, Menschen und Erlebnisse aus längst
vergangenen Tagen in aller Anschaulichkeit vor uns wiedererstehen
zu lassen, Kunst und Künstler dreier Generationen zu schildern. Diese
Treue des Gedächtnisses ist wohl nur aus der außerordentlichen Scharfe
seiner Beobachtung zu erklären. Wenn Unger selbst einmal (S. 137)
erzählt, daß er ein Bild von F. Hals, von dem er sich infoige der Eng-
herzigkeit der Besitzer nur heimlich mit der Hand in der Tasche einige
flüchtige Notizen machen konnte, daheim bis in die kleinsten Details
genau nachgezeichnet habe, so wird man sich nicht wundern dürfen,
wenn ihm auch die wichtigsten Begebenheiten seines Lebens in voller
Deutlichkeit bis ins hohe Alter gegenwärtig blieben. Aus dem Elternhause
in Göttingen führt er uns über Düsseldorf, wo er beim Akademieprofessor
Keller den ersten Unterricht im Kupferstich empfing, nach Kassel, Dresden
und Wien, das er 1858 gerade zu der Zeit betrat, da das große Werk der
Stadterweiterung in Angriff genommen wurde. Eine Frühlingsfahrt nach
Venedig versetzte den jungen Kunstadepten in helle Begeisterung, an der
Münchener Akademie wurde hierauf die Ausbildung zum Stecher bei
Professor Thäter weiter gefördert, in Düsseldorf das Studium äußerlich
zum Abschluß gebracht. Ein längerer Aufenthalt in Leipzig, an den sich
ein solcher in Weimar schloß, ergab die Verbindung mit dem Verlag
E. A. Seemann, für dessen »Zeitschrift für bildende Kunst« Unger nun
für eine Reihe von Jahren tätig war. Seine erste Arbeit im Dienste See-
manns war eine Publikation der vorzüglichsten Bilder der Braunschweiger
Galerie, die er jedoch nicht im Kupferstich, sondern in Radierungen
wiedergab, da diese den malerischen Werten, namentlich der nieder-
ländischen Meister, weitaus besser gerecht wurden. Unger behielt darum
diese Technik auch bei seinem Album der Kasseler Galerie bei, das er
1869 70 fertigstellte, und wurde damit der Begründer der repro-
duzierenden Radierung, die er so lange pflegte, bis ihn die Fort-
schritte der Photographie als Reproduktionsmittel zum Übergang zur
Originalradierung veranlaßten. 1870 lud ihn der Leydener Verleger
Sijthoff ein, eine Kollektion Hals'scher Bilder in Haarlem zu radieren,
zur selben Zeit ward ihm von Wien aus das Anerbieten, für die neu-
gegründete »Gesellschaft für vervielfältigende Kunst« eine
Anzahl Radierungen, darunter auch eine nach dem Rubcns'schen Ildefonso-
Altar anzufertigen. Vom Februar bis Mai 1871 erledigte er einen Teil
seines Wiener Auftrages, im November ging er nach Holland, kehrte aber
1872 wieder nach Wien zurück, das er von da an zum ständigen Wohnsitz
wählte. Sein Domizilwechsel erfolgte gerade während der Vorbereitungen
zur Wiener Weltausstellung 1873, für welche Unger über Wunsch des
Kunsthändlers H. O. M i et h k e das von diesem bei H a n s M a k a rt bestellte
Kolossalgemälde »Huldigung derCatarinaCornaro durch die Bevölkerung
von Venedig« radieren mußte. So wurde er durch mehrere Monate Atelier-
genosse Makarts und hatte genügend Gelegenheit, das Leben und Treiben
im Hause des berühmten Malers aufs genaueste kennenzulernen. Die
Schilderungen, die er hievon auf den Seiten 146 bis 158 entwirft, gehören
zu den interessantesten Partien des Buches. Einer Einladung des Amster-
damer Verlegers Caramelli folgend, begab er sich in den siebziger Jahren
noch dreimal nachHolland, um eine Veröffentlichung derhervorragendsten
Kunstwerke des Trippenhuys in Amsterdam vorzubereiten, in Wien aber
nahm ihn neben der Tätigkeit für die »Gesellschaft für verviel-
fältigende Kunst« insbesondere das von Miethke herausgegebene
Lieferungswerk von 100 Blatt Radierungen nach Bildern der Belvedere-
galerie in Anspruch, zu dem Karl von Lützow den Text beisteuerte.
Mit Lütz o\v. Miethke und dem Frankfurter Kunstfreund Otto Günther
unternahm Unger im März 1878 eine Fahrt nach Süditalien und Sizilien,
deren künstlerisches Ergebnis in einem Reiseskizzenbuch niedergelegt
werden sollte. Die beabsichtigte Publikation kam indes nicht zustande,
obwohl die mitgebrachten zahlreichen Studien bereits in fünfzehn Radie-
rungen verwertet worden waren.
1881 erhielt Unger eine Berufung als Lehrer der Radierkunst an
die Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums, 1894 wurde er
zum Professor an der Akademie der bildenden Künste ernannt, an welcher
er eine ganze Reihe begabter Schüler, wie Wilhelm Viktor Krausz,
Rudolf Jettmar, Oswald Roux und Ferdinand Schmutzer,
der dann sein Nachfolger im akademischen Lehramte wurde, im Radieren
unterwies. In späteren Lebensjahren befaßte sich Unger auch mit der
Bildnisradierung und schuf nebst zwei Kaiserporträten Bildnisse von
Eduard Sueß, Artur Krupp, Hugo Noot, Hugo Grafen Abens-
p erg-Traun, Leopold Freiherrn von Wies e r und Dr. M. Strau ß.
Im Auftrag der Gesellschaft für vervielfältigende Kunst* entstanden
Radierungen nach Stucks »Bacchantenzug« sowie Re mb ran dts
Selbstporträt, Saskia, Titus und »Susanna im Bade«. Das zunehmende
Alter nötigte den Meister schließlich, das Radieren ganz aufzugeben und
sich bloß auf das Zeichnen und Aquarellieren zu beschränken, dem er
auch heute noch eifrigst obliegt. 1893 hatte er von Miethke eine Villa in
Ober-St.-Veit übernommen, in die er sich nach seiner Pensionierung
völlig zurückzog; der Tod seiner Frau (1919) machte dem geruhsamen
Landleben ein Ende und bestimmte den ungebrochen rüstigen Künstler
zuerst bei seinem ältesten Sohne in Hietzing, sodann bei seiner verheirateten
Tochter in Innsbruck Quartier zu nehmen. Wie kaum ein Zweiter hatte er
seine künstlerische Mission zur Gänze erfüllt: das Verdienst, die repro-
duzierende Radierung bis zur äußersten Grenze ihrer technischen Möglich-
keiten gebracht, hierauf die Originalradierung zu neuem Leben erweckt und
durch seine eigenen Arbeiten und die seiner Schüler auf ein ungeahntes
Niveau erhoben zu haben, wird Ungers Namen für alle Zeiten einen
ehrenvollen Platz in der Geschichte der europäischen Graphik sichern.
Mit seinen überaus lebendig geschriebenen Erinnerungen aber
bereichert der berühmte Griffelkünstler aufs glücklichste die kunst-
geschichtliche Memoirenliteratur. Sein Wanderleben in Deutschland und
Holland, seine angesehene Stellung imKunstleben Wiens hatte ihn mit den
bedeutendsten Künstlern und Kunstgelehrten seiner Zeit in Kontakt
gebracht, von allen weiß er bald ernste, bald heitere Züge zu erzählen,
wodurch das Buch zu einer wahren Fundgrube für die deutsche
Künstlerbiographie des XIX. Jahrhunderts wird. Im einzelnen sei nament-
lich auf die höchst interessanten Mitteilungen über Piloty (S. 66 f..
79 ff.), Wilhelm Busch (S. 73 ff.), Bonaventura Genelli (S. 77 f.).
Wilhelm v. Bode (S. 97 ff.), Heinrich v. Angeli (S. 109 ff., 116 f.>
Franz von Lenbach (S. 67, 150f., 155f.), Arnold Böcklin (150 f.)'