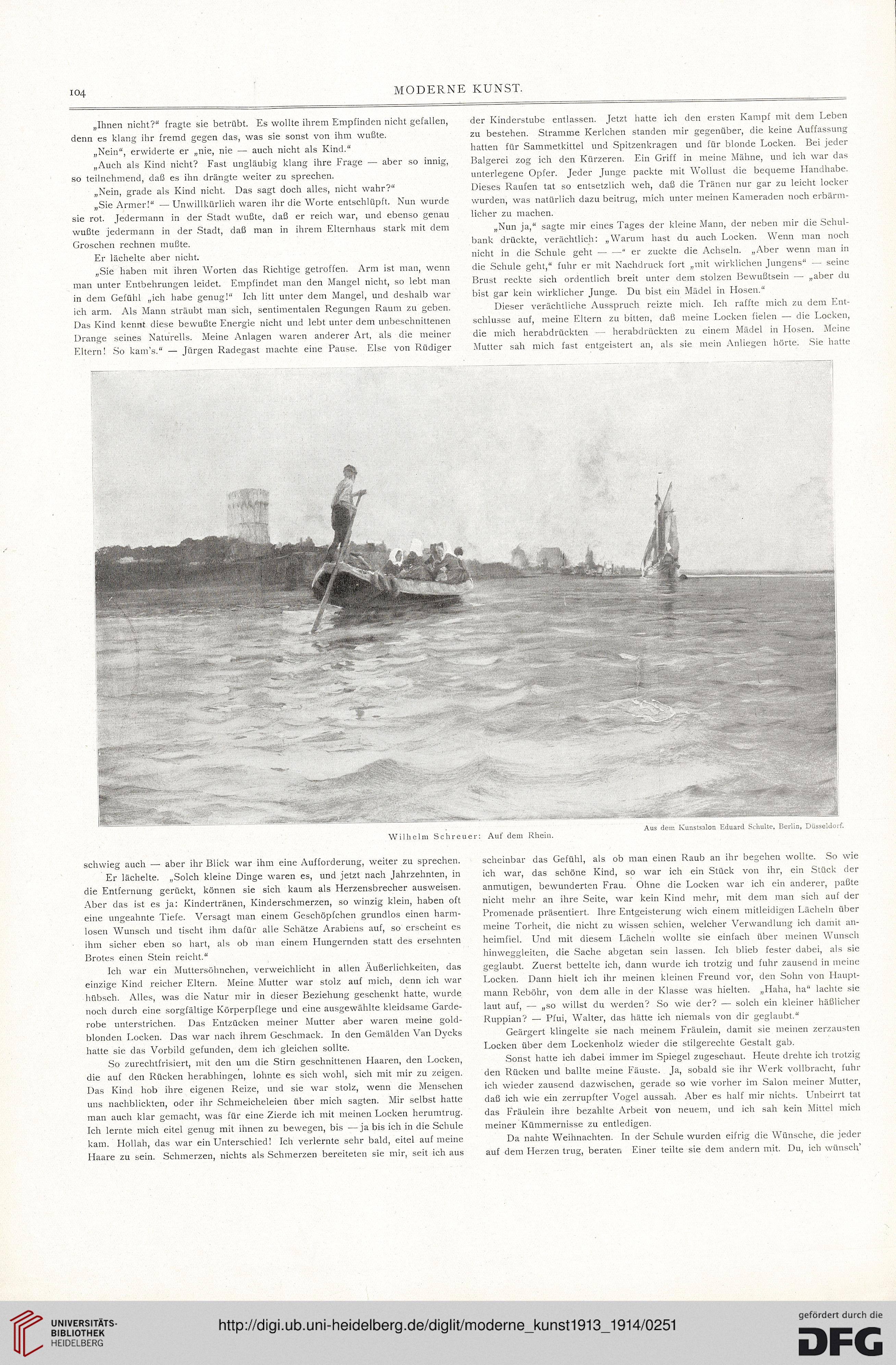104
MODERNE KUNST.
„Ihnen nicht?“ fragte sie betrübt. Es wollte ihrem Empfinden nicht gefallen,
denn es klang ihr fremd gegen das, was sie sonst von ihm wußte.
„Nein“, erwiderte er „nie, nie — auch nicht als Kind.“
„Auch als Kind nicht? Fast ungläubig klang ihre Frage — aber so innig,
so teilnehmend, daß es ihn drängte weiter zu sprechen.
„Nein, grade als Kind nicht. Das sagt doch alles, nicht wahr?“
„Sie Armer!“ — Unwillkürlich waren ihr die Worte entschlüpft. Nun wurde
sie rot. Jedermann in der Stadt wußte, daß er reich war, und ebenso genau
wußte jedermann in der Stadt, daß man in ihrem Elternhaus stark mit dem
Groschen rechnen mußte.
Er lächelte aber nicht.
„Sie haben mit ihren Worten das Richtige getroffen. Arm ist man, wenn
man unter Entbehrungen leidet. Empfindet man den Mangel nicht, so lebt man
in dem Gefühl „ich habe genug!“ Ich litt unter dem Mangel, und deshalb war
ich arm. Als Mann sträubt man sich, sentimentalen Regungen Raum zu geben.
Das Kind kennt diese bewußte Energie nicht und lebt unter dem unbeschnittenen
Drange seines Naturells. Meine Anlagen waren anderer Art, als die meiner
Eltern! So kam’s.“ — Jürgen Radegast machte eine Pause. Else von Rüdiger
der Kinderstube entlassen. Jetzt hatte ich den ersten Kampf mit dem Leben
zu bestehen. Stramme Kerlchen standen mir gegenüber, die keine Auffassung
hatten für Sammetkittel und Spitzenkragen und für blonde Locken. Bei jeder
Balgerei zog ich den Kürzeren. Ein Griff in meine Mähne, und ich war das
unterlegene Opfer. Jeder Junge packte mit Wollust die bequeme Handhabe.
Dieses Raufen tat so entsetzlich weh, daß die Tränen nur gar zu leicht locker
wurden, was natürlich dazu beitrug, mich unter meinen Kameraden noch erbärm-
licher zu machen.
„Nun ja,“ sagte mir eines Tages der kleine Mann, der neben mir die Schul-
bank drückte, verächtlich: „Warum hast du auch Locken. Wenn man noch
nicht in die Schule geht — —“ er zuckte die Achseln. „Aber wenn man in
die Schule geht,“ fuhr er mit Nachdruck fort „mit wirklichen Jungens“ — seine
Brust reckte sich ordentlich breit unter dem stolzen Bewußtsein — „aber du
bist gar kein wirklicher Junge. Du bist ein Mädel in Hosen.“
Dieser verächtliche Ausspruch reizte mich. Ich raffte mich zu dem Ent-
schlüsse auf, meine Eltern zu bitten, daß meine Locken fielen — die Locken,
die mich herabdrückten — herabdrückten zu einem Mädel in Hosen. Meine
Mutter sah mich fast entgeistert an, als sie mein Anliegen hörte. Sie hatte
Wilhelm Sehr euer: Auf dem Rhein.
Aus dem Ivunstsalon Eduard Schulte, Berlin, Düsseldorf.
schwieg auch — aber ihr Blick war ihm eine Aufforderung, weiter zu sprechen.
Er lächelte. „Solch kleine Dinge waren es, und jetzt nach Jahrzehnten, in
die Entfernung gerückt, können sie sich kaum als Herzensbrecher ausweisen.
Aber das ist es ja: Kindertränen, Kinderschmerzen, so winzig klein, haben oft
eine ungeahnte Tiefe. Versagt man einem Geschöpfchen grundlos einen harm-
losen Wunsch und tischt ihm dafür alle Schätze Arabiens auf, so erscheint es
ihm sicher eben so hart, als ob man einem Hungernden statt des ersehnten
Brotes einen Stein reicht.“
Ich war ein Muttersöhnchen, verweichlicht in allen Äußerlichkeiten, das
einzige Kind reicher Eltern. Meine Mutter war stolz auf mich, denn ich war
hübsch. Alles, was die Natur mir in dieser Beziehung geschenkt hatte, wurde
noch durch eine sorgfältige Körperpflege und eine ausgewählte kleidsame Garde-
robe unterstrichen. Das Entzücken meiner Mutter aber waren meine gold-
blonden Locken. Das war nach ihrem Geschmack. In den Gemälden Van Dycks
hatte sie das Vorbild gefunden, dem ich gleichen sollte.
So zurechtfrisiert, mit den um die Stirn geschnittenen Haaren, den Locken,
die auf den Rücken herabhingen, lohnte es sich wohl, sich mit mir zu zeigen.
Das Kind hob ihre eigenen Reize, und sie war stolz, wenn die Menschen
uns nachblickten, oder ihr Schmeicheleien über mich sagten. Mir selbst hatte
man auch klar gemacht, was für eine Zierde ich mit meinen Locken herumtrug.
Ich lernte mich eitel genug mit ihnen zu bewegen, bis — ja bis ich in die Schule
kam. Hollah, das war ein Unterschied! Ich verlernte sehr bald, eitel auf meine
Haare zu sein. Schmerzen, nichts als Schmerzen bereiteten sie mir, seit ich aus
scheinbar das Gefühl, als ob man einen Raub an ihr begehen wollte. So wie
ich war, das schöne Kind, so war ich ein Stück von ihr, ein Stück der
anmutigen, bewunderten Frau. Ohne die Locken war ich ein anderer, paßte
nicht mehr an ihre Seite, war kein Kind mehr, mit dem man sich auf der
Promenade präsentiert. Ihre Entgeisterung wich einem mitleidigen Lächeln über
meine Torheit, die nicht zu wissen schien, welcher Verwandlung ich damit an-
heimfiel. Und mit diesem Lächeln wollte sie einfach über meinen Wunsch
hinweggleiten, die Sache abgetan sein lassen. Ich blieb fester dabei, als sie
geglaubt. Zuerst bettelte ich, dann wurde ich trotzig und fuhr zausend in meine
Locken. Dann hielt ich ihr meinen kleinen Freund vor, den Sohn von Haupt-
mann Reböhr, von dem alle in der Klasse was hielten. „Haha, ha“ lachte sie
laut auf, — „so willst du werden? So wie der? — solch ein kleiner häßlicher
Ruppian? — Pfui, Walter, das hätte ich niemals von dir geglaubt.“
Geärgert klingelte sie nach meinem Fräulein, damit sie meinen zerzausten
Locken über dem Lockenholz wieder die stilgerechte Gestalt gab.
Sonst hatte ich dabei immer im Spiegel zugeschaut. Heute drehte ich trotzig
den Rücken und ballte meine Fäuste. Ja, sobald sie ihr Werk vollbracht, fuhr
ich wieder zausend dazwischen, gerade so wie vorher im Salon meiner Mutter,
daß ich wie ein zerrupfter Vogel aussah. Aber es half mir nichts. Unbeirrt tat
das Fräulein ihre bezahlte Arbeit von neuem, und ich sah kein Mittel mich
meiner Kümmernisse zu entledigen.
Da nahte Weihnachten. In der Schule wurden eifrig die Wünsche, die jeder
auf dem Herzen trug, beraten Einer teilte sie dem andern mit. Du, ich wünsch'
MODERNE KUNST.
„Ihnen nicht?“ fragte sie betrübt. Es wollte ihrem Empfinden nicht gefallen,
denn es klang ihr fremd gegen das, was sie sonst von ihm wußte.
„Nein“, erwiderte er „nie, nie — auch nicht als Kind.“
„Auch als Kind nicht? Fast ungläubig klang ihre Frage — aber so innig,
so teilnehmend, daß es ihn drängte weiter zu sprechen.
„Nein, grade als Kind nicht. Das sagt doch alles, nicht wahr?“
„Sie Armer!“ — Unwillkürlich waren ihr die Worte entschlüpft. Nun wurde
sie rot. Jedermann in der Stadt wußte, daß er reich war, und ebenso genau
wußte jedermann in der Stadt, daß man in ihrem Elternhaus stark mit dem
Groschen rechnen mußte.
Er lächelte aber nicht.
„Sie haben mit ihren Worten das Richtige getroffen. Arm ist man, wenn
man unter Entbehrungen leidet. Empfindet man den Mangel nicht, so lebt man
in dem Gefühl „ich habe genug!“ Ich litt unter dem Mangel, und deshalb war
ich arm. Als Mann sträubt man sich, sentimentalen Regungen Raum zu geben.
Das Kind kennt diese bewußte Energie nicht und lebt unter dem unbeschnittenen
Drange seines Naturells. Meine Anlagen waren anderer Art, als die meiner
Eltern! So kam’s.“ — Jürgen Radegast machte eine Pause. Else von Rüdiger
der Kinderstube entlassen. Jetzt hatte ich den ersten Kampf mit dem Leben
zu bestehen. Stramme Kerlchen standen mir gegenüber, die keine Auffassung
hatten für Sammetkittel und Spitzenkragen und für blonde Locken. Bei jeder
Balgerei zog ich den Kürzeren. Ein Griff in meine Mähne, und ich war das
unterlegene Opfer. Jeder Junge packte mit Wollust die bequeme Handhabe.
Dieses Raufen tat so entsetzlich weh, daß die Tränen nur gar zu leicht locker
wurden, was natürlich dazu beitrug, mich unter meinen Kameraden noch erbärm-
licher zu machen.
„Nun ja,“ sagte mir eines Tages der kleine Mann, der neben mir die Schul-
bank drückte, verächtlich: „Warum hast du auch Locken. Wenn man noch
nicht in die Schule geht — —“ er zuckte die Achseln. „Aber wenn man in
die Schule geht,“ fuhr er mit Nachdruck fort „mit wirklichen Jungens“ — seine
Brust reckte sich ordentlich breit unter dem stolzen Bewußtsein — „aber du
bist gar kein wirklicher Junge. Du bist ein Mädel in Hosen.“
Dieser verächtliche Ausspruch reizte mich. Ich raffte mich zu dem Ent-
schlüsse auf, meine Eltern zu bitten, daß meine Locken fielen — die Locken,
die mich herabdrückten — herabdrückten zu einem Mädel in Hosen. Meine
Mutter sah mich fast entgeistert an, als sie mein Anliegen hörte. Sie hatte
Wilhelm Sehr euer: Auf dem Rhein.
Aus dem Ivunstsalon Eduard Schulte, Berlin, Düsseldorf.
schwieg auch — aber ihr Blick war ihm eine Aufforderung, weiter zu sprechen.
Er lächelte. „Solch kleine Dinge waren es, und jetzt nach Jahrzehnten, in
die Entfernung gerückt, können sie sich kaum als Herzensbrecher ausweisen.
Aber das ist es ja: Kindertränen, Kinderschmerzen, so winzig klein, haben oft
eine ungeahnte Tiefe. Versagt man einem Geschöpfchen grundlos einen harm-
losen Wunsch und tischt ihm dafür alle Schätze Arabiens auf, so erscheint es
ihm sicher eben so hart, als ob man einem Hungernden statt des ersehnten
Brotes einen Stein reicht.“
Ich war ein Muttersöhnchen, verweichlicht in allen Äußerlichkeiten, das
einzige Kind reicher Eltern. Meine Mutter war stolz auf mich, denn ich war
hübsch. Alles, was die Natur mir in dieser Beziehung geschenkt hatte, wurde
noch durch eine sorgfältige Körperpflege und eine ausgewählte kleidsame Garde-
robe unterstrichen. Das Entzücken meiner Mutter aber waren meine gold-
blonden Locken. Das war nach ihrem Geschmack. In den Gemälden Van Dycks
hatte sie das Vorbild gefunden, dem ich gleichen sollte.
So zurechtfrisiert, mit den um die Stirn geschnittenen Haaren, den Locken,
die auf den Rücken herabhingen, lohnte es sich wohl, sich mit mir zu zeigen.
Das Kind hob ihre eigenen Reize, und sie war stolz, wenn die Menschen
uns nachblickten, oder ihr Schmeicheleien über mich sagten. Mir selbst hatte
man auch klar gemacht, was für eine Zierde ich mit meinen Locken herumtrug.
Ich lernte mich eitel genug mit ihnen zu bewegen, bis — ja bis ich in die Schule
kam. Hollah, das war ein Unterschied! Ich verlernte sehr bald, eitel auf meine
Haare zu sein. Schmerzen, nichts als Schmerzen bereiteten sie mir, seit ich aus
scheinbar das Gefühl, als ob man einen Raub an ihr begehen wollte. So wie
ich war, das schöne Kind, so war ich ein Stück von ihr, ein Stück der
anmutigen, bewunderten Frau. Ohne die Locken war ich ein anderer, paßte
nicht mehr an ihre Seite, war kein Kind mehr, mit dem man sich auf der
Promenade präsentiert. Ihre Entgeisterung wich einem mitleidigen Lächeln über
meine Torheit, die nicht zu wissen schien, welcher Verwandlung ich damit an-
heimfiel. Und mit diesem Lächeln wollte sie einfach über meinen Wunsch
hinweggleiten, die Sache abgetan sein lassen. Ich blieb fester dabei, als sie
geglaubt. Zuerst bettelte ich, dann wurde ich trotzig und fuhr zausend in meine
Locken. Dann hielt ich ihr meinen kleinen Freund vor, den Sohn von Haupt-
mann Reböhr, von dem alle in der Klasse was hielten. „Haha, ha“ lachte sie
laut auf, — „so willst du werden? So wie der? — solch ein kleiner häßlicher
Ruppian? — Pfui, Walter, das hätte ich niemals von dir geglaubt.“
Geärgert klingelte sie nach meinem Fräulein, damit sie meinen zerzausten
Locken über dem Lockenholz wieder die stilgerechte Gestalt gab.
Sonst hatte ich dabei immer im Spiegel zugeschaut. Heute drehte ich trotzig
den Rücken und ballte meine Fäuste. Ja, sobald sie ihr Werk vollbracht, fuhr
ich wieder zausend dazwischen, gerade so wie vorher im Salon meiner Mutter,
daß ich wie ein zerrupfter Vogel aussah. Aber es half mir nichts. Unbeirrt tat
das Fräulein ihre bezahlte Arbeit von neuem, und ich sah kein Mittel mich
meiner Kümmernisse zu entledigen.
Da nahte Weihnachten. In der Schule wurden eifrig die Wünsche, die jeder
auf dem Herzen trug, beraten Einer teilte sie dem andern mit. Du, ich wünsch'