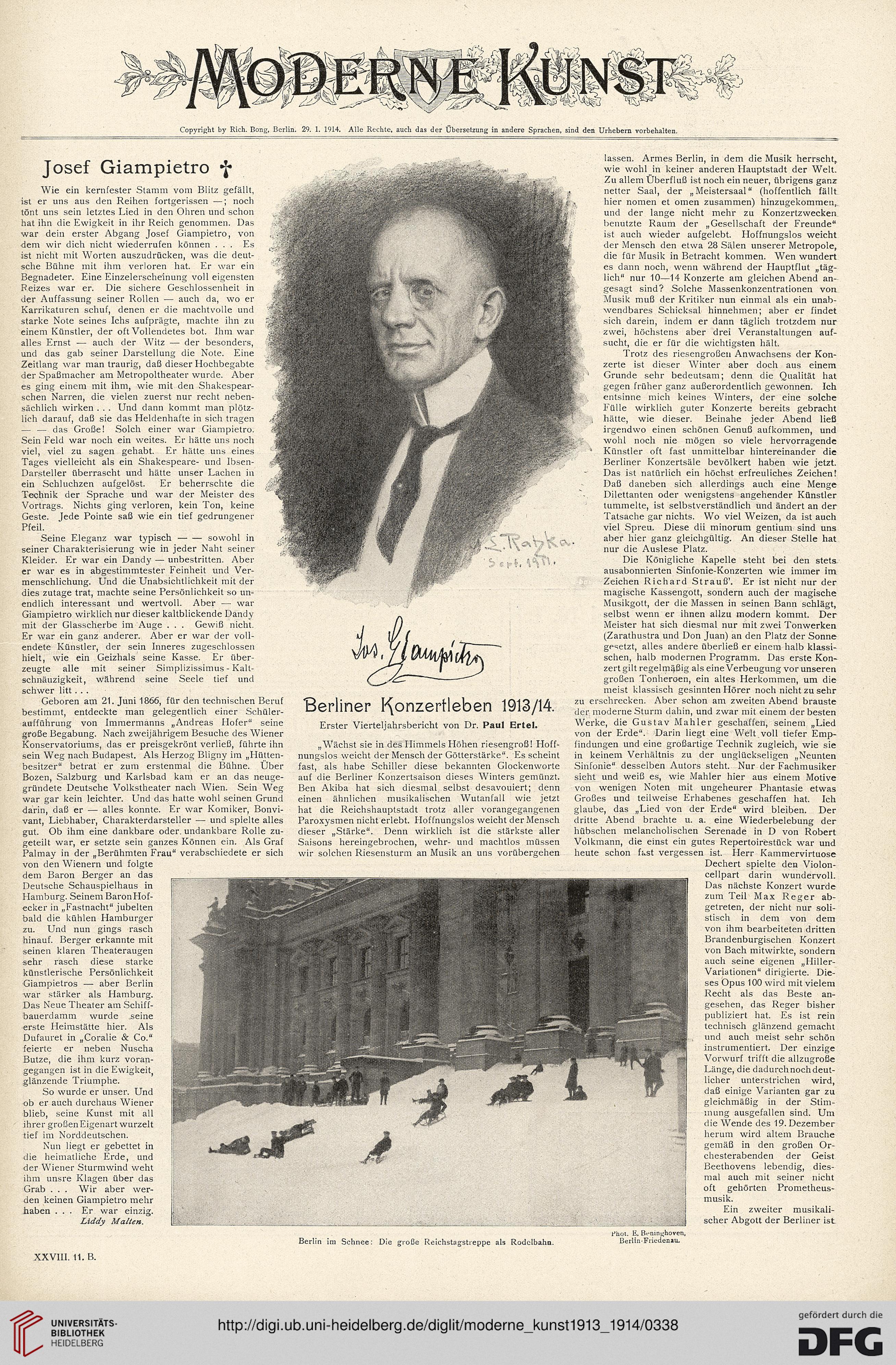Copyright by Rieh. Bong, Berlin. 29. 1. 1914. Alle Rechte, auch das der Übersetzung in andere Sprachen, sind den Urhebern Vorbehalten.
Berliner I^onzertleben 1913/14.
Erster Vierteljahrsbericht von Dr. Paul Ertel.
„Wächst sie in des Himmels Höhen riesengroß! Hoff-
nungslos weicht der Mensch der Götterstärke“. Es scheint
fast, als habe Schiller diese bekannten Glockenworte
auf die Berliner Konzertsaison dieses Winters gemünzt.
Ben Akiba hat sich diesmal selbst desavouiert; denn
einen ähnlichen musikalischen Wutanfall wie jetzt
hat die Reichshauptstadt trotz aller vorangegangenen
Paroxysmen nicht erlebt. Hoffnungslos weicht der Mensch
dieser „Stärke“. Denn wirklich ist die stärkste aller
Saisons hereingebrochen, wehr- und machtlos müssen
wir solchen Riesensturm an Musik an uns vorübergehen
lassen. Armes Berlin, in dem die Musik herrscht,
wie wohl in keiner anderen Hauptstadt der Welt.
Zu allem Überfluß ist noch ein neuer, übrigens ganz
netter Saal, der „Meistersaal“ (hoffentlich fällt
hier nomen et omen zusammen) hinzugekommeu,,
und der lange nicht mehr zu Konzertzwecken
benutzte Raum der „Gesellschaft der Freunde“
ist auch wieder aufgelebt. Hoffnungslos weicht
der Mensch den etwa 28 Sälen unserer Metropole,
die für Musik in Betracht kommen. Wen wundert
es dann noch, wenn während der Hauptflut „täg-
lich“ nur 10—14 Konzerte am gleichen Abend an-
gesagt sind? Solche Massenkonzentrationen von
Musik muß der Kritiker nun einmal als ein unab-
wendbares Schicksal hinnehmen; aber er findet
sich darein, indem er dann täglich trotzdem nur
zwei, höchstens aber drei Veranstaltungen auf-
sucht, die er für die wichtigsten hält.
Trotz des riesengroßen Anwachsens der Kon-
zerte ist dieser Winter aber doch aus einem
Grunde sehr bedeutsam; denn die Qualität hat
gegen früher ganz außerordentlich gewonnen. Ich
entsinne mich keines Winters, der eine solche
Fülle wirklich guter Konzerte bereits gebracht
hätte, wie dieser. Beinahe jeder Abend ließ
irgendwo einen schönen Genuß aufkommen, und
wohl noch nie mögen so viele hervorragende
Künstler oft fast unmittelbar hintereinander die
Berliner Konzertsäle bevölkert haben wie jetzt.
Das ist natürlich ein höchst erfreuliches Zeichen!
Daß daneben sich allerdings auch eine Menge
Dilettanten oder wenigstens angehender Künstler
tummelte, ist selbstverständlich und ändert an der
Tatsache gar nichts. Wo viel Weizen, da ist auch
viel Spreu. Diese dii minorum gentium sind uns
aber hier ganz gleichgültig. An dieser Stelle hat
nur die Auslese Platz.
Die Königliche Kapelle steht bei den stets
ausabonnierten Sinfonie-Konzerten wie immer im
Zeichen Richard Strauß’. Er ist nicht nur der
magische Kassengott, sondern auch der magische
Musikgott, der die Massen in seinen Bann schlägt,
selbst wenn er ihnen allzu modern kommt. Der
Meister hat sich diesmal nur mit zwei Tonwerken
(Zarathustra und Don Juan) an den Platz der Sonne
gesetzt, alles andere überließ er einem halb klassi-
schen, halb modernen Programm. Das erste Kon-
zert gilt regelmäßig als eine Verbeugung vor unseren
großen Tonheroen, ein altes Herkommen, um die
meist klassisch gesinnten Hörer noch nicht zu sehr
zu erschrecken. Aber schon am zweiten Abend brauste
der moderne Sturm dahin, und zwar mit einem der besten
Werke, die Gustav Mahler geschaffen, seinem „Lied
von der Erde“. Darin liegt eine Welt voll tiefer Emp-
findungen und eine großartige Technik zugleich, wie sie
in keinem Verhältnis zu der unglückseligen „Neunten
Sinfonie“ desselben Autors steht. Nur der Fachmusiker
sieht und weiß es, wie Mahler hier aus einem Motive
von wenigen Noten mit ungeheurer Phantasie etwas
Großes und teilweise Erhabenes geschaffen hat. Ich
glaube, das „Lied von der Erde“ wird bleiben. Der
dritte Abend brachte u. a. eine Wiederbelebung der
hübschen melancholischen Serenade in D von Robert
Volkmann, die einst ein gutes Repertoirestück war und
heute schon fast vergessen ist. Herr Kammervirtuose
Dechert spielte den Violon-
cellpart darin wundervoll.
Das nächste Konzert wurde
zum Teil Max Reger ab-
getreten, der nicht nur soli-
stisch in dem von dem
von ihm bearbeiteten dritten
Brandenburgischen Konzert
von Bach mitwirkte, sondern
auch seine eigenen „Miller-
Variationen“ dirigierte. Die-
ses Opus 100 wird mit vielem
Recht als das Beste an-
gesehen, das Reger bisher
publiziert hat. Es ist rein
technisch glänzend gemacht
und auch meist sehr schön
instrumentiert. Der einzige
Vorwurf trifft die allzugroße
Länge, die dadurch noch deut-
licher unterstrichen wird,
daß einige Varianten gar zu
gleichmäßig in der Stim-
mung ausgefallen sind. Um
die Wende des 19. Dezember
herum wird altem Brauche
gemäß in den großen Or-
chesterabenden der Geist
Beethovens lebendig, dies-
mal auch mit seiner nicht
oft gehörten Prometheus-
musik.
Ein zweiter musikali-
scher Abgott der Berliner ist
Josef Giampietro
Wie ein kernfester Stamm vom Blitz gefällt,
ist er uns aus den Reihen fortgerissen —; noch
tönt uns sein letztes Lied in den Ohren und schon
hat ihn die Ewigkeit in ihr Reich genommen. Das
war dein erster Abgang Josef Giampietro, von
dem wir dich nicht wiederrufen können ... Es
ist nicht mit Worten auszudrücken, was die deut-
sche Bühne mit ihm verloren hat. Er war ein
Begnadeter. Eine Einzelerscheinung voll eigensten
Reizes war er. Die sichere Geschlossenheit in
der Auffassung seiner Rollen — auch da, wo er
Karrikaturen schuf, denen er die machtvolle und
starke Note seines Ichs aufprägte, machte ihn zu
einem Künstler, der oft Vollendetes bot. Ihm war
alles Ernst — auch der Witz — der besonders,
und das gab seiner Darstellung die Note. Eine
Zeitlang war man traurig, daß dieser Hochbegabte
der Spaßmacher am Metropoltheater wurde. Aber
es ging einem mit ihm, wie mit den Shakespear-
schen Narren, die vielen zuerst nur recht neben-
sächlich wirken . . . Und dann kommt man plötz-
lich darauf, daß sie das Heldenhafte in sich tragen
— — das Große! Solch einer war Giampietro.
Sein Feld war noch ein weites. Er hätte uns noch
viel, viel zu sagen gehabt. Er hätte uns eines
Tages vielleicht als ein Shakespeare- und Ibsen-
Darsteller überrascht und hätte unser Lachen in
ein Schluchzen aufgelöst. Er beherrschte die
Technik der Sprache und war der Meister des
Vortrags. Nichts ging verloren, kein Ton, keine
Geste. Jede Pointe saß wie ein tief gedrungener
Pfeil.
Seine Eleganz war typisch — — sowohl in
seiner Charakterisierung wie in jeder Naht seiner
Kleider. Er war ein Dandy — unbestritten. Aber
er war es in abgestimmtester Feinheit und Ver-
menschlichung. Und die Unabsichtlichkeit mit der
dies zutage trat, machte seine Persönlichkeit so un-
endlich interessant und wertvoll. Aber — war
Giampietro wirklich nur dieser kaltblickende Dandy
mit der Glasscherbe im Auge . . . Gewiß nicht.
Er war ein ganz anderer. Aber er war der voll-
endete Künstler, der sein Inneres zugeschlossen
hielt, wie ein Geizhals seine Kasse. Er über-
zeugte alle mit seiner Simplizissimus - Kalt-
schnäuzigkeit, während seine Seele tief und
schwer litt . . .
Geboren am 21. Juni 1866, für den technischen Beruf
bestimmt, entdeckte man gelegentlich einer Schüler-
aufführung von Immermanns „Andreas Hofer“ seine
große Begabung. Nach zweijährigem Besuche des Wiener
Konservatoriums, das er preisgekrönt verließ, führte ihn
sein Weg nach Budapest. Als Herzog Bligny im „Hütten-
besitzer“ betrat er zum erstenmal die Bühne. Über
Bozen, Salzburg und Karlsbad kam er an das neuge-
gründete Deutsche Volkstheater nach Wien. Sein Weg
war gar kein leichter. Und das hatte wohl seinen Grund
darin, daß er — alles konnte. Er war Komiker, Bonvi-
vant, Liebhaber, Charakterdarsteller — und spielte alles
gut. Ob ihm eine dankbare oder, undankbare Rolle zu-
geteilt war, er setzte sein ganzes Können ein. Als Graf
Palmay in der „Berühmten Frau“ verabschiedete er sich
von den Wienern und folgte
dem Baron Berger an das
Deutsche Schauspielhaus in
Hamburg. Seinem Baron Hof-
ecker in „Fastnacht“ jubelten
bald die kühlen Plamburger
zu. Und nun gings rasch
hinauf. Berger erkannte mit
seinen klaren Theateraugen
sehr rasch diese starke
künstlerische Persönlichkeit
Giampietros — aber Berlin
war stärker als Hamburg.
Das Neue Theater am Schiff-
bauerdamm wurde seine
erste Heimstätte hier. Als
Dufauret in „Coralie & Co.“
feierte er neben Nuscha
Butze, die ihm kurz voran-
gegangen ist in die Ewigkeit,
glänzende Triumphe.
So wurde er unser. Und
ob er auch durchaus Wiener
blieb, seine Kunst mit all
ihrer großen Eigenart wurzelt
tief im Norddeutschen.
Nun liegt er gebettet in
die heimatliche Erde, und
der Wiener Sturmwind weht
ihm unsre Klagen über das
Grab . . . Wir aber wer-
den keinen Giampietro mehr
haben ... Er war einzig.
Liddy Malten.
phoi. E. Benin^hoven,
Berlin-Friedenau.
XXVIII. 11. B.
Berlin im Schnee: Die große Reichstagstreppe als Rodelbahn.
Berliner I^onzertleben 1913/14.
Erster Vierteljahrsbericht von Dr. Paul Ertel.
„Wächst sie in des Himmels Höhen riesengroß! Hoff-
nungslos weicht der Mensch der Götterstärke“. Es scheint
fast, als habe Schiller diese bekannten Glockenworte
auf die Berliner Konzertsaison dieses Winters gemünzt.
Ben Akiba hat sich diesmal selbst desavouiert; denn
einen ähnlichen musikalischen Wutanfall wie jetzt
hat die Reichshauptstadt trotz aller vorangegangenen
Paroxysmen nicht erlebt. Hoffnungslos weicht der Mensch
dieser „Stärke“. Denn wirklich ist die stärkste aller
Saisons hereingebrochen, wehr- und machtlos müssen
wir solchen Riesensturm an Musik an uns vorübergehen
lassen. Armes Berlin, in dem die Musik herrscht,
wie wohl in keiner anderen Hauptstadt der Welt.
Zu allem Überfluß ist noch ein neuer, übrigens ganz
netter Saal, der „Meistersaal“ (hoffentlich fällt
hier nomen et omen zusammen) hinzugekommeu,,
und der lange nicht mehr zu Konzertzwecken
benutzte Raum der „Gesellschaft der Freunde“
ist auch wieder aufgelebt. Hoffnungslos weicht
der Mensch den etwa 28 Sälen unserer Metropole,
die für Musik in Betracht kommen. Wen wundert
es dann noch, wenn während der Hauptflut „täg-
lich“ nur 10—14 Konzerte am gleichen Abend an-
gesagt sind? Solche Massenkonzentrationen von
Musik muß der Kritiker nun einmal als ein unab-
wendbares Schicksal hinnehmen; aber er findet
sich darein, indem er dann täglich trotzdem nur
zwei, höchstens aber drei Veranstaltungen auf-
sucht, die er für die wichtigsten hält.
Trotz des riesengroßen Anwachsens der Kon-
zerte ist dieser Winter aber doch aus einem
Grunde sehr bedeutsam; denn die Qualität hat
gegen früher ganz außerordentlich gewonnen. Ich
entsinne mich keines Winters, der eine solche
Fülle wirklich guter Konzerte bereits gebracht
hätte, wie dieser. Beinahe jeder Abend ließ
irgendwo einen schönen Genuß aufkommen, und
wohl noch nie mögen so viele hervorragende
Künstler oft fast unmittelbar hintereinander die
Berliner Konzertsäle bevölkert haben wie jetzt.
Das ist natürlich ein höchst erfreuliches Zeichen!
Daß daneben sich allerdings auch eine Menge
Dilettanten oder wenigstens angehender Künstler
tummelte, ist selbstverständlich und ändert an der
Tatsache gar nichts. Wo viel Weizen, da ist auch
viel Spreu. Diese dii minorum gentium sind uns
aber hier ganz gleichgültig. An dieser Stelle hat
nur die Auslese Platz.
Die Königliche Kapelle steht bei den stets
ausabonnierten Sinfonie-Konzerten wie immer im
Zeichen Richard Strauß’. Er ist nicht nur der
magische Kassengott, sondern auch der magische
Musikgott, der die Massen in seinen Bann schlägt,
selbst wenn er ihnen allzu modern kommt. Der
Meister hat sich diesmal nur mit zwei Tonwerken
(Zarathustra und Don Juan) an den Platz der Sonne
gesetzt, alles andere überließ er einem halb klassi-
schen, halb modernen Programm. Das erste Kon-
zert gilt regelmäßig als eine Verbeugung vor unseren
großen Tonheroen, ein altes Herkommen, um die
meist klassisch gesinnten Hörer noch nicht zu sehr
zu erschrecken. Aber schon am zweiten Abend brauste
der moderne Sturm dahin, und zwar mit einem der besten
Werke, die Gustav Mahler geschaffen, seinem „Lied
von der Erde“. Darin liegt eine Welt voll tiefer Emp-
findungen und eine großartige Technik zugleich, wie sie
in keinem Verhältnis zu der unglückseligen „Neunten
Sinfonie“ desselben Autors steht. Nur der Fachmusiker
sieht und weiß es, wie Mahler hier aus einem Motive
von wenigen Noten mit ungeheurer Phantasie etwas
Großes und teilweise Erhabenes geschaffen hat. Ich
glaube, das „Lied von der Erde“ wird bleiben. Der
dritte Abend brachte u. a. eine Wiederbelebung der
hübschen melancholischen Serenade in D von Robert
Volkmann, die einst ein gutes Repertoirestück war und
heute schon fast vergessen ist. Herr Kammervirtuose
Dechert spielte den Violon-
cellpart darin wundervoll.
Das nächste Konzert wurde
zum Teil Max Reger ab-
getreten, der nicht nur soli-
stisch in dem von dem
von ihm bearbeiteten dritten
Brandenburgischen Konzert
von Bach mitwirkte, sondern
auch seine eigenen „Miller-
Variationen“ dirigierte. Die-
ses Opus 100 wird mit vielem
Recht als das Beste an-
gesehen, das Reger bisher
publiziert hat. Es ist rein
technisch glänzend gemacht
und auch meist sehr schön
instrumentiert. Der einzige
Vorwurf trifft die allzugroße
Länge, die dadurch noch deut-
licher unterstrichen wird,
daß einige Varianten gar zu
gleichmäßig in der Stim-
mung ausgefallen sind. Um
die Wende des 19. Dezember
herum wird altem Brauche
gemäß in den großen Or-
chesterabenden der Geist
Beethovens lebendig, dies-
mal auch mit seiner nicht
oft gehörten Prometheus-
musik.
Ein zweiter musikali-
scher Abgott der Berliner ist
Josef Giampietro
Wie ein kernfester Stamm vom Blitz gefällt,
ist er uns aus den Reihen fortgerissen —; noch
tönt uns sein letztes Lied in den Ohren und schon
hat ihn die Ewigkeit in ihr Reich genommen. Das
war dein erster Abgang Josef Giampietro, von
dem wir dich nicht wiederrufen können ... Es
ist nicht mit Worten auszudrücken, was die deut-
sche Bühne mit ihm verloren hat. Er war ein
Begnadeter. Eine Einzelerscheinung voll eigensten
Reizes war er. Die sichere Geschlossenheit in
der Auffassung seiner Rollen — auch da, wo er
Karrikaturen schuf, denen er die machtvolle und
starke Note seines Ichs aufprägte, machte ihn zu
einem Künstler, der oft Vollendetes bot. Ihm war
alles Ernst — auch der Witz — der besonders,
und das gab seiner Darstellung die Note. Eine
Zeitlang war man traurig, daß dieser Hochbegabte
der Spaßmacher am Metropoltheater wurde. Aber
es ging einem mit ihm, wie mit den Shakespear-
schen Narren, die vielen zuerst nur recht neben-
sächlich wirken . . . Und dann kommt man plötz-
lich darauf, daß sie das Heldenhafte in sich tragen
— — das Große! Solch einer war Giampietro.
Sein Feld war noch ein weites. Er hätte uns noch
viel, viel zu sagen gehabt. Er hätte uns eines
Tages vielleicht als ein Shakespeare- und Ibsen-
Darsteller überrascht und hätte unser Lachen in
ein Schluchzen aufgelöst. Er beherrschte die
Technik der Sprache und war der Meister des
Vortrags. Nichts ging verloren, kein Ton, keine
Geste. Jede Pointe saß wie ein tief gedrungener
Pfeil.
Seine Eleganz war typisch — — sowohl in
seiner Charakterisierung wie in jeder Naht seiner
Kleider. Er war ein Dandy — unbestritten. Aber
er war es in abgestimmtester Feinheit und Ver-
menschlichung. Und die Unabsichtlichkeit mit der
dies zutage trat, machte seine Persönlichkeit so un-
endlich interessant und wertvoll. Aber — war
Giampietro wirklich nur dieser kaltblickende Dandy
mit der Glasscherbe im Auge . . . Gewiß nicht.
Er war ein ganz anderer. Aber er war der voll-
endete Künstler, der sein Inneres zugeschlossen
hielt, wie ein Geizhals seine Kasse. Er über-
zeugte alle mit seiner Simplizissimus - Kalt-
schnäuzigkeit, während seine Seele tief und
schwer litt . . .
Geboren am 21. Juni 1866, für den technischen Beruf
bestimmt, entdeckte man gelegentlich einer Schüler-
aufführung von Immermanns „Andreas Hofer“ seine
große Begabung. Nach zweijährigem Besuche des Wiener
Konservatoriums, das er preisgekrönt verließ, führte ihn
sein Weg nach Budapest. Als Herzog Bligny im „Hütten-
besitzer“ betrat er zum erstenmal die Bühne. Über
Bozen, Salzburg und Karlsbad kam er an das neuge-
gründete Deutsche Volkstheater nach Wien. Sein Weg
war gar kein leichter. Und das hatte wohl seinen Grund
darin, daß er — alles konnte. Er war Komiker, Bonvi-
vant, Liebhaber, Charakterdarsteller — und spielte alles
gut. Ob ihm eine dankbare oder, undankbare Rolle zu-
geteilt war, er setzte sein ganzes Können ein. Als Graf
Palmay in der „Berühmten Frau“ verabschiedete er sich
von den Wienern und folgte
dem Baron Berger an das
Deutsche Schauspielhaus in
Hamburg. Seinem Baron Hof-
ecker in „Fastnacht“ jubelten
bald die kühlen Plamburger
zu. Und nun gings rasch
hinauf. Berger erkannte mit
seinen klaren Theateraugen
sehr rasch diese starke
künstlerische Persönlichkeit
Giampietros — aber Berlin
war stärker als Hamburg.
Das Neue Theater am Schiff-
bauerdamm wurde seine
erste Heimstätte hier. Als
Dufauret in „Coralie & Co.“
feierte er neben Nuscha
Butze, die ihm kurz voran-
gegangen ist in die Ewigkeit,
glänzende Triumphe.
So wurde er unser. Und
ob er auch durchaus Wiener
blieb, seine Kunst mit all
ihrer großen Eigenart wurzelt
tief im Norddeutschen.
Nun liegt er gebettet in
die heimatliche Erde, und
der Wiener Sturmwind weht
ihm unsre Klagen über das
Grab . . . Wir aber wer-
den keinen Giampietro mehr
haben ... Er war einzig.
Liddy Malten.
phoi. E. Benin^hoven,
Berlin-Friedenau.
XXVIII. 11. B.
Berlin im Schnee: Die große Reichstagstreppe als Rodelbahn.