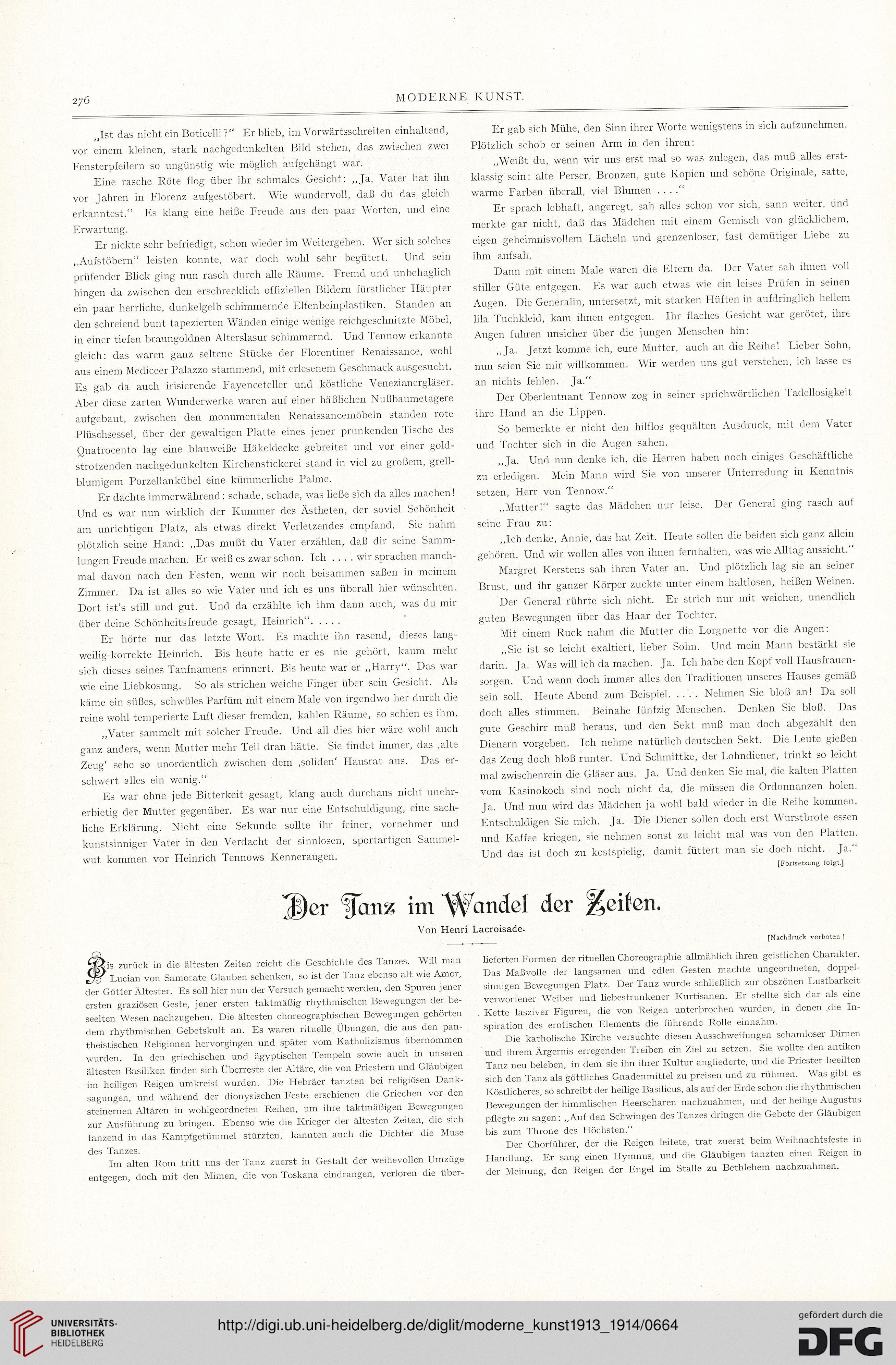276
MODERNE KUNST.
„Ist das nicht ein Boticelli ?“ Er blieb, im Vorwärtsschreiten einhaltend,
vor einem kleinen, stark nachgedunkelten Bild stehen, das zwischen zwei
Fensterpfeilern so ungünstig wie möglich aufgehängt war.
Eine rasche Röte flog über ihr schmales Gesicht: „Ja, Vater hat ihn
vor Jahren in Florenz aufgestöbert. Wie wundervoll, daß du das gleich
erkanntest.“ Es klang eine heiße Freude aus den paar Worten, und eine
Erwartung.
Er nickte sehr befriedigt, schon wieder im Weitergehen. Wer sich solches
„Aufstöbern“ leisten konnte, war doch wohl sehr begütert. Und sein
prüfender Blick ging nun rasch durch alle Räume. Fremd und unbehaglich
hingen da zwischen den erschrecklich offiziellen Bildern fürstlicher Häupter
ein paar herrliche, dunkelgelb schimmernde Elfenbeinplastiken. Standen an
den schreiend bunt tapezierten Wänden einige wenige reichgeschnitzte Möbel,
in einer tiefen braungoldnen Alterslasur schimmernd. Und Tennow erkannte
gleich: das waren ganz seltene Stücke der Florentiner Renaissance, wohl
aus einem Mediceer Palazzo stammend, mit erlesenem Geschmack ausgesucht.
Es gab da auch irisierende Fayenceteller und köstliche Venezianergläser.
Aber diese zarten Wunderwerke waren auf einer häßlichen Nußbaumetagere
aufgebaut, zwischen den monumentalen Renaissancemöbeln standen rote
Plüschsessel, über der gewaltigen Platte eines jener prunkenden Tische des
Quatrocento lag eine blauweiße Häkeldecke gebreitet und vor einer golcl-
strotzenden nachgedunkelten Kirchenstickerei stand in viel zu großem, grell-
blumigem Porzellankübel eine kümmerliche Palme.
Er dachte immerwährend: schade, schade, was ließe sich da alles machen!
Und es war nun wirklich der Kummer des Ästheten, der soviel Schönheit
am unrichtigen Platz, als etwas direkt Verletzendes empfand. Sie nahm
plötzlich seine Hand: „Das mußt du Vater erzählen, daß dir seine Samm-
lungen Freude machen. Er weiß es zwar schon. Ich .... wir sprachen manch-
mal davon nach den Festen, wenn wir noch beisammen saßen in meinem
Zimmer. Da ist alles so wie Vater und ich es uns überall hier wünschten.
Dort ist’s still und gut. Und da erzählte ich ihm dann auch, was du mir
über deine Schönheitsfreude gesagt, Heinrich“.
Er hörte nur das letzte Wort. Es machte ihn rasend, dieses lang-
weilig-korrekte Heinrich. Bis heute hatte er es nie gehört, kaum mehr
sich dieses seines Taufnamens erinnert. Bis heute war er „Harry“. Das war
wie eine Liebkosung. So als strichen weiche Finger über sein Gesicht. Als
käme ein süßes, schwüles Parfüm mit einem Male von irgendwo her durch die
reine wohl temperierte Luft dieser fremden, kahlen Räume, so schien es ihm.
„Vater sammelt mit solcher Freude. Und all dies hier wäre wolil auch
ganz anders, wenn Mutter mehr Teil dran hätte. Sie findet immer, das ,alte
Zeug' sehe so unordentlich zwischen dem .soliden' Hausrat aus. Das er-
schwert alles ein wenig.“
Es war ohne jede Bitterkeit gesagt, klang auch durchaus nicht unehr-
erbietig der Mutter gegenüber. Es war nur eine Entschuldigung, eine sach-
liche Erklärung. Nicht eine Sekunde sollte ihr feiner, vornehmer und
kunstsinniger Vater in den Verdacht der sinnlosen, sportartigen Sammel-
wut kommen vor Heinrich Tennows Kenneraugen.
Er gab sich Mühe, den Sinn ihrer Worte wenigstens in sich aufzunehmen.
Plötzlich schob er seinen Arm in den ihren:
„Weißt du, wenn wir uns erst mal so was zulegen, das muß alles erst-
klassig sein: alte Perser, Bronzen, gute Kopien und schöne Originale, satte,
warme Farben überall, viel Blumen . . . .“
Er sprach lebhaft, angeregt, sah alles schon vor sich, sann weiter, und
merkte gar nicht, daß das Mädchen mit einem Gemisch von glücklichem,
eigen geheimnisvollem Lächeln und grenzenloser, fast demütiger Liebe zu
ihm aufsah.
Dann mit einem Male waren die Eltern da. Der Vater sah ihnen voll
stiller Güte entgegen. Es war auch etwas wie ein leises Prüfen in seinen
Augen. Die Generalin, untersetzt, mit starken Hüften in aufdringlich hellem
lila Tuchkleid, kam ihnen entgegen. Ihr flaches Gesicht war gerötet, ihre
Augen fuhren unsicher über die jungen Menschen hin:
„Ja. Jetzt komme ich, eure Mutter, auch an die Reihe! Lieber Sohn,
nun seien Sie mir willkommen. Wir werden uns gut verstehen, ich lasse es
an nichts fehlen. Ja.“
Der Oberleutnant Tennow zog in seiner sprichwörtlichen Tadellosigkeit
ihre Hand an die Lippen.
So bemerkte er nicht den hilflos gequälten Ausdruck, mit dem Vater
und Tochter sich in die Augen sahen.
„Ja. Und nun denke ich, die Herren haben noch einiges Geschäftliche
zu erledigen. Mein Mann wird Sie von unserer Unterredung in Kenntnis
setzen, Herr von Tennow.“
„Mutter!“ sagte das Mädchen nur leise. Der General ging rasch auf
seine Frau zu:
„Ich denke, Annie, das hat Zeit. Heute sollen die beiden sich ganz allein
gehören. Und wir wollen alles von ihnen fernhalten, was wie Alltag aussieht.“
Margret Kerstens sah ihren Vater an. Und plötzlich lag sie an seiner
Brust, und ihr ganzer Körper zuckte unter einem haltlosen, heißen Weinen.
Der General rührte sich nicht. Er strich nur mit weichen, unendlich
guten Bewegungen über das Haar der Tochter.
Mit einem Ruck nahm die Mutter die Lorgnette vor die Augen:
„Sie ist so leicht exaltiert, lieber Sohn. Und mein Mann bestärkt sie
darin. Ja. Was will ich da machen. Ja. Ich habe den Kopf voll Hausfrauen-
sorgen. Und wenn doch immer alles den Traditionen unseres Hauses gemäß
sein soll. Heute Abend zum Beispiel. .... Nehmen Sie bloß an! Da soll
doch alles stimmen. Beinahe fünfzig Menschen. Denken Sie bloß. Das
gute Geschirr muß heraus, und den Sekt muß man doch abgezählt den
Dienern vorgeben. Ich nehme natürlich deutschen Sekt. Die Leute gießen
das Zeug doch bloß runter. Und Schmittlce, der Lohndiener, trinkt so leicht
mal zwischenrein die Gläser aus. Ja. Und denken Sie mal, die kalten Platten
vom Kasinokoch sind noch nicht da, die müssen die Ordonnanzen holen.
Ja. Und nun wird das Mädchen ja wohl bald wieder in die Reihe kommen.
Entschuldigen Sie mich. Ja. Die Diener sollen doch erst Wurstbrote essen
und Kaffee kriegen, sie nehmen sonst zu leicht mal was von den Platten.
Und das ist doch zu kostspielig, damit füttert man sie doch nicht. Ja.“
[Fortsetzung folgt.]
#is zurück in die ältesten Zeiten reicht die Geschichte des Tanzes. Will man
Lucian von Samosate Glauben schenken, so ist der Tanz ebenso alt wie Amor,
der Götter Ältester. Es soll hier nun der Versuch gemacht werden, den Spuren jener
ersten graziösen Geste, jener ersten taktmäßig rhythmischen Bewegungen der be-
seelten Wesen nachzugehen. Die ältesten choreographischen Bewegungen gehörten
dem rhythmischen Gebetskult an. Es waren rituelle Übungen, die aus den pan-
theistischen Religionen hervorgingen und später vom Katholizismus übernommen
wurden. In den griechischen und ägyptischen Tempeln sowie auch in unseren
ältesten Basiliken finden sich Überreste der Altäre, die von Priestern und Gläubigen
im heiligen Reigen umkreist wurden. Die Hebräer tanzten bei religiösen Dank-
sagungen, und während der dionysischen Feste erschienen die Griechen vor den
steinernen Altären in wohlgeordneten Reihen, um ihre taktmäßigen Bewegungen
zur Ausführung zu bringen. Ebenso wie die Krieger der ältesten Zeiten, die sich
tanzend in das Kampfgetümmel stürzten, kannten auch die Dichter die Muse
des Tanzes.
Im alten Rom tritt uns der Tanz zuerst in Gestalt der weihevollen Umzüge
entgegen, doch mit den Mimen, die von Toskana eindrangen, verloren die über-
[Nachdruck verboten ]
lieferten Formen der rituellen Choreographie allmählich ihren geistlichen Charakter.
Das Maßvolle der langsamen und edlen Gesten machte ungeordneten, doppel-
sinnigen Bewegungen Platz. Der Tanz wurde schließlich zur obszönen Lustbarkeit
verworfener Weiber und liebestrunkener Kurtisanen. Er stellte sich dar als eine
Kette lasziver Figuren, die von Reigen unterbrochen wurden, in denen .die In-
spiration des erotischen Elements die führende Rolle einnahm.
Die katholische Kirche versuchte diesen Ausschweifungen schamloser Dirnen
und ihrem Ärgernis erregenden Treiben ein Ziel zu setzen. Sie wollte den antiken
Tanz neu beleben, in dem sie ihn ihrer Kultur angliederte, und die Priester beeilten
sich den Tanz als göttliches Gnadenmittel zu preisen und zu rühmen. Was gibt es
Köstlicheres, so schreibt der heilige Basilicus, als auf der Erde schon die rhythmischen
Bewegungen der himmlischen Heerscharen nachzuahmen, und der heilige Augustus
pflegte zu sagen: „Auf den Schwingen des Tanzes dringen die Gebete der Gläubigen
bis zum Throne des Höchsten.“
Der Chorführer, der die Reigen leitete, trat zuerst beim Weihnachtsfeste in
Handlung. Er sang einen Hymnus, und die Gläubigen tanzten einen Reigen in
der Meinung, den Reigen der Engel im Stalle zu Bethlehem nachzuahmen.
er ffan% im \\ andel der Reifen
Von Henri Lacroisade.
MODERNE KUNST.
„Ist das nicht ein Boticelli ?“ Er blieb, im Vorwärtsschreiten einhaltend,
vor einem kleinen, stark nachgedunkelten Bild stehen, das zwischen zwei
Fensterpfeilern so ungünstig wie möglich aufgehängt war.
Eine rasche Röte flog über ihr schmales Gesicht: „Ja, Vater hat ihn
vor Jahren in Florenz aufgestöbert. Wie wundervoll, daß du das gleich
erkanntest.“ Es klang eine heiße Freude aus den paar Worten, und eine
Erwartung.
Er nickte sehr befriedigt, schon wieder im Weitergehen. Wer sich solches
„Aufstöbern“ leisten konnte, war doch wohl sehr begütert. Und sein
prüfender Blick ging nun rasch durch alle Räume. Fremd und unbehaglich
hingen da zwischen den erschrecklich offiziellen Bildern fürstlicher Häupter
ein paar herrliche, dunkelgelb schimmernde Elfenbeinplastiken. Standen an
den schreiend bunt tapezierten Wänden einige wenige reichgeschnitzte Möbel,
in einer tiefen braungoldnen Alterslasur schimmernd. Und Tennow erkannte
gleich: das waren ganz seltene Stücke der Florentiner Renaissance, wohl
aus einem Mediceer Palazzo stammend, mit erlesenem Geschmack ausgesucht.
Es gab da auch irisierende Fayenceteller und köstliche Venezianergläser.
Aber diese zarten Wunderwerke waren auf einer häßlichen Nußbaumetagere
aufgebaut, zwischen den monumentalen Renaissancemöbeln standen rote
Plüschsessel, über der gewaltigen Platte eines jener prunkenden Tische des
Quatrocento lag eine blauweiße Häkeldecke gebreitet und vor einer golcl-
strotzenden nachgedunkelten Kirchenstickerei stand in viel zu großem, grell-
blumigem Porzellankübel eine kümmerliche Palme.
Er dachte immerwährend: schade, schade, was ließe sich da alles machen!
Und es war nun wirklich der Kummer des Ästheten, der soviel Schönheit
am unrichtigen Platz, als etwas direkt Verletzendes empfand. Sie nahm
plötzlich seine Hand: „Das mußt du Vater erzählen, daß dir seine Samm-
lungen Freude machen. Er weiß es zwar schon. Ich .... wir sprachen manch-
mal davon nach den Festen, wenn wir noch beisammen saßen in meinem
Zimmer. Da ist alles so wie Vater und ich es uns überall hier wünschten.
Dort ist’s still und gut. Und da erzählte ich ihm dann auch, was du mir
über deine Schönheitsfreude gesagt, Heinrich“.
Er hörte nur das letzte Wort. Es machte ihn rasend, dieses lang-
weilig-korrekte Heinrich. Bis heute hatte er es nie gehört, kaum mehr
sich dieses seines Taufnamens erinnert. Bis heute war er „Harry“. Das war
wie eine Liebkosung. So als strichen weiche Finger über sein Gesicht. Als
käme ein süßes, schwüles Parfüm mit einem Male von irgendwo her durch die
reine wohl temperierte Luft dieser fremden, kahlen Räume, so schien es ihm.
„Vater sammelt mit solcher Freude. Und all dies hier wäre wolil auch
ganz anders, wenn Mutter mehr Teil dran hätte. Sie findet immer, das ,alte
Zeug' sehe so unordentlich zwischen dem .soliden' Hausrat aus. Das er-
schwert alles ein wenig.“
Es war ohne jede Bitterkeit gesagt, klang auch durchaus nicht unehr-
erbietig der Mutter gegenüber. Es war nur eine Entschuldigung, eine sach-
liche Erklärung. Nicht eine Sekunde sollte ihr feiner, vornehmer und
kunstsinniger Vater in den Verdacht der sinnlosen, sportartigen Sammel-
wut kommen vor Heinrich Tennows Kenneraugen.
Er gab sich Mühe, den Sinn ihrer Worte wenigstens in sich aufzunehmen.
Plötzlich schob er seinen Arm in den ihren:
„Weißt du, wenn wir uns erst mal so was zulegen, das muß alles erst-
klassig sein: alte Perser, Bronzen, gute Kopien und schöne Originale, satte,
warme Farben überall, viel Blumen . . . .“
Er sprach lebhaft, angeregt, sah alles schon vor sich, sann weiter, und
merkte gar nicht, daß das Mädchen mit einem Gemisch von glücklichem,
eigen geheimnisvollem Lächeln und grenzenloser, fast demütiger Liebe zu
ihm aufsah.
Dann mit einem Male waren die Eltern da. Der Vater sah ihnen voll
stiller Güte entgegen. Es war auch etwas wie ein leises Prüfen in seinen
Augen. Die Generalin, untersetzt, mit starken Hüften in aufdringlich hellem
lila Tuchkleid, kam ihnen entgegen. Ihr flaches Gesicht war gerötet, ihre
Augen fuhren unsicher über die jungen Menschen hin:
„Ja. Jetzt komme ich, eure Mutter, auch an die Reihe! Lieber Sohn,
nun seien Sie mir willkommen. Wir werden uns gut verstehen, ich lasse es
an nichts fehlen. Ja.“
Der Oberleutnant Tennow zog in seiner sprichwörtlichen Tadellosigkeit
ihre Hand an die Lippen.
So bemerkte er nicht den hilflos gequälten Ausdruck, mit dem Vater
und Tochter sich in die Augen sahen.
„Ja. Und nun denke ich, die Herren haben noch einiges Geschäftliche
zu erledigen. Mein Mann wird Sie von unserer Unterredung in Kenntnis
setzen, Herr von Tennow.“
„Mutter!“ sagte das Mädchen nur leise. Der General ging rasch auf
seine Frau zu:
„Ich denke, Annie, das hat Zeit. Heute sollen die beiden sich ganz allein
gehören. Und wir wollen alles von ihnen fernhalten, was wie Alltag aussieht.“
Margret Kerstens sah ihren Vater an. Und plötzlich lag sie an seiner
Brust, und ihr ganzer Körper zuckte unter einem haltlosen, heißen Weinen.
Der General rührte sich nicht. Er strich nur mit weichen, unendlich
guten Bewegungen über das Haar der Tochter.
Mit einem Ruck nahm die Mutter die Lorgnette vor die Augen:
„Sie ist so leicht exaltiert, lieber Sohn. Und mein Mann bestärkt sie
darin. Ja. Was will ich da machen. Ja. Ich habe den Kopf voll Hausfrauen-
sorgen. Und wenn doch immer alles den Traditionen unseres Hauses gemäß
sein soll. Heute Abend zum Beispiel. .... Nehmen Sie bloß an! Da soll
doch alles stimmen. Beinahe fünfzig Menschen. Denken Sie bloß. Das
gute Geschirr muß heraus, und den Sekt muß man doch abgezählt den
Dienern vorgeben. Ich nehme natürlich deutschen Sekt. Die Leute gießen
das Zeug doch bloß runter. Und Schmittlce, der Lohndiener, trinkt so leicht
mal zwischenrein die Gläser aus. Ja. Und denken Sie mal, die kalten Platten
vom Kasinokoch sind noch nicht da, die müssen die Ordonnanzen holen.
Ja. Und nun wird das Mädchen ja wohl bald wieder in die Reihe kommen.
Entschuldigen Sie mich. Ja. Die Diener sollen doch erst Wurstbrote essen
und Kaffee kriegen, sie nehmen sonst zu leicht mal was von den Platten.
Und das ist doch zu kostspielig, damit füttert man sie doch nicht. Ja.“
[Fortsetzung folgt.]
#is zurück in die ältesten Zeiten reicht die Geschichte des Tanzes. Will man
Lucian von Samosate Glauben schenken, so ist der Tanz ebenso alt wie Amor,
der Götter Ältester. Es soll hier nun der Versuch gemacht werden, den Spuren jener
ersten graziösen Geste, jener ersten taktmäßig rhythmischen Bewegungen der be-
seelten Wesen nachzugehen. Die ältesten choreographischen Bewegungen gehörten
dem rhythmischen Gebetskult an. Es waren rituelle Übungen, die aus den pan-
theistischen Religionen hervorgingen und später vom Katholizismus übernommen
wurden. In den griechischen und ägyptischen Tempeln sowie auch in unseren
ältesten Basiliken finden sich Überreste der Altäre, die von Priestern und Gläubigen
im heiligen Reigen umkreist wurden. Die Hebräer tanzten bei religiösen Dank-
sagungen, und während der dionysischen Feste erschienen die Griechen vor den
steinernen Altären in wohlgeordneten Reihen, um ihre taktmäßigen Bewegungen
zur Ausführung zu bringen. Ebenso wie die Krieger der ältesten Zeiten, die sich
tanzend in das Kampfgetümmel stürzten, kannten auch die Dichter die Muse
des Tanzes.
Im alten Rom tritt uns der Tanz zuerst in Gestalt der weihevollen Umzüge
entgegen, doch mit den Mimen, die von Toskana eindrangen, verloren die über-
[Nachdruck verboten ]
lieferten Formen der rituellen Choreographie allmählich ihren geistlichen Charakter.
Das Maßvolle der langsamen und edlen Gesten machte ungeordneten, doppel-
sinnigen Bewegungen Platz. Der Tanz wurde schließlich zur obszönen Lustbarkeit
verworfener Weiber und liebestrunkener Kurtisanen. Er stellte sich dar als eine
Kette lasziver Figuren, die von Reigen unterbrochen wurden, in denen .die In-
spiration des erotischen Elements die führende Rolle einnahm.
Die katholische Kirche versuchte diesen Ausschweifungen schamloser Dirnen
und ihrem Ärgernis erregenden Treiben ein Ziel zu setzen. Sie wollte den antiken
Tanz neu beleben, in dem sie ihn ihrer Kultur angliederte, und die Priester beeilten
sich den Tanz als göttliches Gnadenmittel zu preisen und zu rühmen. Was gibt es
Köstlicheres, so schreibt der heilige Basilicus, als auf der Erde schon die rhythmischen
Bewegungen der himmlischen Heerscharen nachzuahmen, und der heilige Augustus
pflegte zu sagen: „Auf den Schwingen des Tanzes dringen die Gebete der Gläubigen
bis zum Throne des Höchsten.“
Der Chorführer, der die Reigen leitete, trat zuerst beim Weihnachtsfeste in
Handlung. Er sang einen Hymnus, und die Gläubigen tanzten einen Reigen in
der Meinung, den Reigen der Engel im Stalle zu Bethlehem nachzuahmen.
er ffan% im \\ andel der Reifen
Von Henri Lacroisade.