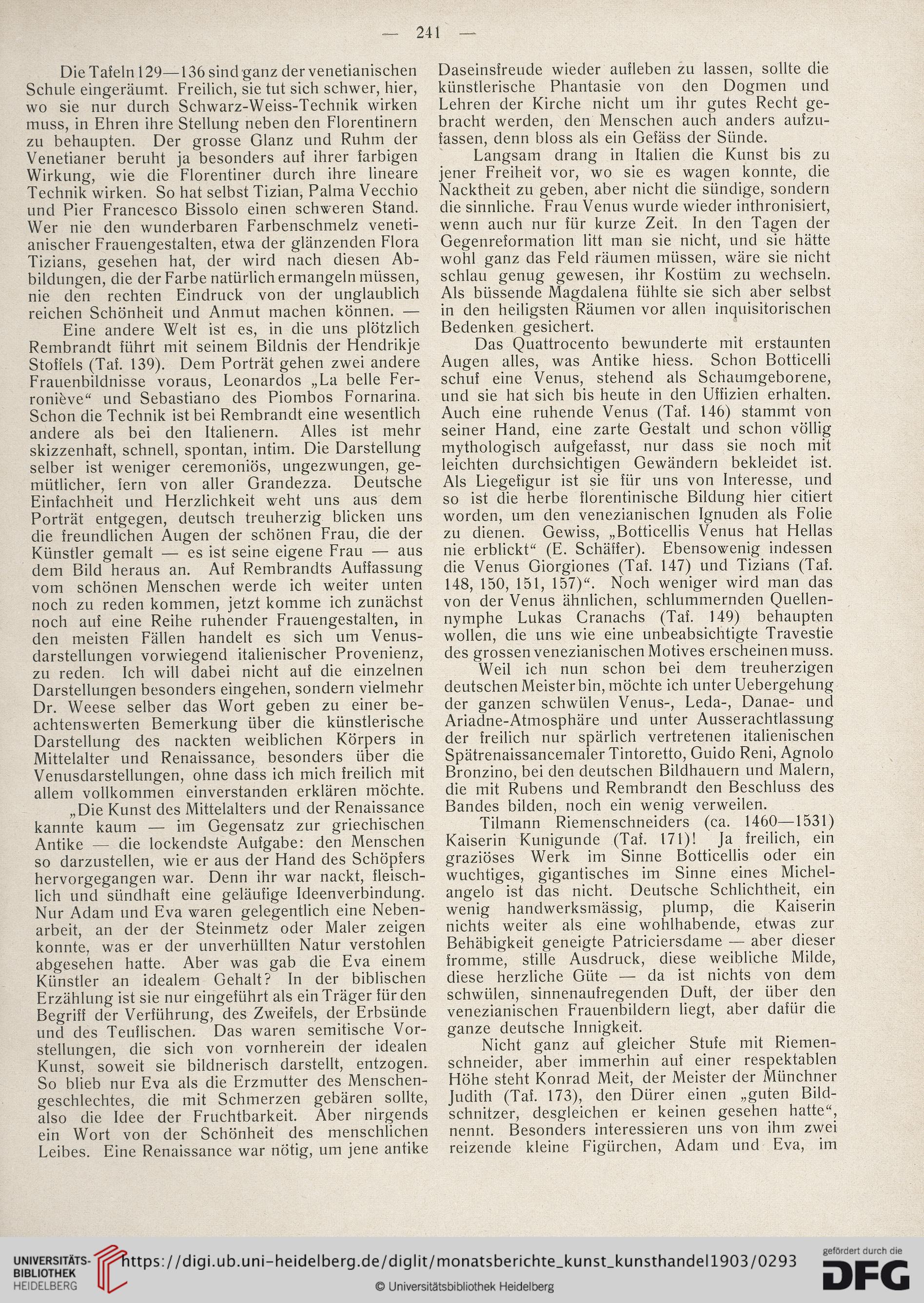241
Die Tafeln 129— 136 sind ganz der venetianischen
Schule eingeräumt. Freilich, sie tut sich schwer, hier,
wo sie nur durch Schwarz-Weiss-Technik wirken
muss, in Ehren ihre Stellung neben den Florentinern
zu behaupten. Der grosse Glanz und Ruhm der
Venetianer beruht ja besonders auf ihrer farbigen
Wirkung, wie die Florentiner durch ihre lineare
Technik wirken. So hat selbst Tizian, Palma Vecchio
und Pier Francesco Bissolo einen schweren Stand.
Wer nie den wunderbaren Farbenschmelz veneti-
anischer Frauengestalten, etwa der glänzenden Flora
Tizians, gesehen hat, der wird nach diesen Ab-
bildungen, die der Farbe natürlich ermangeln müssen,
nie den rechten Eindruck von der unglaublich
reichen Schönheit und Anmut machen können. —
Eine andere Welt ist es, in die uns plötzlich
Rembrandt führt mit seinem Bildnis der Hendrikje
Stoffels (Tat. 139). Dem Porträt gehen zwei andere
Frauenbildnisse voraus, Leonardos „La belle Fer-
ronieve“ und Sebastiano des Piombos Fornarina.
Schon die Technik ist bei Rembrandt eine wesentlich
andere als bei den Italienern. Alles ist mehr
skizzenhaft, schnell, spontan, intim. Die Darstellung
selber ist weniger ceremoniös, ungezwungen, ge-
mütlicher, fern von aller Grandezza. Deutsche
Einfachheit und Herzlichkeit weht uns aus dem
Porträt entgegen, deutsch treuherzig blicken uns
die freundlichen Augen der schönen Frau, die der
Künstler gemalt — es ist seine eigene Frau — aus
dem Bild heraus an. Auf Rembrandts Auffassung
vom schönen Menschen werde ich weiter unten
noch zu reden kommen, jetzt komme ich zunächst
noch auf eine Reihe ruhender Frauengestalten, in
den meisten Fällen handelt es sich um Venus-
darstellungen vorwiegend italienischer Provenienz,
zu reden. Ich will dabei nicht auf die einzelnen
Darstellungen besonders eingehen, sondern vielmehr
Dr. Weese selber das Wort geben zu einer be-
achtenswerten Bemerkung über die künstlerische
Darstellung des nackten weiblichen Körpers in
Mittelalter und Renaissance, besonders über die
Venusdarstellungen, ohne dass ich mich freilich mit
allem vollkommen einverstanden erklären möchte.
„Die Kunst des Mittelalters und der Renaissance
kannte kaum — im Gegensatz zur griechischen
Antike — die lockendste Aufgabe: den Menschen
so darzustellen, wie er aus der Hand des Schöpfers
hervorgegangen war. Denn ihr war nackt, fleisch-
lich und sündhaft eine geläufige Ideenverbindung.
Nur Adam und Eva waren gelegentlich eine Neben-
arbeit, an der der Steinmetz oder Maler zeigen
konnte, was er der unverhüllten Natur verstohlen
abgesehen hatte. Aber was gab die Eva einem
Künstler an idealem Gehalt? In der biblischen
Erzählung ist sie nur eingeführt als ein Träger für den
Begriff der Verführung, des Zweifels, der Erbsünde
und des Teuflischen. Das waren semitische Vor-
stellungen, die sich von vornherein der idealen
Kunst, soweit sie bildnerisch darstellt, entzogen.
So blieb nur Eva als die Erzmutter des Menschen-
geschlechtes, die mit Schmerzen gebären sollte,
also die Idee der Fruchtbarkeit. Aber nirgends
ein Wort von der Schönheit des menschlichen
Leibes. Eine Renaissance war nötig, um jene antike
Daseinsfreude wieder aufleben zu lassen, sollte die
künstlerische Phantasie von den Dogmen und
Lehren der Kirche nicht um ihr gutes Recht ge-
bracht werden, den Menschen auch anders aufzu-
fassen, denn bloss als ein Gefäss der Sünde.
Langsam drang in Italien die Kunst bis zu
jener Freiheit vor, wo sie es wagen konnte, die
Nacktheit zu geben, aber nicht die sündige, sondern
die sinnliche. Frau Venus wurde wieder inthronisiert,
wenn auch nur für kurze Zeit. In den Tagen der
Gegenreformation litt man sie nicht, und sie hätte
wohl ganz das Feld räumen müssen, wäre sie nicht
schlau genug gewesen, ihr Kostüm zu wechseln.
Als büssende Magdalena fühlte sie sich aber selbst
in den heiligsten Räumen vor allen inquisitorischen
Bedenken gesichert.
Das Quattrocento bewunderte mit erstaunten
Augen alles, was Antike hiess. Schon Botticelli
schuf eine Venus, stehend als Schaumgeborene,
und sie hat sich bis heute in den Uffizien erhalten.
Auch eine ruhende Venus (Taf. 146) stammt von
seiner Hand, eine zarte Gestalt und schon völlig
mythologisch aufgefasst, nur dass sie noch mit
leichten durchsichtigen Gewändern bekleidet ist.
Als Liegefigur ist sie für uns von Interesse, und
so ist die herbe florentinische Bildung hier citiert
worden, um den venezianischen Ignuden als Folie
zu dienen. Gewiss, „Botticellis Venus hat Hellas
nie erblickt“ (E. Schäffer). Ebensowenig indessen
die Venus Giorgiones (Taf. 147) und Tizians (Taf.
148, 150, 151, 157)“. Noch weniger wird man das
von der Venus ähnlichen, schlummernden Quellen-
nymphe Lukas Cranachs (Taf. 149) behaupten
wollen, die uns wie eine unbeabsichtigte Travestie
des grossen venezianischen Motives erscheinen muss.
Weil ich nun schon bei dem treuherzigen
deutschen Meisterbin, möchte ich unter Uebergehung
der ganzen schwülen Venus-, Leda-, Danae- und
Ariadne-Atmosphäre und unter Ausserachtlassung
der freilich nur spärlich vertretenen italienischen
Spätrenaissancemaler Tintoretto, Guido Reni, Agnolo
Bronzino, bei den deutschen Bildhauern und Malern,
die mit Rubens und Rembrandt den Beschluss des
Bandes bilden, noch ein wenig verweilen.
Tilmann Riemenschneiders (ca. 1460—1531)
Kaiserin Kunigunde (Taf. 171)1 Ja freilich, ein
graziöses Werk im Sinne Botticellis oder ein
wuchtiges, gigantisches im Sinne eines Michel-
angelo ist das nicht. Deutsche Schlichtheit, ein
wenig handwerksmässig, plump, die Kaiserin
nichts weiter als eine wohlhabende, etwas zur
Behäbigkeit geneigte Patriciersdame — aber dieser
fromme, stille Ausdruck, diese weibliche Milde,
diese herzliche Güte — da ist nichts von dem
schwülen, sinnenaufregenden Duft, der über den
venezianischen Frauenbildern liegt, aber dafür die
ganze deutsche Innigkeit.
Nicht ganz auf gleicher Stufe mit Riemen-
schneider, aber immerhin auf einer respektablen
Höhe steht Konrad Meit, der Meister der Münchner
Judith (Taf. 173), den Dürer einen „guten Bild-
schnitzer, desgleichen er keinen gesehen hatte“,
nennt. Besonders interessieren uns von ihm zwei
reizende kleine Figürchen, Adam und Eva, im
Die Tafeln 129— 136 sind ganz der venetianischen
Schule eingeräumt. Freilich, sie tut sich schwer, hier,
wo sie nur durch Schwarz-Weiss-Technik wirken
muss, in Ehren ihre Stellung neben den Florentinern
zu behaupten. Der grosse Glanz und Ruhm der
Venetianer beruht ja besonders auf ihrer farbigen
Wirkung, wie die Florentiner durch ihre lineare
Technik wirken. So hat selbst Tizian, Palma Vecchio
und Pier Francesco Bissolo einen schweren Stand.
Wer nie den wunderbaren Farbenschmelz veneti-
anischer Frauengestalten, etwa der glänzenden Flora
Tizians, gesehen hat, der wird nach diesen Ab-
bildungen, die der Farbe natürlich ermangeln müssen,
nie den rechten Eindruck von der unglaublich
reichen Schönheit und Anmut machen können. —
Eine andere Welt ist es, in die uns plötzlich
Rembrandt führt mit seinem Bildnis der Hendrikje
Stoffels (Tat. 139). Dem Porträt gehen zwei andere
Frauenbildnisse voraus, Leonardos „La belle Fer-
ronieve“ und Sebastiano des Piombos Fornarina.
Schon die Technik ist bei Rembrandt eine wesentlich
andere als bei den Italienern. Alles ist mehr
skizzenhaft, schnell, spontan, intim. Die Darstellung
selber ist weniger ceremoniös, ungezwungen, ge-
mütlicher, fern von aller Grandezza. Deutsche
Einfachheit und Herzlichkeit weht uns aus dem
Porträt entgegen, deutsch treuherzig blicken uns
die freundlichen Augen der schönen Frau, die der
Künstler gemalt — es ist seine eigene Frau — aus
dem Bild heraus an. Auf Rembrandts Auffassung
vom schönen Menschen werde ich weiter unten
noch zu reden kommen, jetzt komme ich zunächst
noch auf eine Reihe ruhender Frauengestalten, in
den meisten Fällen handelt es sich um Venus-
darstellungen vorwiegend italienischer Provenienz,
zu reden. Ich will dabei nicht auf die einzelnen
Darstellungen besonders eingehen, sondern vielmehr
Dr. Weese selber das Wort geben zu einer be-
achtenswerten Bemerkung über die künstlerische
Darstellung des nackten weiblichen Körpers in
Mittelalter und Renaissance, besonders über die
Venusdarstellungen, ohne dass ich mich freilich mit
allem vollkommen einverstanden erklären möchte.
„Die Kunst des Mittelalters und der Renaissance
kannte kaum — im Gegensatz zur griechischen
Antike — die lockendste Aufgabe: den Menschen
so darzustellen, wie er aus der Hand des Schöpfers
hervorgegangen war. Denn ihr war nackt, fleisch-
lich und sündhaft eine geläufige Ideenverbindung.
Nur Adam und Eva waren gelegentlich eine Neben-
arbeit, an der der Steinmetz oder Maler zeigen
konnte, was er der unverhüllten Natur verstohlen
abgesehen hatte. Aber was gab die Eva einem
Künstler an idealem Gehalt? In der biblischen
Erzählung ist sie nur eingeführt als ein Träger für den
Begriff der Verführung, des Zweifels, der Erbsünde
und des Teuflischen. Das waren semitische Vor-
stellungen, die sich von vornherein der idealen
Kunst, soweit sie bildnerisch darstellt, entzogen.
So blieb nur Eva als die Erzmutter des Menschen-
geschlechtes, die mit Schmerzen gebären sollte,
also die Idee der Fruchtbarkeit. Aber nirgends
ein Wort von der Schönheit des menschlichen
Leibes. Eine Renaissance war nötig, um jene antike
Daseinsfreude wieder aufleben zu lassen, sollte die
künstlerische Phantasie von den Dogmen und
Lehren der Kirche nicht um ihr gutes Recht ge-
bracht werden, den Menschen auch anders aufzu-
fassen, denn bloss als ein Gefäss der Sünde.
Langsam drang in Italien die Kunst bis zu
jener Freiheit vor, wo sie es wagen konnte, die
Nacktheit zu geben, aber nicht die sündige, sondern
die sinnliche. Frau Venus wurde wieder inthronisiert,
wenn auch nur für kurze Zeit. In den Tagen der
Gegenreformation litt man sie nicht, und sie hätte
wohl ganz das Feld räumen müssen, wäre sie nicht
schlau genug gewesen, ihr Kostüm zu wechseln.
Als büssende Magdalena fühlte sie sich aber selbst
in den heiligsten Räumen vor allen inquisitorischen
Bedenken gesichert.
Das Quattrocento bewunderte mit erstaunten
Augen alles, was Antike hiess. Schon Botticelli
schuf eine Venus, stehend als Schaumgeborene,
und sie hat sich bis heute in den Uffizien erhalten.
Auch eine ruhende Venus (Taf. 146) stammt von
seiner Hand, eine zarte Gestalt und schon völlig
mythologisch aufgefasst, nur dass sie noch mit
leichten durchsichtigen Gewändern bekleidet ist.
Als Liegefigur ist sie für uns von Interesse, und
so ist die herbe florentinische Bildung hier citiert
worden, um den venezianischen Ignuden als Folie
zu dienen. Gewiss, „Botticellis Venus hat Hellas
nie erblickt“ (E. Schäffer). Ebensowenig indessen
die Venus Giorgiones (Taf. 147) und Tizians (Taf.
148, 150, 151, 157)“. Noch weniger wird man das
von der Venus ähnlichen, schlummernden Quellen-
nymphe Lukas Cranachs (Taf. 149) behaupten
wollen, die uns wie eine unbeabsichtigte Travestie
des grossen venezianischen Motives erscheinen muss.
Weil ich nun schon bei dem treuherzigen
deutschen Meisterbin, möchte ich unter Uebergehung
der ganzen schwülen Venus-, Leda-, Danae- und
Ariadne-Atmosphäre und unter Ausserachtlassung
der freilich nur spärlich vertretenen italienischen
Spätrenaissancemaler Tintoretto, Guido Reni, Agnolo
Bronzino, bei den deutschen Bildhauern und Malern,
die mit Rubens und Rembrandt den Beschluss des
Bandes bilden, noch ein wenig verweilen.
Tilmann Riemenschneiders (ca. 1460—1531)
Kaiserin Kunigunde (Taf. 171)1 Ja freilich, ein
graziöses Werk im Sinne Botticellis oder ein
wuchtiges, gigantisches im Sinne eines Michel-
angelo ist das nicht. Deutsche Schlichtheit, ein
wenig handwerksmässig, plump, die Kaiserin
nichts weiter als eine wohlhabende, etwas zur
Behäbigkeit geneigte Patriciersdame — aber dieser
fromme, stille Ausdruck, diese weibliche Milde,
diese herzliche Güte — da ist nichts von dem
schwülen, sinnenaufregenden Duft, der über den
venezianischen Frauenbildern liegt, aber dafür die
ganze deutsche Innigkeit.
Nicht ganz auf gleicher Stufe mit Riemen-
schneider, aber immerhin auf einer respektablen
Höhe steht Konrad Meit, der Meister der Münchner
Judith (Taf. 173), den Dürer einen „guten Bild-
schnitzer, desgleichen er keinen gesehen hatte“,
nennt. Besonders interessieren uns von ihm zwei
reizende kleine Figürchen, Adam und Eva, im