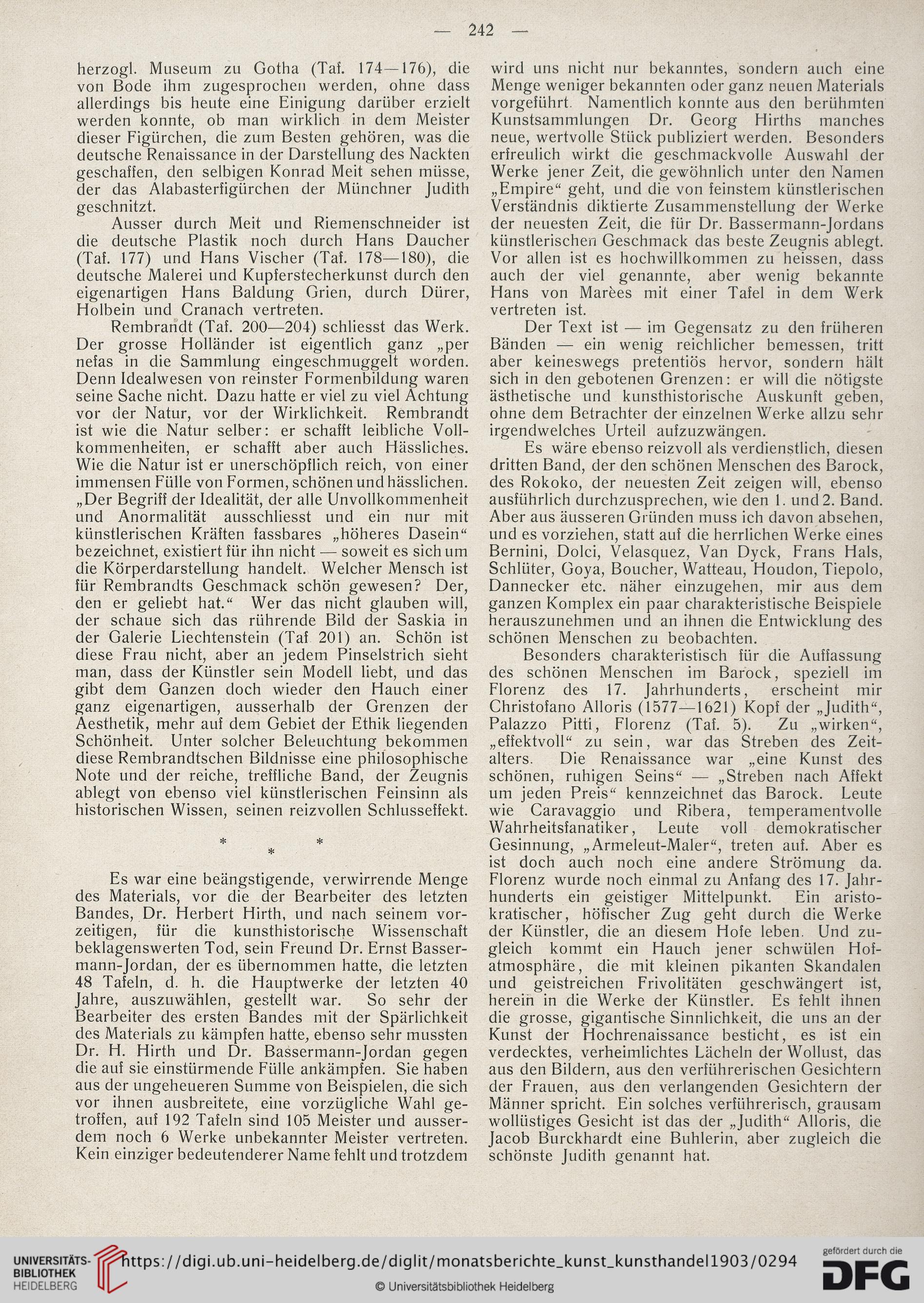242
herzogl. Museum zu Gotha (Tat 174—176), die
von Bode ihm zugesprochen werden, ohne dass
allerdings bis heute eine Einigung darüber erzielt
werden konnte, ob man wirklich in dem Meister
dieser Figürchen, die zum Besten gehören, was die
deutsche Renaissance in der Darstellung des Nackten
geschaffen, den selbigen Konrad Meit sehen müsse,
der das Alabasterfigürchen der Münchner Judith
geschnitzt.
Äusser durch Meit und Riemenschneider ist
die deutsche Plastik noch durch Hans Daucher
(Taf. 177) und Hans Vischer (Taf. 178—180), die
deutsche Malerei und Kupferstecherkunst durch den
eigenartigen Hans Baldung Grien, durch Dürer,
Holbein und Cranach vertreten.
Rembrandt (Taf. 200—204) schliesst das Werk.
Der grosse Holländer ist eigentlich ganz „per
nefas in die Sammlung eingeschmuggelt worden.
Denn Idealwesen von reinster Formenbildung waren
seine Sache nicht. Dazu hatte er viel zu viel Achtung
vor der Natur, vor der Wirklichkeit. Rembrandt
ist wie die Natur selber: er schafft leibliche Voll-
kommenheiten, er schafft aber auch Hässliches.
Wie die Natur ist er unerschöpflich reich, von einer
immensen Fülle von Formen, schönen und hässlichen.
„Der Begriff der Idealität, der alle Unvollkommenheit
und Anormalität ausschliesst und ein nur mit
künstlerischen Kräften fassbares „höheres Dasein“
bezeichnet, existiert für ihn nicht — soweit es sich um
die Körperdarstellung handelt. Welcher Mensch ist
für Rembrandts Geschmack schön gewesen? Der,
den er geliebt hat.“ Wer das nicht glauben will,
der schaue sich das rührende Bild der Saskia in
der Galerie Liechtenstein (Taf 201) an. Schön ist
diese Frau nicht, aber an jedem Pinselstrich sieht
man, dass der Künstler sein Modell liebt, und das
gibt dem Ganzen doch wieder den Hauch einer
ganz eigenartigen, ausserhalb der Grenzen der
Aesthetik, mehr auf dem Gebiet der Ethik liegenden
Schönheit. Unter solcher Beleuchtung bekommen
diese Rembrandtschen Bildnisse eine philosophische
Note und der reiche, treffliche Band, der Zeugnis
ablegt von ebenso viel künstlerischen Feinsinn als
historischen Wissen, seinen reizvollen Schlusseffekt.
* *
*
Es war eine beängstigende, verwirrende Menge
des Materials, vor die der Bearbeiter des letzten
Bandes, Dr. Herbert Hirth, und nach seinem vor-
zeitigen, für die kunsthistorische Wissenschaft
beklagenswerten Tod, sein Freund Dr. Ernst Basser-
mann-Jordan, der es übernommen hatte, die letzten
48 Tafeln, d. h. die Hauptwerke der letzten 40
Jahre, auszuwählen, gestellt war. So sehr der
Bearbeiter des ersten Bandes mit der Spärlichkeit
des Materials zu kämpfen hatte, ebenso sehr mussten
Dr. H. Hirth und Dr. Bassermann-Jordan gegen
die auf sie einstürmende Fülle ankämpfen. Sie haben
aus der ungeheueren Summe von Beispielen, die sich
vor ihnen ausbreitete, eine vorzügliche Wahl ge-
troffen, auf 192 Tafeln sind 105 Meister und ausser-
dem noch 6 Werke unbekannter Meister vertreten.
Kein einziger bedeutenderer Name fehlt und trotzdem
wird uns nicht nur bekanntes, sondern auch eine
Menge weniger bekannten oder ganz neuen Materials
vorgeführt. Namentlich konnte aus den berühmten
Kunstsammlungen Dr. Georg Hirths manches
neue, wertvolle Stück publiziert werden. Besonders
erfreulich wirkt die geschmackvolle Auswahl der
Werke jener Zeit, die gewöhnlich unter den Namen
„Empire“ geht, und die von feinstem künstlerischen
Verständnis diktierte Zusammenstellung der Werke
der neuesten Zeit, die für Dr. Bassermann-Jordans
künstlerischen Geschmack das beste Zeugnis ablegt.
Vor allen ist es hochwillkommen zu heissen, dass
auch der viel genannte, aber wenig bekannte
Hans von Marees mit einer Tafel in dem Werk
vertreten ist.
Der Text ist — im Gegensatz zu den früheren
Bänden — ein wenig reichlicher bemessen, tritt
aber keineswegs pretentiös hervor, sondern hält
sich in den gebotenen Grenzen: er will die nötigste
ästhetische und kunsthistorische Auskunft geben,
ohne dem Betrachter der einzelnen Werke allzu sehr
irgendwelches Urteil aufzuzwängen.
Es wäre ebenso reizvoll als verdienstlich, diesen
dritten Band, der den schönen Menschen des Barock,
des Rokoko, der neuesten Zeit zeigen will, ebenso
ausführlich durchzusprechen, wie den 1. und 2. Band.
Aber aus äusseren Gründen muss ich davon absehen,
und es vorziehen, statt auf die herrlichen Werke eines
Bernini, Dolci, Velasquez, Van Dyck, Frans Hals,
Schlüter, Goya, Boucher, Watteau, Houdon, Tiepolo,
Dannecker etc. näher einzugehen, mir aus dem
ganzen Komplex ein paar charakteristische Beispiele
herauszunehmen und an ihnen die Entwicklung des
schönen Menschen zu beobachten.
Besonders charakteristisch für die Auffassung
des schönen Menschen im Barock, speziell im
Florenz des 17. Jahrhunderts, erscheint mir
Christofano Alloris (1577—1621) Kopf der „Judith“,
Palazzo Pitti, Florenz (Taf. 5). Zu „wirken“,
„effektvoll“ zu sein, war das Streben des Zeit-
alters. Die Renaissance war „eine Kunst des
schönen, ruhigen Seins“ — „Streben nach Affekt
um jeden Preis“ kennzeichnet das Barock. Leute
wie Caravaggio und Ribera, temperamentvolle
Wahrheitsfanatiker, Leute voll demokratischer
Gesinnung, „Armeleut-Maler“, treten auf. Aber es
ist doch auch noch eine andere Strömung da.
Florenz wurde noch einmal zu Anfang des 17. Jahr-
hunderts ein geistiger Mittelpunkt. Ein aristo-
kratischer, höfischer Zug geht durch die Werke
der Künstler, die an diesem Hofe leben. Und zu-
gleich kommt ein Hauch jener schwülen Hof-
atmosphäre, die mit kleinen pikanten Skandalen
und geistreichen Frivolitäten geschwängert ist,
herein in die Werke der Künstler. Es fehlt ihnen
die grosse, gigantische Sinnlichkeit, die uns an der
Kunst der Hochrenaissance besticht, es ist ein
verdecktes, verheimlichtes Lächeln der Wollust, das
aus den Bildern, aus den verführerischen Gesichtern
der Frauen, aus den verlangenden Gesichtern der
Männer spricht. Ein solches verführerisch, grausam
wollüstiges Gesicht ist das der „Judith“ Alloris, die
Jacob Burckhardt eine Buhlerin, aber zugleich die
schönste Judith genannt hat.
herzogl. Museum zu Gotha (Tat 174—176), die
von Bode ihm zugesprochen werden, ohne dass
allerdings bis heute eine Einigung darüber erzielt
werden konnte, ob man wirklich in dem Meister
dieser Figürchen, die zum Besten gehören, was die
deutsche Renaissance in der Darstellung des Nackten
geschaffen, den selbigen Konrad Meit sehen müsse,
der das Alabasterfigürchen der Münchner Judith
geschnitzt.
Äusser durch Meit und Riemenschneider ist
die deutsche Plastik noch durch Hans Daucher
(Taf. 177) und Hans Vischer (Taf. 178—180), die
deutsche Malerei und Kupferstecherkunst durch den
eigenartigen Hans Baldung Grien, durch Dürer,
Holbein und Cranach vertreten.
Rembrandt (Taf. 200—204) schliesst das Werk.
Der grosse Holländer ist eigentlich ganz „per
nefas in die Sammlung eingeschmuggelt worden.
Denn Idealwesen von reinster Formenbildung waren
seine Sache nicht. Dazu hatte er viel zu viel Achtung
vor der Natur, vor der Wirklichkeit. Rembrandt
ist wie die Natur selber: er schafft leibliche Voll-
kommenheiten, er schafft aber auch Hässliches.
Wie die Natur ist er unerschöpflich reich, von einer
immensen Fülle von Formen, schönen und hässlichen.
„Der Begriff der Idealität, der alle Unvollkommenheit
und Anormalität ausschliesst und ein nur mit
künstlerischen Kräften fassbares „höheres Dasein“
bezeichnet, existiert für ihn nicht — soweit es sich um
die Körperdarstellung handelt. Welcher Mensch ist
für Rembrandts Geschmack schön gewesen? Der,
den er geliebt hat.“ Wer das nicht glauben will,
der schaue sich das rührende Bild der Saskia in
der Galerie Liechtenstein (Taf 201) an. Schön ist
diese Frau nicht, aber an jedem Pinselstrich sieht
man, dass der Künstler sein Modell liebt, und das
gibt dem Ganzen doch wieder den Hauch einer
ganz eigenartigen, ausserhalb der Grenzen der
Aesthetik, mehr auf dem Gebiet der Ethik liegenden
Schönheit. Unter solcher Beleuchtung bekommen
diese Rembrandtschen Bildnisse eine philosophische
Note und der reiche, treffliche Band, der Zeugnis
ablegt von ebenso viel künstlerischen Feinsinn als
historischen Wissen, seinen reizvollen Schlusseffekt.
* *
*
Es war eine beängstigende, verwirrende Menge
des Materials, vor die der Bearbeiter des letzten
Bandes, Dr. Herbert Hirth, und nach seinem vor-
zeitigen, für die kunsthistorische Wissenschaft
beklagenswerten Tod, sein Freund Dr. Ernst Basser-
mann-Jordan, der es übernommen hatte, die letzten
48 Tafeln, d. h. die Hauptwerke der letzten 40
Jahre, auszuwählen, gestellt war. So sehr der
Bearbeiter des ersten Bandes mit der Spärlichkeit
des Materials zu kämpfen hatte, ebenso sehr mussten
Dr. H. Hirth und Dr. Bassermann-Jordan gegen
die auf sie einstürmende Fülle ankämpfen. Sie haben
aus der ungeheueren Summe von Beispielen, die sich
vor ihnen ausbreitete, eine vorzügliche Wahl ge-
troffen, auf 192 Tafeln sind 105 Meister und ausser-
dem noch 6 Werke unbekannter Meister vertreten.
Kein einziger bedeutenderer Name fehlt und trotzdem
wird uns nicht nur bekanntes, sondern auch eine
Menge weniger bekannten oder ganz neuen Materials
vorgeführt. Namentlich konnte aus den berühmten
Kunstsammlungen Dr. Georg Hirths manches
neue, wertvolle Stück publiziert werden. Besonders
erfreulich wirkt die geschmackvolle Auswahl der
Werke jener Zeit, die gewöhnlich unter den Namen
„Empire“ geht, und die von feinstem künstlerischen
Verständnis diktierte Zusammenstellung der Werke
der neuesten Zeit, die für Dr. Bassermann-Jordans
künstlerischen Geschmack das beste Zeugnis ablegt.
Vor allen ist es hochwillkommen zu heissen, dass
auch der viel genannte, aber wenig bekannte
Hans von Marees mit einer Tafel in dem Werk
vertreten ist.
Der Text ist — im Gegensatz zu den früheren
Bänden — ein wenig reichlicher bemessen, tritt
aber keineswegs pretentiös hervor, sondern hält
sich in den gebotenen Grenzen: er will die nötigste
ästhetische und kunsthistorische Auskunft geben,
ohne dem Betrachter der einzelnen Werke allzu sehr
irgendwelches Urteil aufzuzwängen.
Es wäre ebenso reizvoll als verdienstlich, diesen
dritten Band, der den schönen Menschen des Barock,
des Rokoko, der neuesten Zeit zeigen will, ebenso
ausführlich durchzusprechen, wie den 1. und 2. Band.
Aber aus äusseren Gründen muss ich davon absehen,
und es vorziehen, statt auf die herrlichen Werke eines
Bernini, Dolci, Velasquez, Van Dyck, Frans Hals,
Schlüter, Goya, Boucher, Watteau, Houdon, Tiepolo,
Dannecker etc. näher einzugehen, mir aus dem
ganzen Komplex ein paar charakteristische Beispiele
herauszunehmen und an ihnen die Entwicklung des
schönen Menschen zu beobachten.
Besonders charakteristisch für die Auffassung
des schönen Menschen im Barock, speziell im
Florenz des 17. Jahrhunderts, erscheint mir
Christofano Alloris (1577—1621) Kopf der „Judith“,
Palazzo Pitti, Florenz (Taf. 5). Zu „wirken“,
„effektvoll“ zu sein, war das Streben des Zeit-
alters. Die Renaissance war „eine Kunst des
schönen, ruhigen Seins“ — „Streben nach Affekt
um jeden Preis“ kennzeichnet das Barock. Leute
wie Caravaggio und Ribera, temperamentvolle
Wahrheitsfanatiker, Leute voll demokratischer
Gesinnung, „Armeleut-Maler“, treten auf. Aber es
ist doch auch noch eine andere Strömung da.
Florenz wurde noch einmal zu Anfang des 17. Jahr-
hunderts ein geistiger Mittelpunkt. Ein aristo-
kratischer, höfischer Zug geht durch die Werke
der Künstler, die an diesem Hofe leben. Und zu-
gleich kommt ein Hauch jener schwülen Hof-
atmosphäre, die mit kleinen pikanten Skandalen
und geistreichen Frivolitäten geschwängert ist,
herein in die Werke der Künstler. Es fehlt ihnen
die grosse, gigantische Sinnlichkeit, die uns an der
Kunst der Hochrenaissance besticht, es ist ein
verdecktes, verheimlichtes Lächeln der Wollust, das
aus den Bildern, aus den verführerischen Gesichtern
der Frauen, aus den verlangenden Gesichtern der
Männer spricht. Ein solches verführerisch, grausam
wollüstiges Gesicht ist das der „Judith“ Alloris, die
Jacob Burckhardt eine Buhlerin, aber zugleich die
schönste Judith genannt hat.