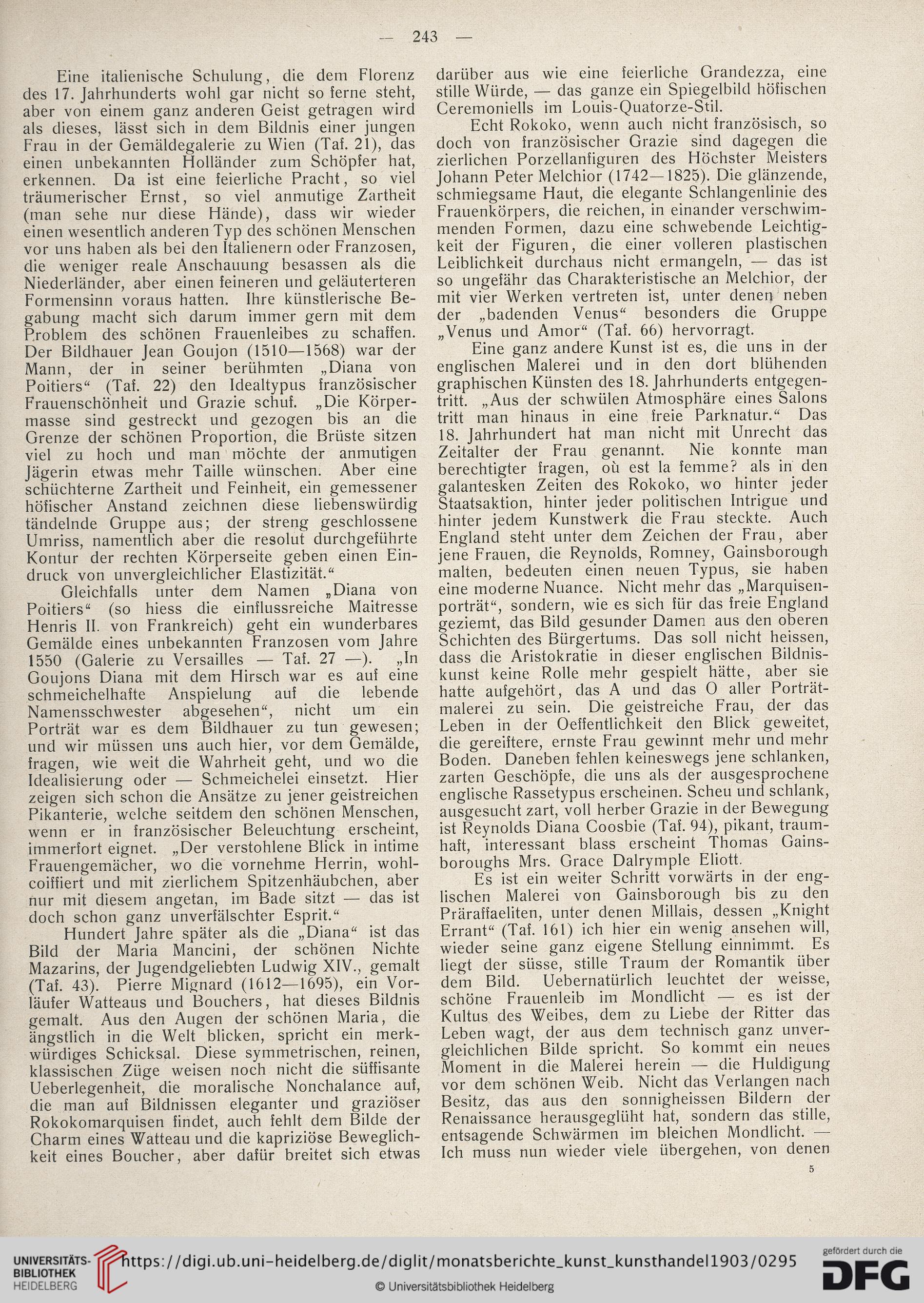243
Eine italienische Schulung, die dem Florenz
des 17. Jahrhunderts wohl gar nicht so ferne steht,
aber von einem ganz anderen Geist getragen wird
als dieses, lässt sich in dem Bildnis einer jungen
Frau in der Gemäldegalerie zu Wien (Taf. 21), das
einen unbekannten Holländer zum Schöpfer hat,
erkennen. Da ist eine feierliche Pracht, so viel
träumerischer Ernst, so viel anmutige Zartheit
(man sehe nur diese Hände), dass wir wieder
einen wesentlich anderen Typ des schönen Menschen
vor uns haben als bei den Italienern oder Franzosen,
die weniger reale Anschauung besassen als die
Niederländer, aber einen feineren und geläuterteren
Formensinn voraus hatten. Ihre künstlerische Be-
gabung macht sich darum immer gern mit dem
Problem des schönen Frauenleibes zu schaffen.
Der Bildhauer Jean Goujon (1510—1568) war der
Mann, der in seiner berühmten „Diana von
Poitiers“ (Taf. 22) den Idealtypus französischer
Frauenschönheit und Grazie schuf. „Die Körper-
masse sind gestreckt und gezogen bis an die
Grenze der schönen Proportion, die Brüste sitzen
viel zu hoch und man möchte der anmutigen
Jägerin etwas mehr Taille wünschen. Aber eine
schüchterne Zartheit und Feinheit, ein gemessener
höfischer Anstand zeichnen diese liebenswürdig
tändelnde Gruppe aus; der streng geschlossene
Umriss, namentlich aber die resolut durchgeführte
Kontur der rechten Körperseite geben einen Ein-
druck von unvergleichlicher Elastizität.“
Gleichfalls unter dem Namen „Diana von
Poitiers“ (so hiess die einflussreiche Maitresse
Henris II. von Frankreich) geht ein wunderbares
Gemälde eines unbekannten Franzosen vom Jahre
1550 (Galerie zu Versailles — Taf. 27 —). „In
Goujons Diana mit dem Hirsch war es auf eine
schmeichelhafte Anspielung auf die lebende
Namensschwester abgesehen“, nicht um ein
Porträt war es dem Bildhauer zu tun gewesen;
und wir müssen uns auch hier, vor dem Gemälde,
fragen, wie weit die Wahrheit geht, und wo die
Idealisierung oder — Schmeichelei einsetzt. Hier
zeigen sich schon die Ansätze zu jener geistreichen
Pikanterie, welche seitdem den schönen Menschen,
wenn er in französischer Beleuchtung erscheint,
immerfort eignet. „Der verstohlene Blick in intime
Frauengemächer, wo die vornehme Herrin, wohl-
coiffiert und mit zierlichem Spitzenhäubchen, aber
nur mit diesem angetan, im Bade sitzt — das ist
doch schon ganz unverfälschter Esprit.“
Hundert Jahre später als die „Diana“ ist das
Bild der Maria Mancini, der schönen Nichte
Mazarins, der Jugendgeliebten Ludwig XIV., gemalt
(Taf. 43). Pierre Mignard (1612—1695), ein Vor-
läufer Watteaus und Bouchers, hat dieses Bildnis
gemalt. Aus den Augen der schönen Maria, die
ängstlich in die Welt blicken, spricht ein merk-
würdiges Schicksal. Diese symmetrischen, reinen,
klassischen Züge weisen noch nicht die süffisante
Ueberlegenheit, die moralische Nonchalance auf,
die man auf Bildnissen eleganter und graziöser
Rokokomarquisen findet, auch fehlt dem Bilde der
Charm eines Watteau und die kapriziöse Beweglich-
keit eines Boucher, aber dafür breitet sich etwas
darüber aus wie eine feierliche Grandezza, eine
stille Würde, — das ganze ein Spiegelbild höfischen
Ceremoniells im Louis-Quatorze-StiL
Echt Rokoko, wenn auch nicht französisch, so
doch von französischer Grazie sind dagegen die
zierlichen Porzellanfiguren des Höchster Meisters
Johann Peter Melchior (1742—1825). Die glänzende,
schmiegsame Haut, die elegante Schlangenlinie des
Frauenkörpers, die reichen, in einander verschwim-
menden Formen, dazu eine schwebende Leichtig-
keit der Figuren, die einer volleren plastischen
Leiblichkeit durchaus nicht ermangeln, — das ist
so ungefähr das Charakteristische an Melchior, der
mit vier Werken vertreten ist, unter denen neben
der „badenden Venus“ besonders die Gruppe
„Venus und Amor“ (Taf. 66) hervorragt.
Eine ganz andere Kunst ist es, die uns in der
englischen Malerei und in den dort blühenden
graphischen Künsten des 18. Jahrhunderts entgegen-
tritt. „Aus der schwülen Atmosphäre eines Salons
tritt man hinaus in eine freie Parknatur.“ Das
18. Jahrhundert hat man nicht mit Unrecht das
Zeitalter der Frau genannt. Nie konnte man
berechtigter fragen, oü est la femme? als in den
galantesten Zeiten des Rokoko, wo hinter jeder
Staatsaktion, hinter jeder politischen Intrigue und
hinter jedem Kunstwerk die Frau steckte. Auch
England steht unter dem Zeichen der Frau, aber
jene Frauen, die Reynolds, Romney, Gainsborough
malten, bedeuten einen neuen Typus, sie haben
eine moderne Nuance. Nicht mehr das „Marquisen-
porträt“, sondern, wie es sich für das freie England
geziemt, das Bild gesunder Damen aus den oberen
Schichten des Bürgertums. Das soll nicht heissen,
dass die Aristokratie in dieser englischen Bildnis-
kunst keine Rolle mehr gespielt hätte, aber sie
hatte aufgehört, das A und das 0 aller Porträt-
malerei zu sein. Die geistreiche Frau, der das
Leben in der Oeffentlichkeit den Blick geweitet,
die gereiftere, ernste Frau gewinnt mehr und mehr
Boden. Daneben fehlen keineswegs jene schlanken,
zarten Geschöpfe, die uns als der ausgesprochene
englische Rassetypus erscheinen. Scheu und schlank,
ausgesucht zart, voll herber Grazie in der Bewegung
ist Reynolds Diana Coosbie (Taf. 94), pikant, traum-
haft, interessant blass erscheint Thomas Gains-
boroughs Mrs. Grace Dalrymple Eliott.
Es ist ein weiter Schritt vorwärts in der eng-
lischen Malerei von Gainsborough bis zu den
Präraffaeliten, unter denen Millais, dessen „Knight
Errant“ (Taf. 161) ich hier ein wenig ansehen will,
wieder seine ganz eigene Stellung einnimmt. Es
liegt der süsse, stille Traum der Romantik über
dem Bild. Uebernatürlich leuchtet der weisse,
schöne Frauenleib im Mondlicht — es ist der
Kultus des Weibes, dem zu Liebe der Ritter das
Leben wagt, der aus dem technisch ganz unver-
gleichlichen Bilde spricht. So kommt ein neues
Moment in die Malerei herein — die Huldigung
vor dem schönen Weib. Nicht das Verlangen nach
Besitz, das aus den sonnigheissen Bildern der
Renaissance herausgeglüht hat, sondern das stille,
entsagende Schwärmen im bleichen Mondlicht. —
Ich muss nun wieder viele übergehen, von denen
5
Eine italienische Schulung, die dem Florenz
des 17. Jahrhunderts wohl gar nicht so ferne steht,
aber von einem ganz anderen Geist getragen wird
als dieses, lässt sich in dem Bildnis einer jungen
Frau in der Gemäldegalerie zu Wien (Taf. 21), das
einen unbekannten Holländer zum Schöpfer hat,
erkennen. Da ist eine feierliche Pracht, so viel
träumerischer Ernst, so viel anmutige Zartheit
(man sehe nur diese Hände), dass wir wieder
einen wesentlich anderen Typ des schönen Menschen
vor uns haben als bei den Italienern oder Franzosen,
die weniger reale Anschauung besassen als die
Niederländer, aber einen feineren und geläuterteren
Formensinn voraus hatten. Ihre künstlerische Be-
gabung macht sich darum immer gern mit dem
Problem des schönen Frauenleibes zu schaffen.
Der Bildhauer Jean Goujon (1510—1568) war der
Mann, der in seiner berühmten „Diana von
Poitiers“ (Taf. 22) den Idealtypus französischer
Frauenschönheit und Grazie schuf. „Die Körper-
masse sind gestreckt und gezogen bis an die
Grenze der schönen Proportion, die Brüste sitzen
viel zu hoch und man möchte der anmutigen
Jägerin etwas mehr Taille wünschen. Aber eine
schüchterne Zartheit und Feinheit, ein gemessener
höfischer Anstand zeichnen diese liebenswürdig
tändelnde Gruppe aus; der streng geschlossene
Umriss, namentlich aber die resolut durchgeführte
Kontur der rechten Körperseite geben einen Ein-
druck von unvergleichlicher Elastizität.“
Gleichfalls unter dem Namen „Diana von
Poitiers“ (so hiess die einflussreiche Maitresse
Henris II. von Frankreich) geht ein wunderbares
Gemälde eines unbekannten Franzosen vom Jahre
1550 (Galerie zu Versailles — Taf. 27 —). „In
Goujons Diana mit dem Hirsch war es auf eine
schmeichelhafte Anspielung auf die lebende
Namensschwester abgesehen“, nicht um ein
Porträt war es dem Bildhauer zu tun gewesen;
und wir müssen uns auch hier, vor dem Gemälde,
fragen, wie weit die Wahrheit geht, und wo die
Idealisierung oder — Schmeichelei einsetzt. Hier
zeigen sich schon die Ansätze zu jener geistreichen
Pikanterie, welche seitdem den schönen Menschen,
wenn er in französischer Beleuchtung erscheint,
immerfort eignet. „Der verstohlene Blick in intime
Frauengemächer, wo die vornehme Herrin, wohl-
coiffiert und mit zierlichem Spitzenhäubchen, aber
nur mit diesem angetan, im Bade sitzt — das ist
doch schon ganz unverfälschter Esprit.“
Hundert Jahre später als die „Diana“ ist das
Bild der Maria Mancini, der schönen Nichte
Mazarins, der Jugendgeliebten Ludwig XIV., gemalt
(Taf. 43). Pierre Mignard (1612—1695), ein Vor-
läufer Watteaus und Bouchers, hat dieses Bildnis
gemalt. Aus den Augen der schönen Maria, die
ängstlich in die Welt blicken, spricht ein merk-
würdiges Schicksal. Diese symmetrischen, reinen,
klassischen Züge weisen noch nicht die süffisante
Ueberlegenheit, die moralische Nonchalance auf,
die man auf Bildnissen eleganter und graziöser
Rokokomarquisen findet, auch fehlt dem Bilde der
Charm eines Watteau und die kapriziöse Beweglich-
keit eines Boucher, aber dafür breitet sich etwas
darüber aus wie eine feierliche Grandezza, eine
stille Würde, — das ganze ein Spiegelbild höfischen
Ceremoniells im Louis-Quatorze-StiL
Echt Rokoko, wenn auch nicht französisch, so
doch von französischer Grazie sind dagegen die
zierlichen Porzellanfiguren des Höchster Meisters
Johann Peter Melchior (1742—1825). Die glänzende,
schmiegsame Haut, die elegante Schlangenlinie des
Frauenkörpers, die reichen, in einander verschwim-
menden Formen, dazu eine schwebende Leichtig-
keit der Figuren, die einer volleren plastischen
Leiblichkeit durchaus nicht ermangeln, — das ist
so ungefähr das Charakteristische an Melchior, der
mit vier Werken vertreten ist, unter denen neben
der „badenden Venus“ besonders die Gruppe
„Venus und Amor“ (Taf. 66) hervorragt.
Eine ganz andere Kunst ist es, die uns in der
englischen Malerei und in den dort blühenden
graphischen Künsten des 18. Jahrhunderts entgegen-
tritt. „Aus der schwülen Atmosphäre eines Salons
tritt man hinaus in eine freie Parknatur.“ Das
18. Jahrhundert hat man nicht mit Unrecht das
Zeitalter der Frau genannt. Nie konnte man
berechtigter fragen, oü est la femme? als in den
galantesten Zeiten des Rokoko, wo hinter jeder
Staatsaktion, hinter jeder politischen Intrigue und
hinter jedem Kunstwerk die Frau steckte. Auch
England steht unter dem Zeichen der Frau, aber
jene Frauen, die Reynolds, Romney, Gainsborough
malten, bedeuten einen neuen Typus, sie haben
eine moderne Nuance. Nicht mehr das „Marquisen-
porträt“, sondern, wie es sich für das freie England
geziemt, das Bild gesunder Damen aus den oberen
Schichten des Bürgertums. Das soll nicht heissen,
dass die Aristokratie in dieser englischen Bildnis-
kunst keine Rolle mehr gespielt hätte, aber sie
hatte aufgehört, das A und das 0 aller Porträt-
malerei zu sein. Die geistreiche Frau, der das
Leben in der Oeffentlichkeit den Blick geweitet,
die gereiftere, ernste Frau gewinnt mehr und mehr
Boden. Daneben fehlen keineswegs jene schlanken,
zarten Geschöpfe, die uns als der ausgesprochene
englische Rassetypus erscheinen. Scheu und schlank,
ausgesucht zart, voll herber Grazie in der Bewegung
ist Reynolds Diana Coosbie (Taf. 94), pikant, traum-
haft, interessant blass erscheint Thomas Gains-
boroughs Mrs. Grace Dalrymple Eliott.
Es ist ein weiter Schritt vorwärts in der eng-
lischen Malerei von Gainsborough bis zu den
Präraffaeliten, unter denen Millais, dessen „Knight
Errant“ (Taf. 161) ich hier ein wenig ansehen will,
wieder seine ganz eigene Stellung einnimmt. Es
liegt der süsse, stille Traum der Romantik über
dem Bild. Uebernatürlich leuchtet der weisse,
schöne Frauenleib im Mondlicht — es ist der
Kultus des Weibes, dem zu Liebe der Ritter das
Leben wagt, der aus dem technisch ganz unver-
gleichlichen Bilde spricht. So kommt ein neues
Moment in die Malerei herein — die Huldigung
vor dem schönen Weib. Nicht das Verlangen nach
Besitz, das aus den sonnigheissen Bildern der
Renaissance herausgeglüht hat, sondern das stille,
entsagende Schwärmen im bleichen Mondlicht. —
Ich muss nun wieder viele übergehen, von denen
5