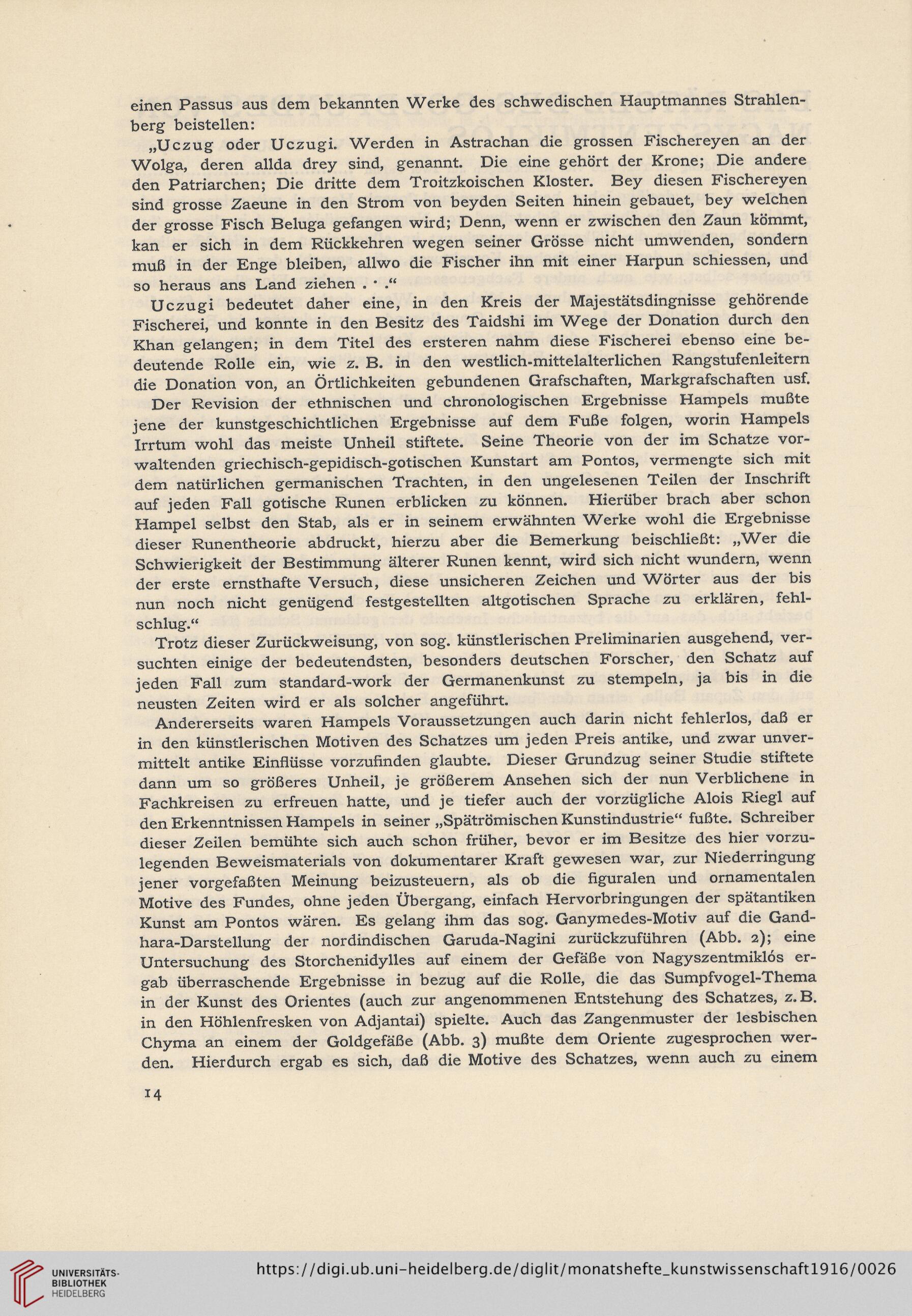einen Passus aus dem bekannten Werke des schwedischen Hauptmannes Strahlen-
berg beistellen:
„Uczug oder Uczugi. Werden in Astrachan die grossen Fischereyen an der
Wolga, deren allda drey sind, genannt. Die eine gehört der Krone; Die andere
den Patriarchen; Die dritte dem Troitzkoischen Kloster. Bey diesen Fischereyen
sind grosse Zaeune in den Strom von beyden Seiten hinein gebauet, bey welchen
der grosse Fisch Beluga gefangen wird; Denn, wenn er zwischen den Zaun kömmt,
kan er sich in dem Rückkehren wegen seiner Grösse nicht umwenden, sondern
muß in der Enge bleiben, allwo die Fischer ihn mit einer Harpun schiessen, und
so heraus ans Land ziehen . · .“
Uczugi bedeutet daher eine, in den Kreis der Majestätsdingnisse gehörende
Fischerei, und konnte in den Besitz des Taidshi im Wege der Donation durch den
Khan gelangen; in dem Titel des ersteren nahm diese Fischerei ebenso eine be-
deutende Rolle ein, wie z. B. in den westlich-mittelalterlichen Rangstufenleitern
die Donation von, an Örtlichkeiten gebundenen Grafschaften, Markgrafschaften usf.
Der Revision der ethnischen und chronologischen Ergebnisse Hampels mußte
jene der kunstgeschichtlichen Ergebnisse auf dem Fuße folgen, worin Hampels
Irrtum wohl das meiste Unheil stiftete. Seine Theorie von der im Schatze vor-
waltenden griechisch-gepidisch-gotischen Kunstart am Pontos, vermengte sich mit
dem natürlichen germanischen Trachten, in den ungelesenen Teilen der Inschrift
auf jeden Fall gotische Runen erblicken zu können. Hierüber brach aber schon
Hampel selbst den Stab, als er in seinem erwähnten Werke wohl die Ergebnisse
dieser Runentheorie abdruckt, hierzu aber die Bemerkung beischließt: „Wer die
Schwierigkeit der Bestimmung älterer Runen kennt, wird sich nicht wundern, wenn
der erste ernsthafte Versuch, diese unsicheren Zeichen und Wörter aus der bis
nun noch nicht genügend festgestellten altgotischen Sprache zu erklären, fehl-
schlug.“
Trotz dieser Zurückweisung, von sog. künstlerischen Preliminarien ausgehend, ver-
suchten einige der bedeutendsten, besonders deutschen Forscher, den Schatz auf
jeden Fall zum standard-work der Germanenkunst zu stempeln, ja bis in die
neusten Zeiten wird er als solcher angeführt.
Andererseits waren Hampels Voraussetzungen auch darin nicht fehlerlos, daß er
in den künstlerischen Motiven des Schatzes um jeden Preis antike, und zwar unver-
mittelt antike Einflüsse vorzufinden glaubte. Dieser Grundzug seiner Studie stiftete
dann um so größeres Unheil, je größerem Ansehen sich der nun Verblichene in
Fachkreisen zu erfreuen hatte, und je tiefer auch der vorzügliche Alois Riegl auf
den Erkenntnissen Hampels in seiner „Spätrömischen Kunstindustrie“ fußte. Schreiber
dieser Zeilen bemühte sich auch schon früher, bevor er im Besitze des hier vorzu-
legenden Beweismaterials von dokumentärer Kraft gewesen war, zur Niederringung
jener vorgefaßten Meinung beizusteuern, als ob die figuralen und ornamentalen
Motive des Fundes, ohne jeden Übergang, einfach Hervorbringungen der spätantiken
Kunst am Pontos wären. Es gelang ihm das sog. Ganymedes-Motiv auf die Gand-
hara-Darstellung der nordindischen Garuda-Nagini zurückzuführen (Abb. 2); eine
Untersuchung des Storchenidylles auf einem der Gefäße von Nagyszentmiklos er-
gab überraschende Ergebnisse in bezug auf die Rolle, die das Sumpfvogel-Thema
in der Kunst des Orientes (auch zur angenommenen Entstehung des Schatzes, z. B.
in den Höhlenfresken von Adjantai) spielte. Auch das Zangenmuster der lesbischen
Chyma an einem der Goldgefäße (Abb. 3) mußte dem Oriente zugesprochen wer-
den. Hierdurch ergab es sich, daß die Motive des Schatzes, wenn auch zu einem
Μ
berg beistellen:
„Uczug oder Uczugi. Werden in Astrachan die grossen Fischereyen an der
Wolga, deren allda drey sind, genannt. Die eine gehört der Krone; Die andere
den Patriarchen; Die dritte dem Troitzkoischen Kloster. Bey diesen Fischereyen
sind grosse Zaeune in den Strom von beyden Seiten hinein gebauet, bey welchen
der grosse Fisch Beluga gefangen wird; Denn, wenn er zwischen den Zaun kömmt,
kan er sich in dem Rückkehren wegen seiner Grösse nicht umwenden, sondern
muß in der Enge bleiben, allwo die Fischer ihn mit einer Harpun schiessen, und
so heraus ans Land ziehen . · .“
Uczugi bedeutet daher eine, in den Kreis der Majestätsdingnisse gehörende
Fischerei, und konnte in den Besitz des Taidshi im Wege der Donation durch den
Khan gelangen; in dem Titel des ersteren nahm diese Fischerei ebenso eine be-
deutende Rolle ein, wie z. B. in den westlich-mittelalterlichen Rangstufenleitern
die Donation von, an Örtlichkeiten gebundenen Grafschaften, Markgrafschaften usf.
Der Revision der ethnischen und chronologischen Ergebnisse Hampels mußte
jene der kunstgeschichtlichen Ergebnisse auf dem Fuße folgen, worin Hampels
Irrtum wohl das meiste Unheil stiftete. Seine Theorie von der im Schatze vor-
waltenden griechisch-gepidisch-gotischen Kunstart am Pontos, vermengte sich mit
dem natürlichen germanischen Trachten, in den ungelesenen Teilen der Inschrift
auf jeden Fall gotische Runen erblicken zu können. Hierüber brach aber schon
Hampel selbst den Stab, als er in seinem erwähnten Werke wohl die Ergebnisse
dieser Runentheorie abdruckt, hierzu aber die Bemerkung beischließt: „Wer die
Schwierigkeit der Bestimmung älterer Runen kennt, wird sich nicht wundern, wenn
der erste ernsthafte Versuch, diese unsicheren Zeichen und Wörter aus der bis
nun noch nicht genügend festgestellten altgotischen Sprache zu erklären, fehl-
schlug.“
Trotz dieser Zurückweisung, von sog. künstlerischen Preliminarien ausgehend, ver-
suchten einige der bedeutendsten, besonders deutschen Forscher, den Schatz auf
jeden Fall zum standard-work der Germanenkunst zu stempeln, ja bis in die
neusten Zeiten wird er als solcher angeführt.
Andererseits waren Hampels Voraussetzungen auch darin nicht fehlerlos, daß er
in den künstlerischen Motiven des Schatzes um jeden Preis antike, und zwar unver-
mittelt antike Einflüsse vorzufinden glaubte. Dieser Grundzug seiner Studie stiftete
dann um so größeres Unheil, je größerem Ansehen sich der nun Verblichene in
Fachkreisen zu erfreuen hatte, und je tiefer auch der vorzügliche Alois Riegl auf
den Erkenntnissen Hampels in seiner „Spätrömischen Kunstindustrie“ fußte. Schreiber
dieser Zeilen bemühte sich auch schon früher, bevor er im Besitze des hier vorzu-
legenden Beweismaterials von dokumentärer Kraft gewesen war, zur Niederringung
jener vorgefaßten Meinung beizusteuern, als ob die figuralen und ornamentalen
Motive des Fundes, ohne jeden Übergang, einfach Hervorbringungen der spätantiken
Kunst am Pontos wären. Es gelang ihm das sog. Ganymedes-Motiv auf die Gand-
hara-Darstellung der nordindischen Garuda-Nagini zurückzuführen (Abb. 2); eine
Untersuchung des Storchenidylles auf einem der Gefäße von Nagyszentmiklos er-
gab überraschende Ergebnisse in bezug auf die Rolle, die das Sumpfvogel-Thema
in der Kunst des Orientes (auch zur angenommenen Entstehung des Schatzes, z. B.
in den Höhlenfresken von Adjantai) spielte. Auch das Zangenmuster der lesbischen
Chyma an einem der Goldgefäße (Abb. 3) mußte dem Oriente zugesprochen wer-
den. Hierdurch ergab es sich, daß die Motive des Schatzes, wenn auch zu einem
Μ