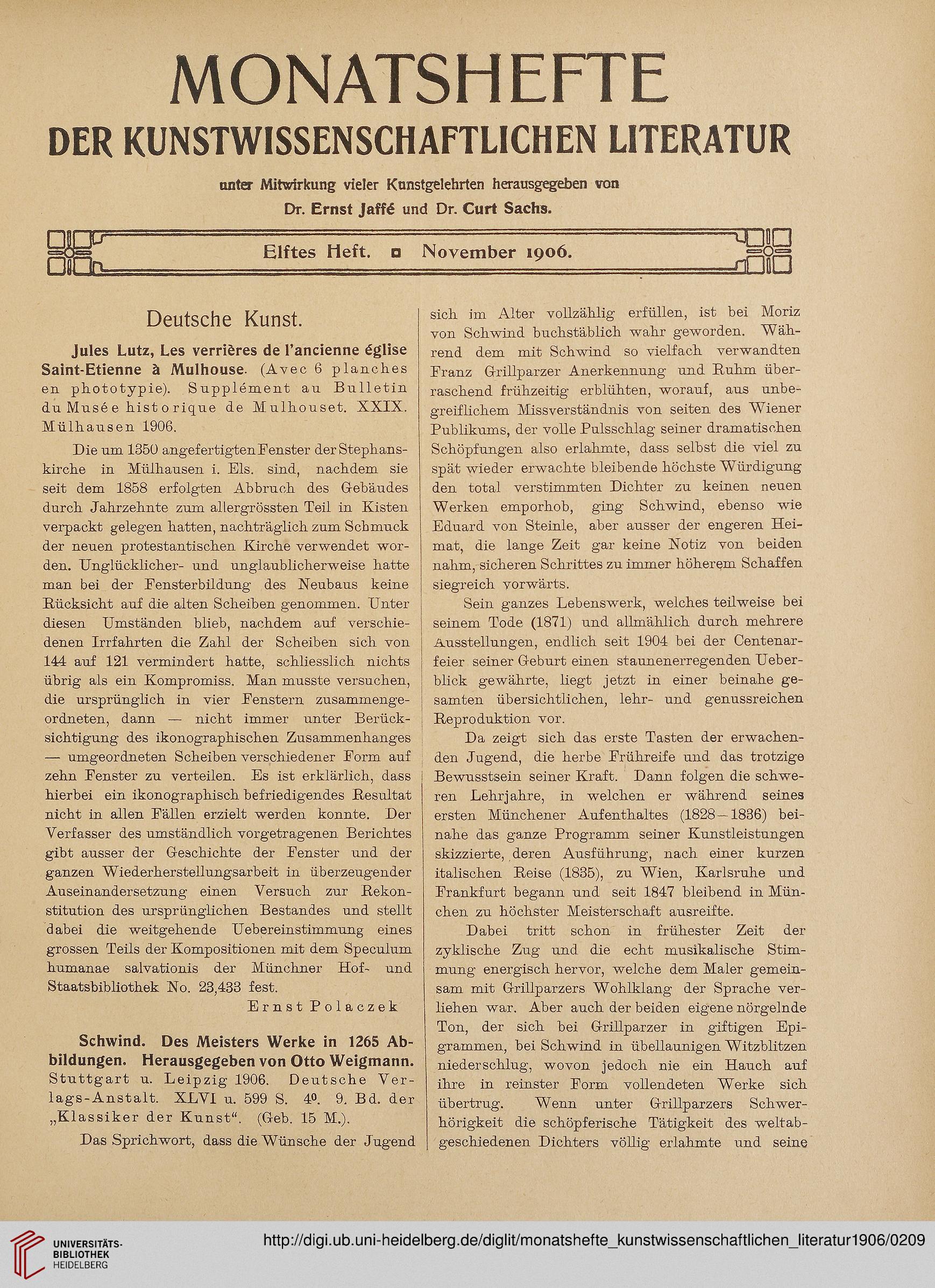MONATSHEFTE
DER KUNSTWISSENSCHAFTLICHEN LITERATUR
unter Mitwirkung vieler Kunstgelehrten herausgegeben von
Dr. Ernst Jaffd und Dr. Curt Sachs.
gy- Elftes Heft. □ November 1906.
nrh-
xqp
£Öfi
Deutsche Kunst.
Jules Lutz, Les verrteres de l’ancienne £glise
Saint-Etienne ä Mulhouse. (Avec 6 planches
en phototypie). Supplement au Bulletin
du Muse e hist o rique de Mulhouset. XXIX.
Mülhausen 1906.
Die um 1350 angefertigten Fenster derStephans-
kirche in Mülhausen i. Els. sind, nachdem sie
seit dem 1858 erfolgten Abbruch des Gebäudes
durch Jahrzehnte zum allergrössten Teil in Kisten
verpackt gelegen hatten, nachträglich zum Schmuck
der neuen protestantischen Kirche verwendet wor-
den. Unglücklicher- und unglaublicherweise hatte
man bei der Fensterbildung des Neubaus keine
Rücksicht auf die alten Scheiben genommen. Unter
diesen Umständen blieb, nachdem auf verschie-
denen Irrfahrten die Zahl der Scheiben sich von
144 auf 121 vermindert hatte, schliesslich nichts
übrig als ein Kompromiss. Man musste versuchen,
die ursprünglich in vier Fenstern zusammenge-
ordneten, dann — nicht immer unter Berück-
sichtigung des ikonographischen Zusammenhanges
— umgeordneten Scheiben verschiedener Form auf
zehn Fenster zu verteilen. Es ist erklärlich, dass i
hierbei ein ikonographisch befriedigendes Resultat
nicht in allen Fällen erzielt werden konnte. Der
Verfasser des umständlich vorgetragenen Berichtes
gibt äusser der Geschichte der Fenster und der
ganzen Wiederherstellungsarbeit in überzeugender
Auseinandersetzung einen Versuch zur Rekon-
stitution des ursprünglichen Bestandes und stellt
dabei die weitgehende Uebereinstimmung eines
grossen Teils der Kompositionen mit dem Speculum
humanae salvationis der Münchner Hof- und
Staatsbibliothek No. 23,433 fest.
Ernst Polaczek
Schwind. Des Meisters Werke in 1265 Ab-
bildungen. Herausgegeben von Otto Weigmann.
Stuttgart u. Leipzig 1906. Deutsche Ver-
lags-Anstalt. XLVI u. 599 S. 4°. 9. Bd. der
„Klassiker der Kunst“. (Geb. 15 M.).
Das Sprichwort, dass die Wünsche der Jugend
sich im Alter vollzählig erfüllen, ist bei Moriz
von Schwind buchstäblich wahr geworden. Wäh-
rend dem mit Schwind so vielfach verwandten
Franz Grillparzer Anerkennung und Ruhm über-
raschend frühzeitig erblühten, worauf, aus unbe-
greiflichem Missverständnis von Seiten des Wiener
Publikums, der volle Pulsschlag seiner dramatischen
Schöpfungen also erlahmte, dass selbst die viel zu
spät wieder erwachte bleibende höchste Würdigung
den total verstimmten Dichtei’ zu keinen neuen
Werken emporhob, ging Schwind, ebenso wie
Eduard von Steinle, aber äusser der engeren Hei-
mat, die lange Zeit gar keine Notiz von beiden
nahm, sicheren Schrittes zu immer höherem Schaffen
siegreich vorwärts.
Sein ganzes Lebenswerk, welches teilweise bei
seinem Tode (1871) und allmählich durch mehrere
Ausstellungen, endlich seit 1904 bei der Centenar-
feier seiner Geburt einen staunenerregenden Ueber-
blick gewährte, liegt jetzt in einer beinahe ge-
samten übersichtlichen, lehr- und genussreichen
Reproduktion vor.
Da zeigt sich das erste Tasten der erwachen-
den Jugend, die herbe Frühreife und das trotzige
Bewusstsein seiner Kraft. Dann folgen die schwe-
ren Lehrjahre, in welchen er während seines
ersten Münchener Aufenthaltes (1828 — 1836) bei-
nahe das ganze Programm seiner Kunstleistungen
skizzierte, deren Ausführung, nach einer kurzen
italischen Reise (1835), zu Wien, Karlsruhe und
Frankfurt begann und seit 1847 bleibend in Mün-
chen zu höchster Meisterschaft ausreifte.
Dabei tritt schon in frühester Zeit der
zyklische Zug und die echt musikalische Stim-
mung energisch hervor, welche dem Maler gemein-
sam mit Grillparzers Wohlklang der Sprache ver-
liehen war. Aber auch der beiden eigene nörgelnde
Ton, der sich bei Grillparzer in giftigen Epi-
grammen, bei Schwind in übellaunigen Witzblitzen
nieder schlug, wovon jedoch nie ein Hauch auf
ihre in reinster Form vollendeten Werke sich
übertrug. Wenn unter Grillparzers Schwer-
hörigkeit die schöpferische Tätigkeit des weltab-
geschiedenen Dichters völlig erlahmte und seine
DER KUNSTWISSENSCHAFTLICHEN LITERATUR
unter Mitwirkung vieler Kunstgelehrten herausgegeben von
Dr. Ernst Jaffd und Dr. Curt Sachs.
gy- Elftes Heft. □ November 1906.
nrh-
xqp
£Öfi
Deutsche Kunst.
Jules Lutz, Les verrteres de l’ancienne £glise
Saint-Etienne ä Mulhouse. (Avec 6 planches
en phototypie). Supplement au Bulletin
du Muse e hist o rique de Mulhouset. XXIX.
Mülhausen 1906.
Die um 1350 angefertigten Fenster derStephans-
kirche in Mülhausen i. Els. sind, nachdem sie
seit dem 1858 erfolgten Abbruch des Gebäudes
durch Jahrzehnte zum allergrössten Teil in Kisten
verpackt gelegen hatten, nachträglich zum Schmuck
der neuen protestantischen Kirche verwendet wor-
den. Unglücklicher- und unglaublicherweise hatte
man bei der Fensterbildung des Neubaus keine
Rücksicht auf die alten Scheiben genommen. Unter
diesen Umständen blieb, nachdem auf verschie-
denen Irrfahrten die Zahl der Scheiben sich von
144 auf 121 vermindert hatte, schliesslich nichts
übrig als ein Kompromiss. Man musste versuchen,
die ursprünglich in vier Fenstern zusammenge-
ordneten, dann — nicht immer unter Berück-
sichtigung des ikonographischen Zusammenhanges
— umgeordneten Scheiben verschiedener Form auf
zehn Fenster zu verteilen. Es ist erklärlich, dass i
hierbei ein ikonographisch befriedigendes Resultat
nicht in allen Fällen erzielt werden konnte. Der
Verfasser des umständlich vorgetragenen Berichtes
gibt äusser der Geschichte der Fenster und der
ganzen Wiederherstellungsarbeit in überzeugender
Auseinandersetzung einen Versuch zur Rekon-
stitution des ursprünglichen Bestandes und stellt
dabei die weitgehende Uebereinstimmung eines
grossen Teils der Kompositionen mit dem Speculum
humanae salvationis der Münchner Hof- und
Staatsbibliothek No. 23,433 fest.
Ernst Polaczek
Schwind. Des Meisters Werke in 1265 Ab-
bildungen. Herausgegeben von Otto Weigmann.
Stuttgart u. Leipzig 1906. Deutsche Ver-
lags-Anstalt. XLVI u. 599 S. 4°. 9. Bd. der
„Klassiker der Kunst“. (Geb. 15 M.).
Das Sprichwort, dass die Wünsche der Jugend
sich im Alter vollzählig erfüllen, ist bei Moriz
von Schwind buchstäblich wahr geworden. Wäh-
rend dem mit Schwind so vielfach verwandten
Franz Grillparzer Anerkennung und Ruhm über-
raschend frühzeitig erblühten, worauf, aus unbe-
greiflichem Missverständnis von Seiten des Wiener
Publikums, der volle Pulsschlag seiner dramatischen
Schöpfungen also erlahmte, dass selbst die viel zu
spät wieder erwachte bleibende höchste Würdigung
den total verstimmten Dichtei’ zu keinen neuen
Werken emporhob, ging Schwind, ebenso wie
Eduard von Steinle, aber äusser der engeren Hei-
mat, die lange Zeit gar keine Notiz von beiden
nahm, sicheren Schrittes zu immer höherem Schaffen
siegreich vorwärts.
Sein ganzes Lebenswerk, welches teilweise bei
seinem Tode (1871) und allmählich durch mehrere
Ausstellungen, endlich seit 1904 bei der Centenar-
feier seiner Geburt einen staunenerregenden Ueber-
blick gewährte, liegt jetzt in einer beinahe ge-
samten übersichtlichen, lehr- und genussreichen
Reproduktion vor.
Da zeigt sich das erste Tasten der erwachen-
den Jugend, die herbe Frühreife und das trotzige
Bewusstsein seiner Kraft. Dann folgen die schwe-
ren Lehrjahre, in welchen er während seines
ersten Münchener Aufenthaltes (1828 — 1836) bei-
nahe das ganze Programm seiner Kunstleistungen
skizzierte, deren Ausführung, nach einer kurzen
italischen Reise (1835), zu Wien, Karlsruhe und
Frankfurt begann und seit 1847 bleibend in Mün-
chen zu höchster Meisterschaft ausreifte.
Dabei tritt schon in frühester Zeit der
zyklische Zug und die echt musikalische Stim-
mung energisch hervor, welche dem Maler gemein-
sam mit Grillparzers Wohlklang der Sprache ver-
liehen war. Aber auch der beiden eigene nörgelnde
Ton, der sich bei Grillparzer in giftigen Epi-
grammen, bei Schwind in übellaunigen Witzblitzen
nieder schlug, wovon jedoch nie ein Hauch auf
ihre in reinster Form vollendeten Werke sich
übertrug. Wenn unter Grillparzers Schwer-
hörigkeit die schöpferische Tätigkeit des weltab-
geschiedenen Dichters völlig erlahmte und seine