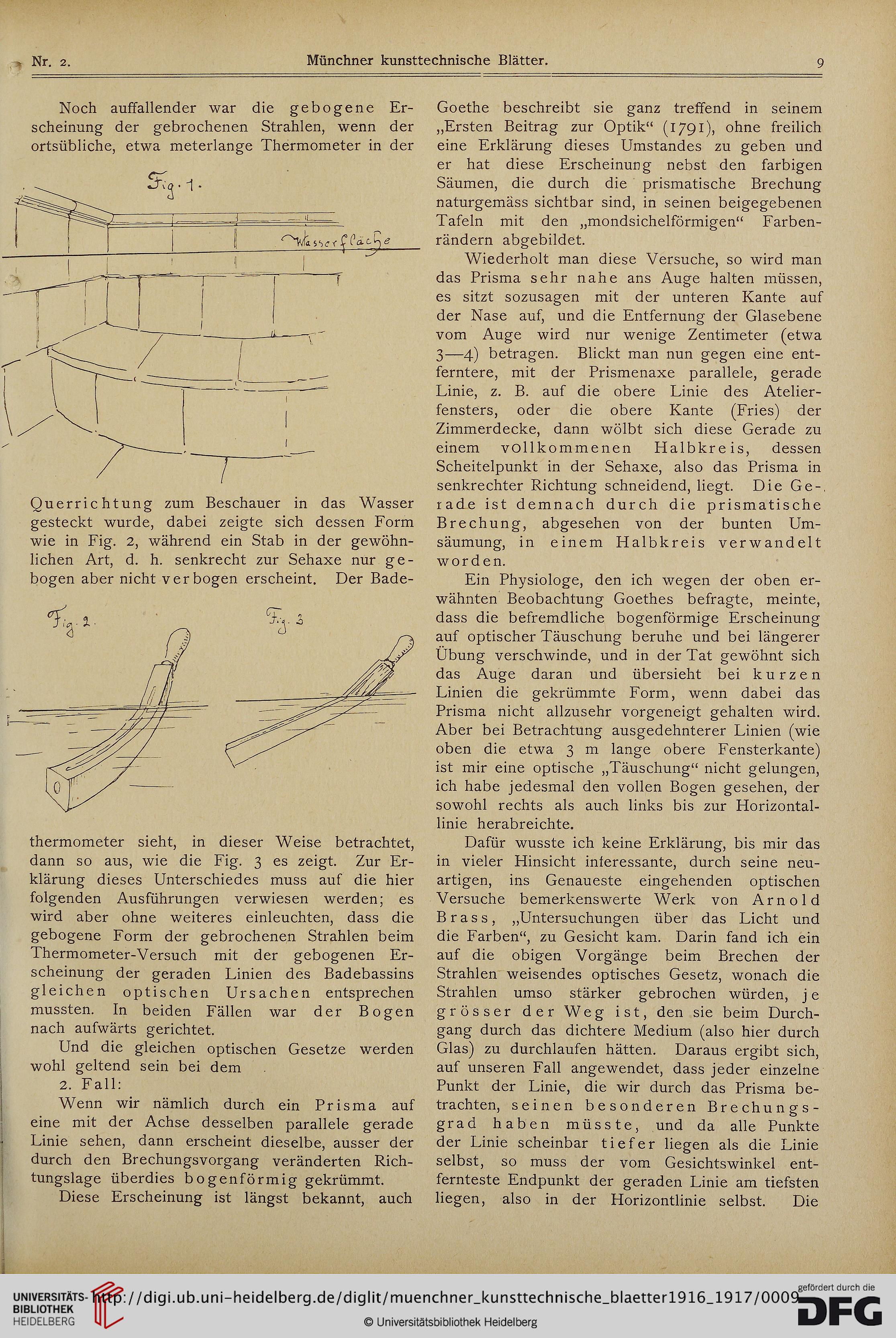'Nr. 2.
Münchner kunsttechnische Blätter.
9
Noch auffallender war die gebogene Er-
scheinung der gebrochenen Strahlen, wenn der
ortsübliche, etwa meterlange Thermometer in der
Querrichtung zum Beschauer in das Wasser
gesteckt wurde, dabei zeigte sich dessen Form
wie in Fig. 2, während ein Stab in der gewöhn-
lichen Art, d. h. senkrecht zur Sehaxe nur ge-
bogen aber nicht verbogen erscheint. Der Bade-
thermometer sieht, in dieser Weise betrachtet,
dann so aus, wie die Fig. ß es zeigt. Zur Er-
klärung dieses Unterschiedes muss auf die hier
folgenden Ausführungen verwiesen werden; es
wird aber ohne weiteres einleuchten, dass die
gebogene Form der gebrochenen Strahlen beim
Thermometer-Versuch mit der gebogenen Er-
scheinung der geraden Linien des Badebassins
gleichen optischen Ursachen entsprechen
mussten. In beiden Fällen war der Bogen
nach aufwärts gerichtet.
Und die gleichen optischen Gesetze werden
wohl geltend sein bei dem
2. Fall:
Wenn wir nämlich durch ein Prisma auf
eine mit der Achse desselben parallele gerade
Linie sehen, dann erscheint dieselbe, ausser der
durch den Brechungsvorgang veränderten Rich-
tungslage überdies bogenförmig gekrümmt.
Diese Erscheinung ist längst bekannt, auch
Goethe beschreibt sie ganz treffend in seinem
„Ersten Beitrag zur Optik" (1791), ohne freilich
eine Erklärung dieses Umstandes zu geben und
er hat diese Erscheinung nebst den farbigen
Säumen, die durch die prismatische Brechung
naturgemäss sichtbar sind, in seinen beigegebenen
Tafeln mit den „mondsichelförmigen" Farben-
rändern abgebildet.
Wiederholt man diese Versuche, so wird man
das Prisma sehr nahe ans Auge halten müssen,
es sitzt sozusagen mit der unteren Kante auf
der Nase auf, und die Entfernung der Glasebene
vom Auge wird nur wenige Zentimeter (etwa
ß-—4) betragen. Blickt man nun gegen eine ent-
ferntere, mit der Prismenaxe parallele, gerade
Linie, z. B. auf die obere Linie des Atelier-
fensters, oder die obere Kante (Fries) der
Zimmerdecke, dann wölbt sich diese Gerade zu
einem vollkommenen Halbkreis, dessen
Scheitelpunkt in der Sehaxe, also das Prisma in
senkrechter Richtung schneidend, liegt. Die Ge-,
rade ist demnach durch die prismatische
Brechung, abgesehen von der bunten Um-
säumung, in einem Halbkreis verwandelt
worden.
Ein Physiologe, den ich wegen der oben er-
wähnten Beobachtung Goethes befragte, meinte,
dass die befremdliche bogenförmige Erscheinung
auf optischer Täuschung beruhe und bei längerer
Übung verschwinde, und in der Tat gewöhnt sich
das Auge daran und übersieht bei kurzen
Linien die gekrümmte Form, wenn dabei das
Prisma nicht allzusehr vorgeneigt gehalten wird.
Aber bei Betrachtung ausgedehnterer Linien (wie
oben die etwa ß m lange obere Fensterkante)
ist mir eine optische „Täuschung" nicht gelungen,
ich habe jedesmal den vollen Bogen gesehen, der
sowohl rechts als auch links bis zur Horizontal-
linie herabreichte.
Dafür wusste ich keine Erklärung, bis mir das
in vieler Hinsicht interessante, durch seine neu-
artigen, ins Genaueste eingehenden optischen
Versuche bemerkenswerte Werk von Arnold
Brass, „Untersuchungen über das Licht und
die Farben", zu Gesicht kam. Darin fand ich ein
auf die obigen Vorgänge beim Brechen der
Strahlen weisendes optisches Gesetz, wonach die
Strahlen umso stärker gebrochen würden, j e
grösser der Weg ist, den sie beim Durch-
gang durch das dichtere Medium (also hier durch
Glas) zu durchlaufen hätten. Daraus ergibt sich,
auf unseren Fall angewendet, dass jeder einzelne
Punkt der Linie, die wir durch das Prisma be-
trachten, seinen besonderen Brechungs-
grad haben müsste, und da alle Punkte
der Linie scheinbar tiefer liegen als die Linie
selbst, so muss der vom Gesichtswinkel ent-
fernteste Endpunkt der geraden Linie am tiefsten
liegen, also in der Horizontlinie selbst. Die
Münchner kunsttechnische Blätter.
9
Noch auffallender war die gebogene Er-
scheinung der gebrochenen Strahlen, wenn der
ortsübliche, etwa meterlange Thermometer in der
Querrichtung zum Beschauer in das Wasser
gesteckt wurde, dabei zeigte sich dessen Form
wie in Fig. 2, während ein Stab in der gewöhn-
lichen Art, d. h. senkrecht zur Sehaxe nur ge-
bogen aber nicht verbogen erscheint. Der Bade-
thermometer sieht, in dieser Weise betrachtet,
dann so aus, wie die Fig. ß es zeigt. Zur Er-
klärung dieses Unterschiedes muss auf die hier
folgenden Ausführungen verwiesen werden; es
wird aber ohne weiteres einleuchten, dass die
gebogene Form der gebrochenen Strahlen beim
Thermometer-Versuch mit der gebogenen Er-
scheinung der geraden Linien des Badebassins
gleichen optischen Ursachen entsprechen
mussten. In beiden Fällen war der Bogen
nach aufwärts gerichtet.
Und die gleichen optischen Gesetze werden
wohl geltend sein bei dem
2. Fall:
Wenn wir nämlich durch ein Prisma auf
eine mit der Achse desselben parallele gerade
Linie sehen, dann erscheint dieselbe, ausser der
durch den Brechungsvorgang veränderten Rich-
tungslage überdies bogenförmig gekrümmt.
Diese Erscheinung ist längst bekannt, auch
Goethe beschreibt sie ganz treffend in seinem
„Ersten Beitrag zur Optik" (1791), ohne freilich
eine Erklärung dieses Umstandes zu geben und
er hat diese Erscheinung nebst den farbigen
Säumen, die durch die prismatische Brechung
naturgemäss sichtbar sind, in seinen beigegebenen
Tafeln mit den „mondsichelförmigen" Farben-
rändern abgebildet.
Wiederholt man diese Versuche, so wird man
das Prisma sehr nahe ans Auge halten müssen,
es sitzt sozusagen mit der unteren Kante auf
der Nase auf, und die Entfernung der Glasebene
vom Auge wird nur wenige Zentimeter (etwa
ß-—4) betragen. Blickt man nun gegen eine ent-
ferntere, mit der Prismenaxe parallele, gerade
Linie, z. B. auf die obere Linie des Atelier-
fensters, oder die obere Kante (Fries) der
Zimmerdecke, dann wölbt sich diese Gerade zu
einem vollkommenen Halbkreis, dessen
Scheitelpunkt in der Sehaxe, also das Prisma in
senkrechter Richtung schneidend, liegt. Die Ge-,
rade ist demnach durch die prismatische
Brechung, abgesehen von der bunten Um-
säumung, in einem Halbkreis verwandelt
worden.
Ein Physiologe, den ich wegen der oben er-
wähnten Beobachtung Goethes befragte, meinte,
dass die befremdliche bogenförmige Erscheinung
auf optischer Täuschung beruhe und bei längerer
Übung verschwinde, und in der Tat gewöhnt sich
das Auge daran und übersieht bei kurzen
Linien die gekrümmte Form, wenn dabei das
Prisma nicht allzusehr vorgeneigt gehalten wird.
Aber bei Betrachtung ausgedehnterer Linien (wie
oben die etwa ß m lange obere Fensterkante)
ist mir eine optische „Täuschung" nicht gelungen,
ich habe jedesmal den vollen Bogen gesehen, der
sowohl rechts als auch links bis zur Horizontal-
linie herabreichte.
Dafür wusste ich keine Erklärung, bis mir das
in vieler Hinsicht interessante, durch seine neu-
artigen, ins Genaueste eingehenden optischen
Versuche bemerkenswerte Werk von Arnold
Brass, „Untersuchungen über das Licht und
die Farben", zu Gesicht kam. Darin fand ich ein
auf die obigen Vorgänge beim Brechen der
Strahlen weisendes optisches Gesetz, wonach die
Strahlen umso stärker gebrochen würden, j e
grösser der Weg ist, den sie beim Durch-
gang durch das dichtere Medium (also hier durch
Glas) zu durchlaufen hätten. Daraus ergibt sich,
auf unseren Fall angewendet, dass jeder einzelne
Punkt der Linie, die wir durch das Prisma be-
trachten, seinen besonderen Brechungs-
grad haben müsste, und da alle Punkte
der Linie scheinbar tiefer liegen als die Linie
selbst, so muss der vom Gesichtswinkel ent-
fernteste Endpunkt der geraden Linie am tiefsten
liegen, also in der Horizontlinie selbst. Die