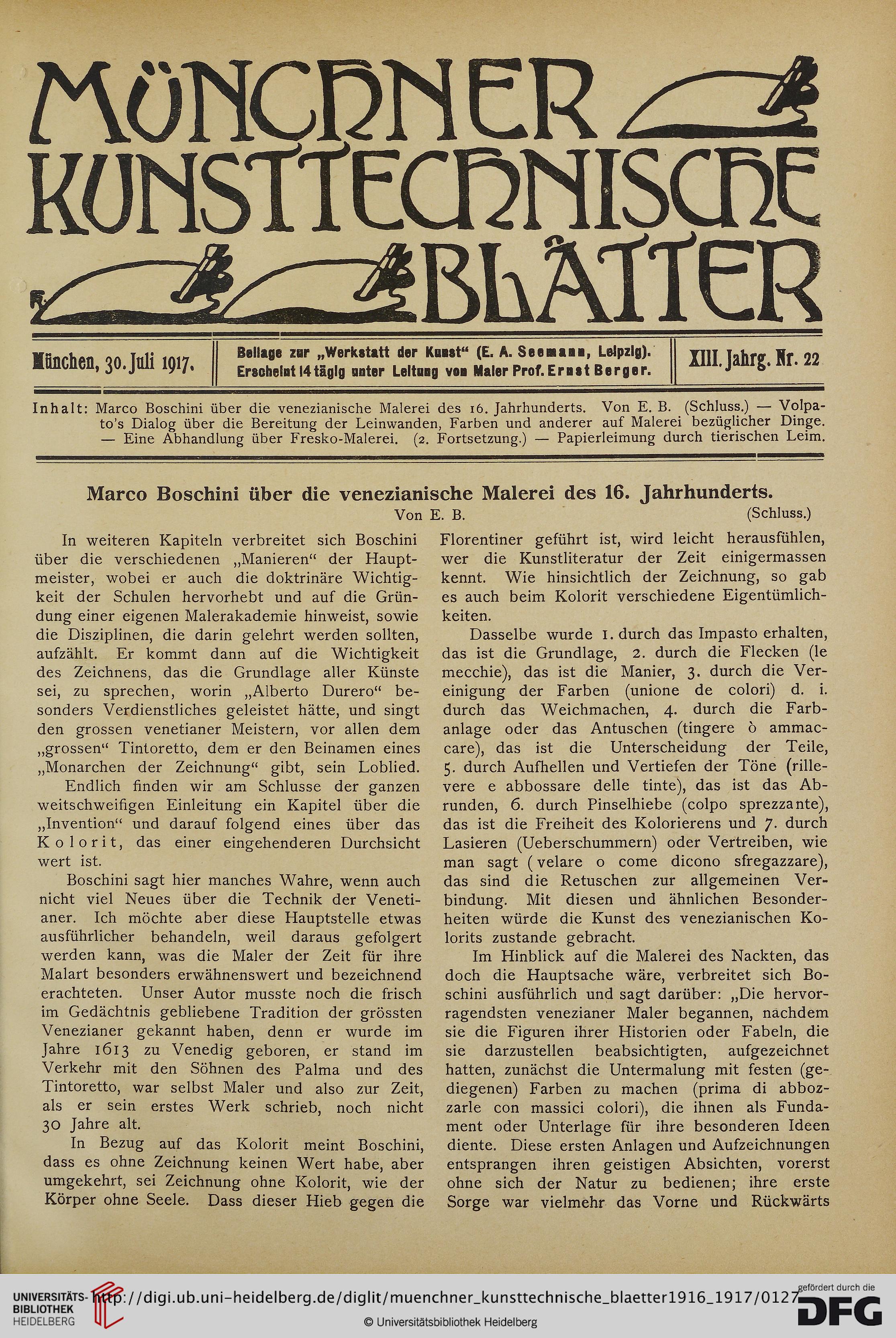Manchen, ßo.Jttli 1917.
BeHtge zar „Werkstatt der Kasst" (E. A. Seeataaa, Leipzig).
Erscheint )4tägig anter Leitaag von Maier Prof. Ernst Berger.
DH.Jahrg. Nr. 22
Inhait: Marco Boschini über die venezianische Malerei des 16. Jahrhunderts. Von E. B. (Schtuss.) — Volpa-
to's Dialog über die Bereitung der Leinwänden, Farben und anderer auf Malerei bezüglicher Dinge.
— Eine Abhandlung über Fresko-Malerei. (2. Fortsetzung.) — Papierleimung durch tierischen Leim.
Marco Boschini über die venezianische Malerei des 16. Jahrhunderts.
Von
In weiteren Kapiteln verbreitet sich Boschini
über die verschiedenen „Manieren" der Haupt-
meister, wobei er auch die doktrinäre Wichtig-
keit der Schulen hervorhebt und auf die Grün-
dung einer eigenen Maierakademie hinweist, sowie
die Disziplinen, die darin geiehrt werden soliten,
aufzähit. Er kommt dann auf die Wichtigkeit
des Zeichnens, das die Grundlage aller Künste
sei, zu sprechen, worin „Alberto Durero" be-
sonders Verdienstliches geleistet hätte, und singt
den grossen venetianer Meistern, vor allen dem
„grossen" Tintoretto, dem er den Beinamen eines
„Monarchen der Zeichnung" gibt, sein Loblied.
Endlich hnden wir am Schlüsse der ganzen
weitschweifigen Einleitung ein Kapitel über die
„Invention" und darauf folgend eines über das
Kolorit, das einer eingehenderen Durchsicht
wert ist.
Boschini sagt hier manches Wahre, wenn auch
nicht viel Neues über die Technik der Veneti-
aner. Ich möchte aber diese Hauptstelle etwas
ausführlicher behandeln, weil daraus gefolgert
werden kann, was die Maler der Zeit für ihre
Malart besonders erwähnenswert und bezeichnend
erachteten. Unser Autor musste noch die frisch
im Gedächtnis gebliebene Tradition der grössten
Venezianer gekannt haben, denn er wurde im
Jahre 1613 zu Venedig geboren, er stand im
Verkehr mit den Söhnen des Palma und des
Tintoretto, war selbst Maler und also zur Zeit,
als er sein erstes Werk schrieb, noch nicht
30 Jahre alt.
In Bezug auf das Kolorit meint Boschini,
dass es ohne Zeichnung keinen Wert habe, aber
umgekehrt, sei Zeichnung ohne Kolorit, wie der
Körper ohne Seele. Dass dieser Hieb gegen die
E. B. (Schluss.)
Florentiner geführt ist, wird leicht herausfühlen,
wer die Kunstliteratur der Zeit einigermassen
kennt. Wie hinsichtlich der Zeichnung, so gab
es auch beim Kolorit verschiedene Eigentümlich-
keiten.
Dasselbe wurde 1. durch das Impasto erhalten,
das ist die Grundlage, 2. durch die Flecken (le
mecchie), das ist die Manier, 3. durch die Ver-
einigung der Farben (unione de colori) d. i.
durch das Weichmachen, 4. durch die Farb-
anlage oder das Antuschen (tingere ö ammac-
care), das ist die Unterscheidung der Teile,
$. durch Aufhellen und Vertiefen der Töne (rille-
vere e abbossare delle tinte), das ist das Ab-
runden, 6. durch Pinselhiebe (colpo sprezzante),
das ist die Freiheit des Kolorierens und 7. durch
Lasieren (Ueberschummern) oder Vertreiben, wie
man sagt (velare o come dicono sfregazzare),
das sind die Retuschen zur allgemeinen Ver-
bindung. Mit diesen und ähnlichen Besonder-
heiten würde die Kunst des venezianischen Ko-
lorits zustande gebracht.
Im Hinblick auf die Malerei des Nackten, das
doch die Hauptsache wäre, verbreitet sich Bo-
schini ausführlich und sagt darüber: „Die hervor-
ragendsten venezianer Maler begannen, nachdem
sie die Figuren ihrer Historien oder Fabeln, die
sie darzustellen beabsichtigten, aufgezeichnet
hatten, zunächst die Untermalung mit festen (ge-
diegenen) Farben zu machen (prima di abboz-
zarle con massici colori), die ihnen als Funda-
ment oder Unterlage für ihre besonderen Ideen
diente. Diese ersten Anlagen und Aufzeichnungen
entsprangen ihren geistigen Absichten, vorerst
ohne sich der Natur zu bedienen; ihre erste
Sorge war vielmehr das Vorne und Rückwärts