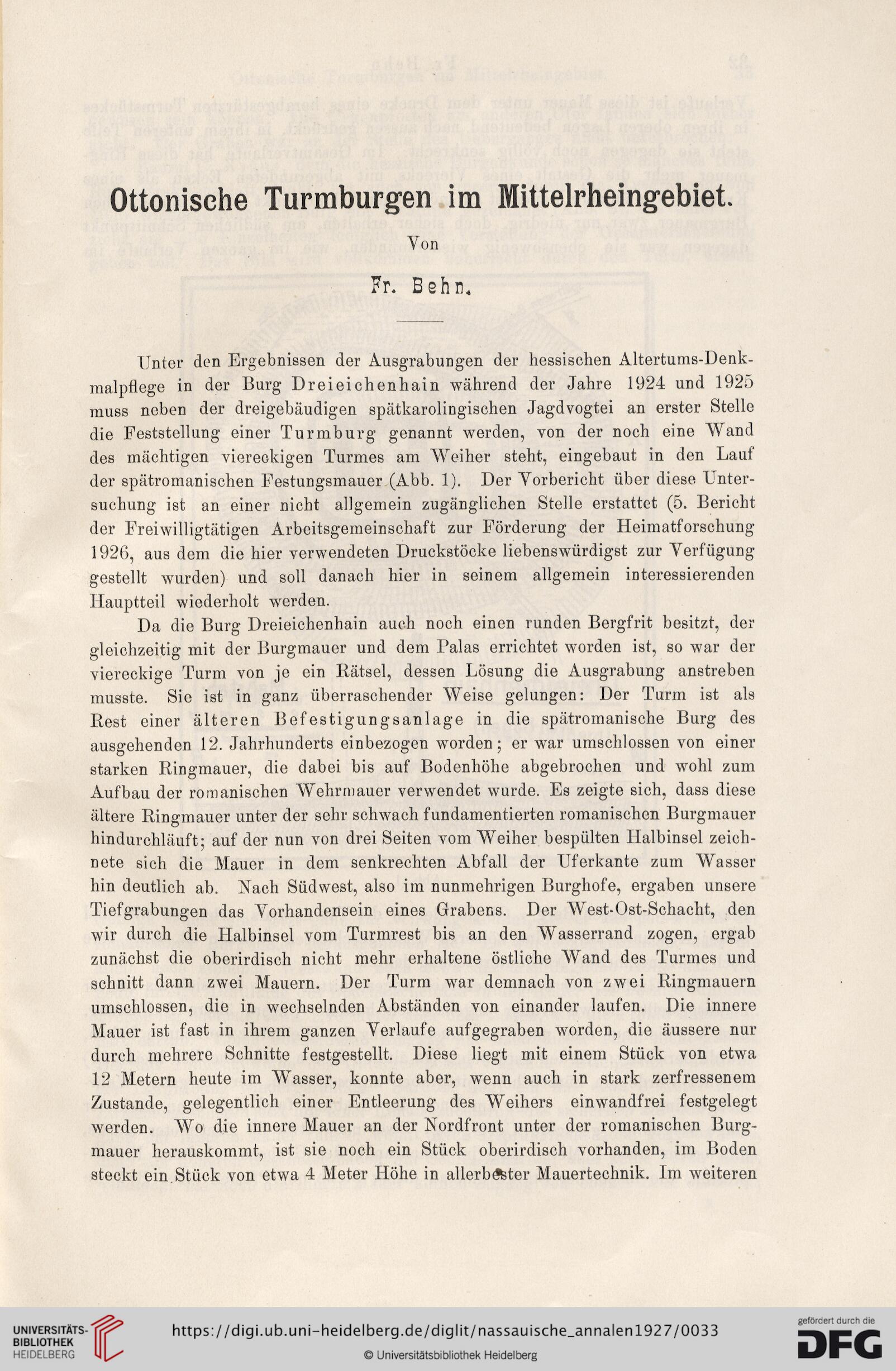Ottonische Turmburgen im Mittelrheingebiet.
Von
Fr. Behn.
Unter den Ergebnissen der Ausgrabungen der hessischen Altertums-Denk-
malpflege in der Burg Dreieichenhain während der Jahre 1924 und 1925
muss neben der dreigebäudigen spätkarolingischen Jagdvogtei an erster Stelle
die Feststellung einer Turmburg genannt werden, von der noch eine Wand
des mächtigen viereckigen Turmes am Weiher steht, eingebaut in den Lauf
der spätromanischen Festungsmauer (Abb. 1). Der Vorbericht über diese Unter-
suchung ist an einer nicht allgemein zugänglichen Stelle erstattet (5. Bericht
der Freiwilligtätigen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Heimatforschung
1926, aus dem die hier verwendeten Druckstöcke liebenswürdigst zur Verfügung
gestellt wurden) und soll danach hier in seinem allgemein interessierenden
Hauptteil wiederholt werden.
Da die Burg Dreieichenhain auch noch einen runden Bergfrit besitzt, der
gleichzeitig mit der Burgmauer und dem Palas errichtet worden ist, so war der
viereckige Turm von je ein Rätsel, dessen Lösung die Ausgrabung anstreben
musste. Sie ist in ganz überraschender Weise gelungen: Der Turm ist als
Rest einer älteren Befestigungsanlage in die spätromanische Burg des
ausgehenden 12. Jahrhunderts einbezogen worden; er war umschlossen von einer
starken Ringmauer, die dabei bis auf Bodenhöhe abgebrochen und wohl zum
Aufbau der romanischen Wehrmauer verwendet wurde. Es zeigte sich, dass diese
ältere Ringmauer unter der sehr schwach fundamentierten romanischen Burgmauer
hindurchläuft; auf der nun von drei Seiten vom Weiher bespülten Halbinsel zeich-
nete sich die Mauer in dem senkrechten Abfall der Uferkante zum Wasser
hin deutlich ab. Nach Südwest, also im nunmehrigen Burghofe, ergaben unsere
Tiefgrabungen das Vorhandensein eines Grabens. Der West-Ost-Schacht, den
wir durch die Halbinsel vom Turmrest bis an den Wasserrand zogen, ergab
zunächst die oberirdisch nicht mehr erhaltene östliche Wand des Turmes und
schnitt dann zwei Mauern. Der Turm war demnach von zwei Ringmauern
umschlossen, die in wechselnden Abständen von einander laufen. Die innere
Mauer ist fast in ihrem ganzen Verlaufe aufgegraben worden, die äussere nur
durch mehrere Schnitte festgestellt. Diese liegt mit einem Stück von etwa
12 Metern heute im Wasser, konnte aber, wenn auch in stark zerfressenem
Zustande, gelegentlich einer Entleerung des Weihers einwandfrei festgelegt
werden. Wo die innere Mauer an der Nordfront unter der romanischen Burg-
mauer herauskommt, ist sie noch ein Stück oberirdisch vorhanden, im Boden
steckt ein Stück von etwa 4 Meter Höhe in allerbester Mauertechnik. Im weiteren
Von
Fr. Behn.
Unter den Ergebnissen der Ausgrabungen der hessischen Altertums-Denk-
malpflege in der Burg Dreieichenhain während der Jahre 1924 und 1925
muss neben der dreigebäudigen spätkarolingischen Jagdvogtei an erster Stelle
die Feststellung einer Turmburg genannt werden, von der noch eine Wand
des mächtigen viereckigen Turmes am Weiher steht, eingebaut in den Lauf
der spätromanischen Festungsmauer (Abb. 1). Der Vorbericht über diese Unter-
suchung ist an einer nicht allgemein zugänglichen Stelle erstattet (5. Bericht
der Freiwilligtätigen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Heimatforschung
1926, aus dem die hier verwendeten Druckstöcke liebenswürdigst zur Verfügung
gestellt wurden) und soll danach hier in seinem allgemein interessierenden
Hauptteil wiederholt werden.
Da die Burg Dreieichenhain auch noch einen runden Bergfrit besitzt, der
gleichzeitig mit der Burgmauer und dem Palas errichtet worden ist, so war der
viereckige Turm von je ein Rätsel, dessen Lösung die Ausgrabung anstreben
musste. Sie ist in ganz überraschender Weise gelungen: Der Turm ist als
Rest einer älteren Befestigungsanlage in die spätromanische Burg des
ausgehenden 12. Jahrhunderts einbezogen worden; er war umschlossen von einer
starken Ringmauer, die dabei bis auf Bodenhöhe abgebrochen und wohl zum
Aufbau der romanischen Wehrmauer verwendet wurde. Es zeigte sich, dass diese
ältere Ringmauer unter der sehr schwach fundamentierten romanischen Burgmauer
hindurchläuft; auf der nun von drei Seiten vom Weiher bespülten Halbinsel zeich-
nete sich die Mauer in dem senkrechten Abfall der Uferkante zum Wasser
hin deutlich ab. Nach Südwest, also im nunmehrigen Burghofe, ergaben unsere
Tiefgrabungen das Vorhandensein eines Grabens. Der West-Ost-Schacht, den
wir durch die Halbinsel vom Turmrest bis an den Wasserrand zogen, ergab
zunächst die oberirdisch nicht mehr erhaltene östliche Wand des Turmes und
schnitt dann zwei Mauern. Der Turm war demnach von zwei Ringmauern
umschlossen, die in wechselnden Abständen von einander laufen. Die innere
Mauer ist fast in ihrem ganzen Verlaufe aufgegraben worden, die äussere nur
durch mehrere Schnitte festgestellt. Diese liegt mit einem Stück von etwa
12 Metern heute im Wasser, konnte aber, wenn auch in stark zerfressenem
Zustande, gelegentlich einer Entleerung des Weihers einwandfrei festgelegt
werden. Wo die innere Mauer an der Nordfront unter der romanischen Burg-
mauer herauskommt, ist sie noch ein Stück oberirdisch vorhanden, im Boden
steckt ein Stück von etwa 4 Meter Höhe in allerbester Mauertechnik. Im weiteren