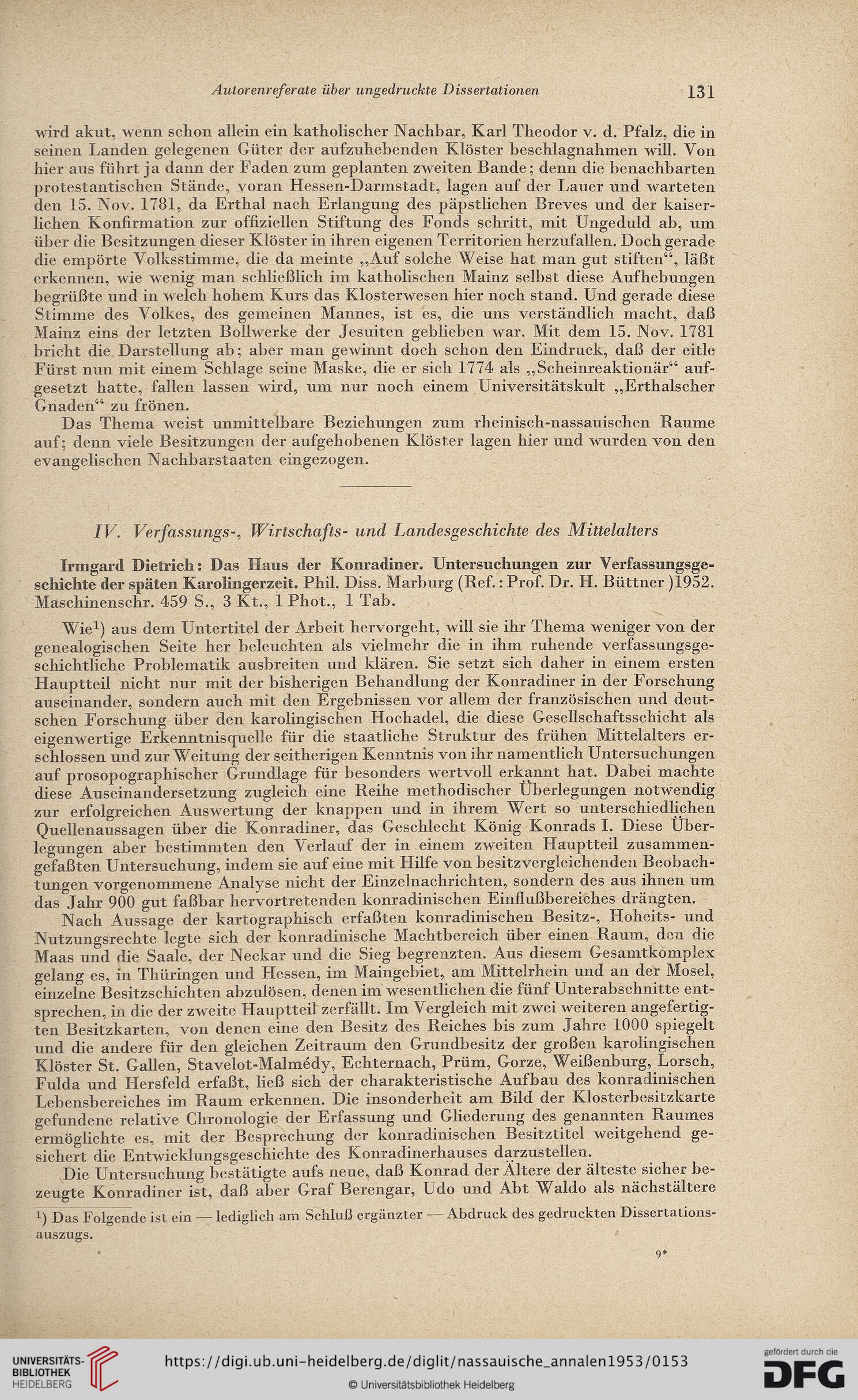Autorenreferate über ungedruckte Dissertationen X31
wird akut, wenn schon allein ein katholischer Nachbar, Karl Theodor v. d. Pfalz, die in
seinen Landen gelegenen Güter der aufzuhebenden Klöster beschlagnahmen will. Von
hier aus führt ja dann der Faden zum geplanten zweiten Bande; denn die benachbarten
protestantischen Stände, voran Hessen-Darmstadt, lagen auf der Lauer und warteten
den 15. Nov. 1781, da Erthal nach Erlangung des päpstlichen Breves und der kaiser-
lichen Konfirmation zur offiziellen Stiftung des Fonds schritt, mit Ungeduld ab, um
über die Besitzungen dieser Klöster in ihren eigenen Territorien herzufallen. Doch gerade
die empörte Volksstimme, die da meinte „Auf solche Weise hat man gut stiften“, läßt
erkennen, wie wenig man schließlich im katholischen Mainz selbst diese Aufhebungen
begrüßte und in welch hohem Kurs das Klosterwesen hier noch stand. Und gerade diese
Stimme des Volkes, des gemeinen Mannes, ist es, die uns verständlich macht, daß
Mainz eins der letzten Bollwerke der Jesuiten geblieben war. Mit dem 15. Nov. 1781
bricht die Darstellung ab; aber man gewinnt doch schon den Eindruck, daß der eitle
Fürst nun mit einem Schlage seine Maske, die er sich 1774 als „Scheinreaktionär“ auf-
gesetzt hatte, fallen lassen wird, um nur noch einem Universitätskult „Erthalscher
Gnaden“ zu frönen.
Das Thema weist unmittelbare Beziehungen zum rheinisch-nassauischen Raume
auf; denn viele Besitzungen der aufgehobenen Klöster lagen hier und wurden von den
evangelischen Nachbarstaaten eingezogen.
IV. Verfassungs-, Wirtschafts- und Landesgeschichte des Mittelalters
Irmgard Dietrich: Das Haus der Konradiner. Untersuchungen zur Verfassungsge-
schichte der späten Karolingerzeit. Phil. Diss. Marburg (Ref.: Prof. Dr. H. Büttner )1952.
Maschinenschr. 459 S„ 3 Kt„ 1 Phot., 1 Tab.
Wie1) aus dem Untertitel der Arbeit hervorgeht, will sie ihr Thema weniger von der
genealogischen Seite her beleuchten als vielmehr die in ihm ruhende verfassungsge-
schichtliche Problematik ausbreiten und klären. Sie setzt sich daher in einem ersten
Hauptteil nicht nur mit der bisherigen Behandlung der Konradiner in der Forschung
auseinander, sondern auch mit den Ergebnissen vor allem der französischen und deut-
schen Forschung über den karolingischen Hochadel, die diese Gesellschaftsschicht als
eigenwertige Erkenntnisquelle für die staatliche Struktur des frühen Mittelalters er-
schlossen und zur Weitung der seitherigen Kenntnis von ihr namentlich Untersuchungen
auf prosopographischer Grundlage für besonders wertvoll erkannt hat. Dabei machte
diese Auseinandersetzung zugleich eine Reihe methodischer Überlegungen notwendig
zur erfolgreichen Auswertung der knappen und in ihrem Wert so unterschiedlichen
Quellenaussagen über die Konradiner, das Geschlecht König Konrads I. Diese Über-
legungen aber bestimmten den Verlauf der in einem zweiten Hauptteil zusammen-
gefaßten Untersuchung, indem sie auf eine mit Hilfe von besitzvergleichenden Beobach-
tungen vorgenommene Analyse nicht der Einzelnachrichten, sondern des aus ihnen um
das Jahr 900 gut faßbar hervortretenden konradinischen Einflußbereiches drängten.
Nach Aussage der kartographisch erfaßten konradinischen Besitz-, Hoheits- und
Nutzungsrechte legte sich der konradinische Machtbereich über einen Raum, den die
Maas und die Saale, der Neckar und die Sieg begrenzten. Aus diesem Gesamtkomplex
gelang es, in Thüringen und Hessen, im Maingebiet, am Mittelrhein und an der Mosel,
einzelne Besitzschichten abzulösen, denen im wesentlichen die fünf Unterabschnitte ent-
sprechen, in die der zweite Hauptteil zerfällt. Im Vergleich mit zwei weiteren angefertig-
ten Besitzkarten, von denen eine den Besitz des Reiches bis zum Jahre 1000 spiegelt
und die andere für den gleichen Zeitraum den Grundbesitz der großen karolingischen
Klöster St. Gallen, Stavelot-Malmedy, Echternach, Prüm, Gorze, Weißenburg, Lorsch,
Fulda und Hersfeld erfaßt, ließ sich der charakteristische Aufbau des konradinischen
Lebensbereiches im Raum erkennen. Die insonderheit am Bild der Klosterbesitzkarte
gefundene relative Chronologie der Erfassung und Gliederung des genannten Raumes
ermöglichte es, mit der Besprechung der konradinischen Besitztitcl weitgehend ge-
sichert die Entwicklungsgeschichte des Konradinerhauses darzustellen.
Die Untersuchung bestätigte aufs neue, daß Konrad der Ältere der älteste sicher be-
zeugte Konradiner ist, daß aber Graf Berengar, Udo und Abt Waldo als nächstältere
*) Das Folgende ist ein — lediglich am Schluß ergänzter — Abdruck des gedruckten Dissertations-
auszugs.
9*
wird akut, wenn schon allein ein katholischer Nachbar, Karl Theodor v. d. Pfalz, die in
seinen Landen gelegenen Güter der aufzuhebenden Klöster beschlagnahmen will. Von
hier aus führt ja dann der Faden zum geplanten zweiten Bande; denn die benachbarten
protestantischen Stände, voran Hessen-Darmstadt, lagen auf der Lauer und warteten
den 15. Nov. 1781, da Erthal nach Erlangung des päpstlichen Breves und der kaiser-
lichen Konfirmation zur offiziellen Stiftung des Fonds schritt, mit Ungeduld ab, um
über die Besitzungen dieser Klöster in ihren eigenen Territorien herzufallen. Doch gerade
die empörte Volksstimme, die da meinte „Auf solche Weise hat man gut stiften“, läßt
erkennen, wie wenig man schließlich im katholischen Mainz selbst diese Aufhebungen
begrüßte und in welch hohem Kurs das Klosterwesen hier noch stand. Und gerade diese
Stimme des Volkes, des gemeinen Mannes, ist es, die uns verständlich macht, daß
Mainz eins der letzten Bollwerke der Jesuiten geblieben war. Mit dem 15. Nov. 1781
bricht die Darstellung ab; aber man gewinnt doch schon den Eindruck, daß der eitle
Fürst nun mit einem Schlage seine Maske, die er sich 1774 als „Scheinreaktionär“ auf-
gesetzt hatte, fallen lassen wird, um nur noch einem Universitätskult „Erthalscher
Gnaden“ zu frönen.
Das Thema weist unmittelbare Beziehungen zum rheinisch-nassauischen Raume
auf; denn viele Besitzungen der aufgehobenen Klöster lagen hier und wurden von den
evangelischen Nachbarstaaten eingezogen.
IV. Verfassungs-, Wirtschafts- und Landesgeschichte des Mittelalters
Irmgard Dietrich: Das Haus der Konradiner. Untersuchungen zur Verfassungsge-
schichte der späten Karolingerzeit. Phil. Diss. Marburg (Ref.: Prof. Dr. H. Büttner )1952.
Maschinenschr. 459 S„ 3 Kt„ 1 Phot., 1 Tab.
Wie1) aus dem Untertitel der Arbeit hervorgeht, will sie ihr Thema weniger von der
genealogischen Seite her beleuchten als vielmehr die in ihm ruhende verfassungsge-
schichtliche Problematik ausbreiten und klären. Sie setzt sich daher in einem ersten
Hauptteil nicht nur mit der bisherigen Behandlung der Konradiner in der Forschung
auseinander, sondern auch mit den Ergebnissen vor allem der französischen und deut-
schen Forschung über den karolingischen Hochadel, die diese Gesellschaftsschicht als
eigenwertige Erkenntnisquelle für die staatliche Struktur des frühen Mittelalters er-
schlossen und zur Weitung der seitherigen Kenntnis von ihr namentlich Untersuchungen
auf prosopographischer Grundlage für besonders wertvoll erkannt hat. Dabei machte
diese Auseinandersetzung zugleich eine Reihe methodischer Überlegungen notwendig
zur erfolgreichen Auswertung der knappen und in ihrem Wert so unterschiedlichen
Quellenaussagen über die Konradiner, das Geschlecht König Konrads I. Diese Über-
legungen aber bestimmten den Verlauf der in einem zweiten Hauptteil zusammen-
gefaßten Untersuchung, indem sie auf eine mit Hilfe von besitzvergleichenden Beobach-
tungen vorgenommene Analyse nicht der Einzelnachrichten, sondern des aus ihnen um
das Jahr 900 gut faßbar hervortretenden konradinischen Einflußbereiches drängten.
Nach Aussage der kartographisch erfaßten konradinischen Besitz-, Hoheits- und
Nutzungsrechte legte sich der konradinische Machtbereich über einen Raum, den die
Maas und die Saale, der Neckar und die Sieg begrenzten. Aus diesem Gesamtkomplex
gelang es, in Thüringen und Hessen, im Maingebiet, am Mittelrhein und an der Mosel,
einzelne Besitzschichten abzulösen, denen im wesentlichen die fünf Unterabschnitte ent-
sprechen, in die der zweite Hauptteil zerfällt. Im Vergleich mit zwei weiteren angefertig-
ten Besitzkarten, von denen eine den Besitz des Reiches bis zum Jahre 1000 spiegelt
und die andere für den gleichen Zeitraum den Grundbesitz der großen karolingischen
Klöster St. Gallen, Stavelot-Malmedy, Echternach, Prüm, Gorze, Weißenburg, Lorsch,
Fulda und Hersfeld erfaßt, ließ sich der charakteristische Aufbau des konradinischen
Lebensbereiches im Raum erkennen. Die insonderheit am Bild der Klosterbesitzkarte
gefundene relative Chronologie der Erfassung und Gliederung des genannten Raumes
ermöglichte es, mit der Besprechung der konradinischen Besitztitcl weitgehend ge-
sichert die Entwicklungsgeschichte des Konradinerhauses darzustellen.
Die Untersuchung bestätigte aufs neue, daß Konrad der Ältere der älteste sicher be-
zeugte Konradiner ist, daß aber Graf Berengar, Udo und Abt Waldo als nächstältere
*) Das Folgende ist ein — lediglich am Schluß ergänzter — Abdruck des gedruckten Dissertations-
auszugs.
9*