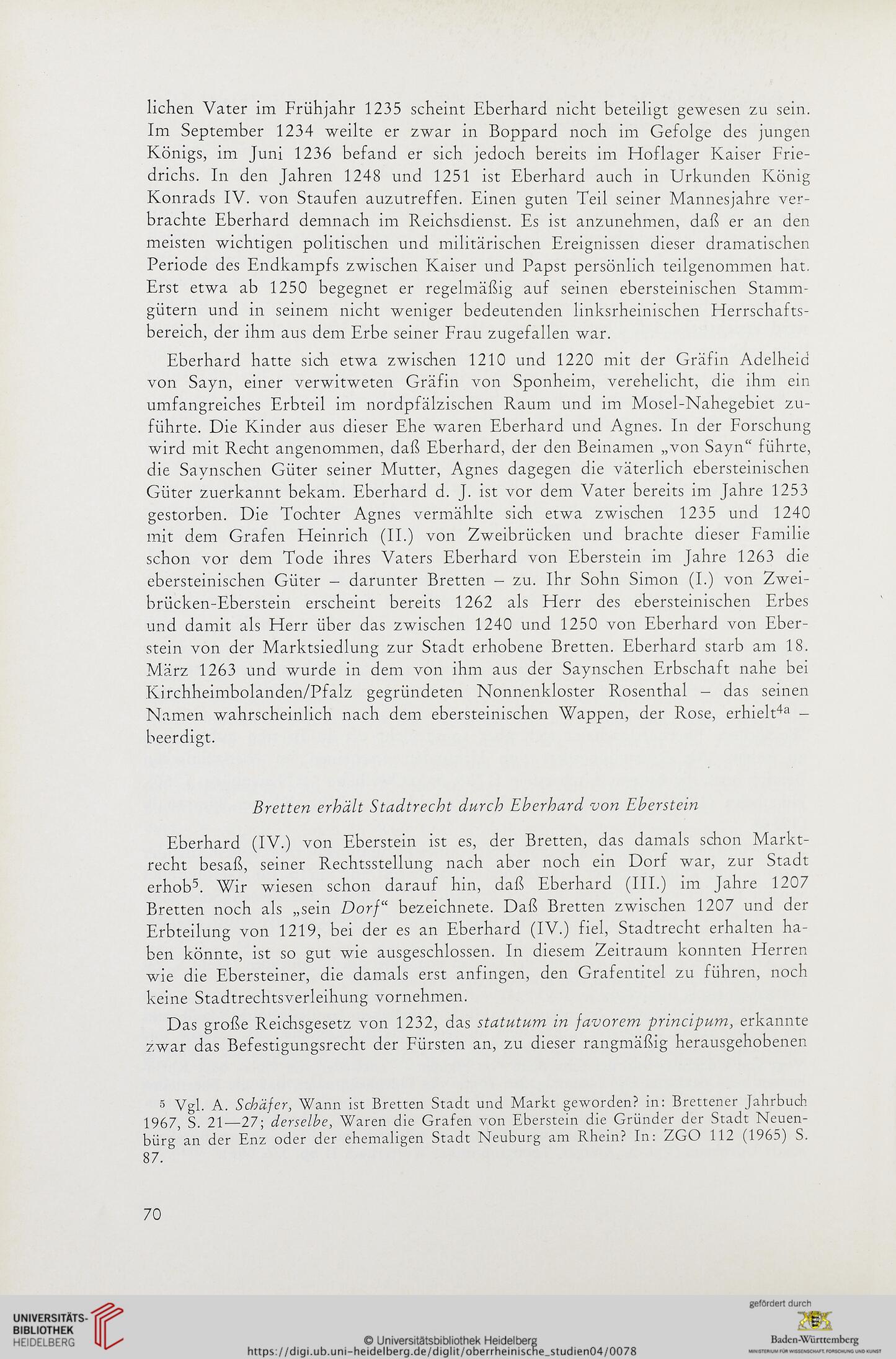liehen Vater im Frühjahr 1235 scheint Eberhard nicht beteiligt gewesen zu sein.
Im September 1234 weilte er zwar in Boppard noch im Gefolge des jungen
Königs, im Juni 1236 befand er sich jedoch bereits im Hoflager Kaiser Frie-
drichs. In den Jahren 1248 und 1251 ist Eberhard auch in Urkunden König
Konrads IV. von Staufen auzutreffen. Einen guten Teil seiner Mannesjahre ver-
brachte Eberhard demnach im Reichsdienst. Es ist anzunehmen, daß er an den
meisten wichtigen politischen und militärischen Ereignissen dieser dramatischen
Periode des Endkampfs zwischen Kaiser und Papst persönlich teilgenommen hat.
Erst etwa ab 1250 begegnet er regelmäßig auf seinen ebersteinischen Stamm-
gütern und in seinem nicht weniger bedeutenden linksrheinischen Herrschafts-
bereich, der ihm aus dem Erbe seiner Frau zugefallen war.
Eberhard hatte sich etwa zwischen 1210 und 1220 mit der Gräfin Adelheid
von Sayn, einer verwitweten Gräfin von Sponheim, verehelicht, die ihm ein
umfangreiches Erbteil im nordpfälzischen Raum und im Mosel-Nahegebiet zu-
führte. Die Kinder aus dieser Ehe waren Eberhard und Agnes. In der Forschung
wird mit Recht angenommen, daß Eberhard, der den Beinamen „von Sayn“ führte,
die Saynschen Güter seiner Mutter, Agnes dagegen die väterlich ebersteinischen
Güter zuerkannt bekam. Eberhard d. J. ist vor dem Vater bereits im Jahre 1253
gestorben. Die Tochter Agnes vermählte sich etwa zwischen 1235 und 1240
mit dem Grafen Heinrich (II.) von Zweibrücken und brachte dieser Familie
schon vor dem Tode ihres Vaters Eberhard von Eberstein im Jahre 1263 die
ebersteinischen Güter - darunter Bretten — zu. Ihr Sohn Simon (I.) von Zwei-
brücken-Eberstein erscheint bereits 1262 als Herr des ebersteinischen Erbes
und damit als Herr über das zwischen 1240 und 1250 von Eberhard von Eber-
stein von der Marktsiedlung zur Stadt erhobene Bretten. Eberhard starb am 18.
März 1263 und wurde in dem von ihm aus der Saynschen Erbschaft nahe bei
Kirchheimbolanden/Pfalz gegründeten Nonnenkloster Rosenthal - das seinen
Namen wahrscheinlich nach dem ebersteinischen Wappen, der Rose, erhielt43 -
beerdigt.
Bretten erhält Stadtrecht durch Eberhard von Eberstein
Eberhard (IV.) von Eberstein ist es, der Bretten, das damals schon Markt-
recht besaß, seiner Rechtsstellung nach aber noch ein Dorf war, zur Stadt
erhob5. Wir wiesen schon darauf hin, daß Eberhard (III.) im Jahre 1207
Bretten noch als „sein Dorf“ bezeichnete. Daß Bretten zwischen 1207 und der
Erbteilung von 1219, bei der es an Eberhard (IV.) fiel, Stadtrecht erhalten ha-
ben könnte, ist so gut wie ausgeschlossen. In diesem Zeitraum konnten Herren
wie die Ebersteiner, die damals erst anfingen, den Grafentitel zu führen, noch
keine Stadtrechtsverleihung vornehmen.
Das große Reichsgesetz von 1232, das statutum in favorem principum, erkannte
zwar das Befestigungsrecht der Fürsten an, zu dieser rangmäßig herausgehobenen
5 Vgl. A. Schäfer, Wann ist Bretten Stadt und Markt geworden? in: Brettener Jahrbuch
1967, S. 21—27; derselbe, Waren die Grafen von Eberstein die Gründer der Stadt Neuen-
bürg an der Enz oder der ehemaligen Stadt Neuburg am Rhein? In: ZGO 112 (1965) S.
87.
70
Im September 1234 weilte er zwar in Boppard noch im Gefolge des jungen
Königs, im Juni 1236 befand er sich jedoch bereits im Hoflager Kaiser Frie-
drichs. In den Jahren 1248 und 1251 ist Eberhard auch in Urkunden König
Konrads IV. von Staufen auzutreffen. Einen guten Teil seiner Mannesjahre ver-
brachte Eberhard demnach im Reichsdienst. Es ist anzunehmen, daß er an den
meisten wichtigen politischen und militärischen Ereignissen dieser dramatischen
Periode des Endkampfs zwischen Kaiser und Papst persönlich teilgenommen hat.
Erst etwa ab 1250 begegnet er regelmäßig auf seinen ebersteinischen Stamm-
gütern und in seinem nicht weniger bedeutenden linksrheinischen Herrschafts-
bereich, der ihm aus dem Erbe seiner Frau zugefallen war.
Eberhard hatte sich etwa zwischen 1210 und 1220 mit der Gräfin Adelheid
von Sayn, einer verwitweten Gräfin von Sponheim, verehelicht, die ihm ein
umfangreiches Erbteil im nordpfälzischen Raum und im Mosel-Nahegebiet zu-
führte. Die Kinder aus dieser Ehe waren Eberhard und Agnes. In der Forschung
wird mit Recht angenommen, daß Eberhard, der den Beinamen „von Sayn“ führte,
die Saynschen Güter seiner Mutter, Agnes dagegen die väterlich ebersteinischen
Güter zuerkannt bekam. Eberhard d. J. ist vor dem Vater bereits im Jahre 1253
gestorben. Die Tochter Agnes vermählte sich etwa zwischen 1235 und 1240
mit dem Grafen Heinrich (II.) von Zweibrücken und brachte dieser Familie
schon vor dem Tode ihres Vaters Eberhard von Eberstein im Jahre 1263 die
ebersteinischen Güter - darunter Bretten — zu. Ihr Sohn Simon (I.) von Zwei-
brücken-Eberstein erscheint bereits 1262 als Herr des ebersteinischen Erbes
und damit als Herr über das zwischen 1240 und 1250 von Eberhard von Eber-
stein von der Marktsiedlung zur Stadt erhobene Bretten. Eberhard starb am 18.
März 1263 und wurde in dem von ihm aus der Saynschen Erbschaft nahe bei
Kirchheimbolanden/Pfalz gegründeten Nonnenkloster Rosenthal - das seinen
Namen wahrscheinlich nach dem ebersteinischen Wappen, der Rose, erhielt43 -
beerdigt.
Bretten erhält Stadtrecht durch Eberhard von Eberstein
Eberhard (IV.) von Eberstein ist es, der Bretten, das damals schon Markt-
recht besaß, seiner Rechtsstellung nach aber noch ein Dorf war, zur Stadt
erhob5. Wir wiesen schon darauf hin, daß Eberhard (III.) im Jahre 1207
Bretten noch als „sein Dorf“ bezeichnete. Daß Bretten zwischen 1207 und der
Erbteilung von 1219, bei der es an Eberhard (IV.) fiel, Stadtrecht erhalten ha-
ben könnte, ist so gut wie ausgeschlossen. In diesem Zeitraum konnten Herren
wie die Ebersteiner, die damals erst anfingen, den Grafentitel zu führen, noch
keine Stadtrechtsverleihung vornehmen.
Das große Reichsgesetz von 1232, das statutum in favorem principum, erkannte
zwar das Befestigungsrecht der Fürsten an, zu dieser rangmäßig herausgehobenen
5 Vgl. A. Schäfer, Wann ist Bretten Stadt und Markt geworden? in: Brettener Jahrbuch
1967, S. 21—27; derselbe, Waren die Grafen von Eberstein die Gründer der Stadt Neuen-
bürg an der Enz oder der ehemaligen Stadt Neuburg am Rhein? In: ZGO 112 (1965) S.
87.
70