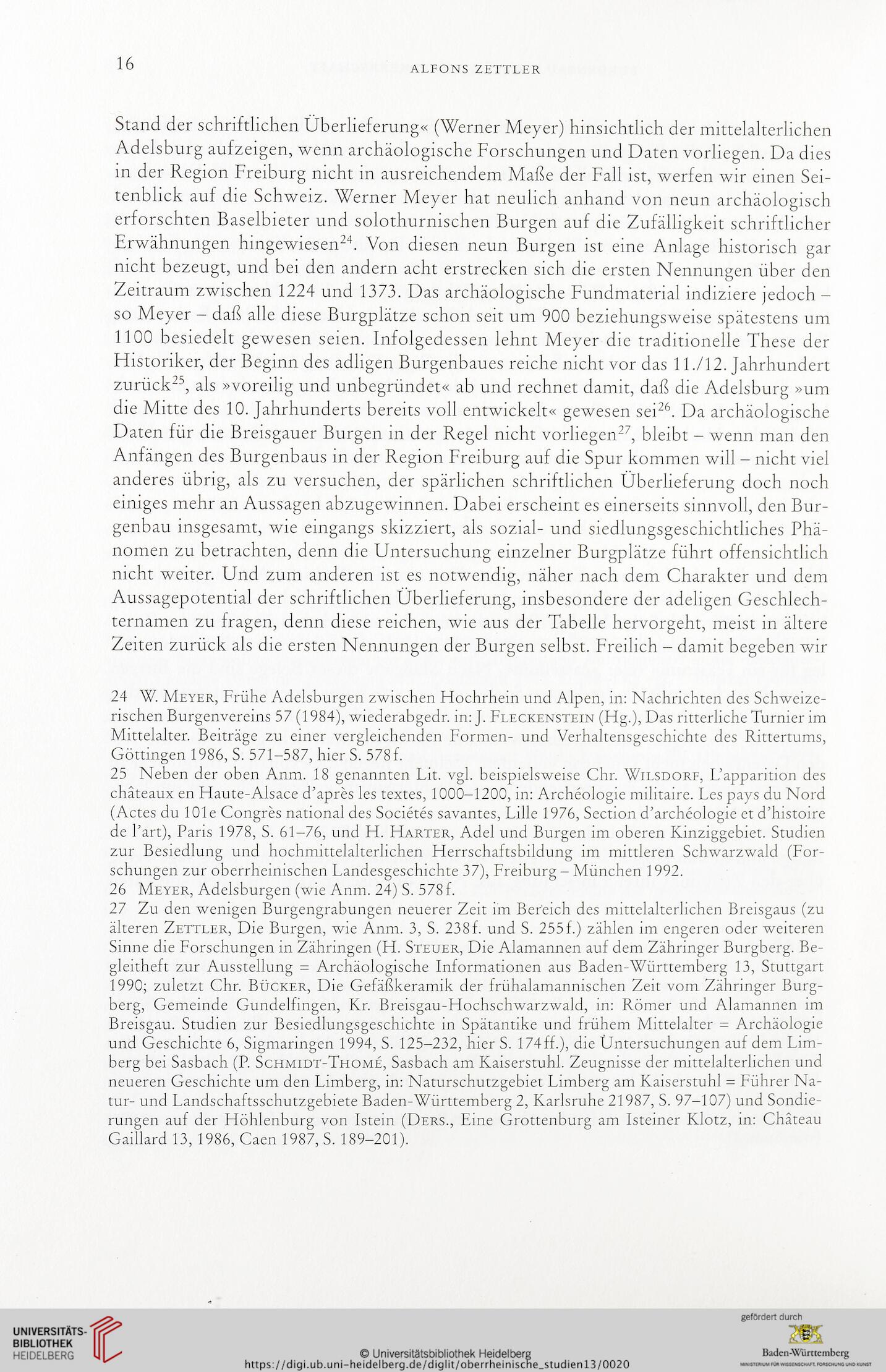16
ALFONS ZETTLER
Stand der schriftlichen Überlieferung« (Werner Meyer) hinsichtlich der mittelalterlichen
Adelsburg aufzeigen, wenn archäologische Forschungen und Daten vorhegen. Da dies
in der Region Freiburg nicht in ausreichendem Maße der Fall ist, werfen wir einen Sei-
tenblick auf die Schweiz. Werner Meyer hat neulich anhand von neun archäologisch
erforschten Baselbieter und solothurnischen Burgen auf die Zufälligkeit schriftlicher
Erwähnungen hingewiesen24. Von diesen neun Burgen ist eine Anlage historisch gar
nicht bezeugt, und bei den andern acht erstrecken sich die ersten Nennungen über den
Zeitraum zwischen 1224 und 1373. Das archäologische Fundmaterial indiziere jedoch -
so Meyer - daß alle diese Burgplätze schon seit um 900 beziehungsweise spätestens um
1100 besiedelt gewesen seien. Infolgedessen lehnt Meyer die traditionelle These der
Historiker, der Beginn des adligen Burgenbaues reiche nicht vor das 11./12. Jahrhundert
zurück25, als »voreilig und unbegründet« ab und rechnet damit, daß die Adelsburg »um
die Mitte des 10. Jahrhunderts bereits voll entwickelt« gewesen sei26. Da archäologische
Daten für die Breisgauer Burgen in der Regel nicht vorliegen27, bleibt - wenn man den
Anfängen des Burgenbaus in der Region Freiburg auf die Spur kommen will - nicht viel
anderes übrig, als zu versuchen, der spärlichen schriftlichen Überlieferung doch noch
einiges mehr an Aussagen abzugewinnen. Dabei erscheint es einerseits sinnvoll, den Bur-
genbau insgesamt, wie eingangs skizziert, als sozial- und siedlungsgeschichtliches Phä-
nomen zu betrachten, denn die Untersuchung einzelner Burgplätze führt offensichtlich
nicht weiter. Und zum anderen ist es notwendig, näher nach dem Charakter und dem
Aussagepotential der schriftlichen Überlieferung, insbesondere der adeligen Geschlech-
ternamen zu fragen, denn diese reichen, wie aus der Tabelle hervorgeht, meist in ältere
Zeiten zurück als die ersten Nennungen der Burgen selbst. Freilich - damit begeben wir
24 W. Meyer, Frühe Adelsburgen zwischen Hochrhein und Alpen, in: Nachrichten des Schweize-
rischen Burgenvereins 57 (1984), wiederabgedr. in: J. Fleckenstein (Hg.), Das ritterliche Turnier im
Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums,
Göttingen 1986, S. 571-587, hier S. 578f.
25 Neben der oben Anm. 18 genannten Lit. vgl. beispielsweise Chr. Wilsdorf, L’appantion des
chäteaux en Haute-Alsace d’apres les textes, 1000-1200, in: Archeologie militaire. Les pays du Nord
(Actes du Wie Congres national des Societes savantes, Lille 1976, Section d’archeologie et d’histoire
de l’art), Paris 1978, S. 61-76, und H. Harter, Adel und Burgen im oberen Kinziggebiet. Studien
zur Besiedlung und hochmittelalterlichen Herrschaftsbildung im mittleren Schwarzwald (For-
schungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 37), Freiburg-München 1992.
26 Meyer, Adelsburgen (wie Anm. 24) S. 578 f.
27 Zu den wenigen Burgengrabungen neuerer Zeit im Bereich des mittelalterlichen Breisgaus (zu
älteren Zettler, Die Burgen, wie Anm. 3, S. 238f. und S. 255f.) zählen im engeren oder weiteren
Sinne die Forschungen in Zähringen (H. Steuer, Die Alamannen auf dem Zähringer Burgberg. Be-
gleitheft zur Ausstellung = Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 13, Stuttgart
1990; zuletzt Chr. Böcker, Die Gefäßkeramik der frühalamannischen Zeit vom Zähringer Burg-
berg, Gemeinde Gundelfingen, Kr. Breisgau-Hochschwarzwald, in: Römer und Alamannen im
Breisgau. Studien zur Besiedlungsgeschichte in Spätantike und frühem Mittelalter = Archäologie
und Geschichte 6, Sigmaringen 1994, S. 125—232, hier S. 174ff.), die Untersuchungen auf dem Lim-
berg bei Sasbach (P. Schmidt-Thome, Sasbach am Kaiserstuhl. Zeugnisse der mittelalterlichen und
neueren Geschichte um den Limberg, in: Naturschutzgebiet Limberg am Kaiserstuhl = Führer Na-
tur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg 2, Karlsruhe 21987, S. 97-107) und Sondie-
rungen auf der Höhlenburg von Istein (Ders., Eine Grottenburg am Isteiner Klotz, in: Chateau
Gaillard 13, 1986, Caen 1987, S. 189-201).
ALFONS ZETTLER
Stand der schriftlichen Überlieferung« (Werner Meyer) hinsichtlich der mittelalterlichen
Adelsburg aufzeigen, wenn archäologische Forschungen und Daten vorhegen. Da dies
in der Region Freiburg nicht in ausreichendem Maße der Fall ist, werfen wir einen Sei-
tenblick auf die Schweiz. Werner Meyer hat neulich anhand von neun archäologisch
erforschten Baselbieter und solothurnischen Burgen auf die Zufälligkeit schriftlicher
Erwähnungen hingewiesen24. Von diesen neun Burgen ist eine Anlage historisch gar
nicht bezeugt, und bei den andern acht erstrecken sich die ersten Nennungen über den
Zeitraum zwischen 1224 und 1373. Das archäologische Fundmaterial indiziere jedoch -
so Meyer - daß alle diese Burgplätze schon seit um 900 beziehungsweise spätestens um
1100 besiedelt gewesen seien. Infolgedessen lehnt Meyer die traditionelle These der
Historiker, der Beginn des adligen Burgenbaues reiche nicht vor das 11./12. Jahrhundert
zurück25, als »voreilig und unbegründet« ab und rechnet damit, daß die Adelsburg »um
die Mitte des 10. Jahrhunderts bereits voll entwickelt« gewesen sei26. Da archäologische
Daten für die Breisgauer Burgen in der Regel nicht vorliegen27, bleibt - wenn man den
Anfängen des Burgenbaus in der Region Freiburg auf die Spur kommen will - nicht viel
anderes übrig, als zu versuchen, der spärlichen schriftlichen Überlieferung doch noch
einiges mehr an Aussagen abzugewinnen. Dabei erscheint es einerseits sinnvoll, den Bur-
genbau insgesamt, wie eingangs skizziert, als sozial- und siedlungsgeschichtliches Phä-
nomen zu betrachten, denn die Untersuchung einzelner Burgplätze führt offensichtlich
nicht weiter. Und zum anderen ist es notwendig, näher nach dem Charakter und dem
Aussagepotential der schriftlichen Überlieferung, insbesondere der adeligen Geschlech-
ternamen zu fragen, denn diese reichen, wie aus der Tabelle hervorgeht, meist in ältere
Zeiten zurück als die ersten Nennungen der Burgen selbst. Freilich - damit begeben wir
24 W. Meyer, Frühe Adelsburgen zwischen Hochrhein und Alpen, in: Nachrichten des Schweize-
rischen Burgenvereins 57 (1984), wiederabgedr. in: J. Fleckenstein (Hg.), Das ritterliche Turnier im
Mittelalter. Beiträge zu einer vergleichenden Formen- und Verhaltensgeschichte des Rittertums,
Göttingen 1986, S. 571-587, hier S. 578f.
25 Neben der oben Anm. 18 genannten Lit. vgl. beispielsweise Chr. Wilsdorf, L’appantion des
chäteaux en Haute-Alsace d’apres les textes, 1000-1200, in: Archeologie militaire. Les pays du Nord
(Actes du Wie Congres national des Societes savantes, Lille 1976, Section d’archeologie et d’histoire
de l’art), Paris 1978, S. 61-76, und H. Harter, Adel und Burgen im oberen Kinziggebiet. Studien
zur Besiedlung und hochmittelalterlichen Herrschaftsbildung im mittleren Schwarzwald (For-
schungen zur oberrheinischen Landesgeschichte 37), Freiburg-München 1992.
26 Meyer, Adelsburgen (wie Anm. 24) S. 578 f.
27 Zu den wenigen Burgengrabungen neuerer Zeit im Bereich des mittelalterlichen Breisgaus (zu
älteren Zettler, Die Burgen, wie Anm. 3, S. 238f. und S. 255f.) zählen im engeren oder weiteren
Sinne die Forschungen in Zähringen (H. Steuer, Die Alamannen auf dem Zähringer Burgberg. Be-
gleitheft zur Ausstellung = Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 13, Stuttgart
1990; zuletzt Chr. Böcker, Die Gefäßkeramik der frühalamannischen Zeit vom Zähringer Burg-
berg, Gemeinde Gundelfingen, Kr. Breisgau-Hochschwarzwald, in: Römer und Alamannen im
Breisgau. Studien zur Besiedlungsgeschichte in Spätantike und frühem Mittelalter = Archäologie
und Geschichte 6, Sigmaringen 1994, S. 125—232, hier S. 174ff.), die Untersuchungen auf dem Lim-
berg bei Sasbach (P. Schmidt-Thome, Sasbach am Kaiserstuhl. Zeugnisse der mittelalterlichen und
neueren Geschichte um den Limberg, in: Naturschutzgebiet Limberg am Kaiserstuhl = Führer Na-
tur- und Landschaftsschutzgebiete Baden-Württemberg 2, Karlsruhe 21987, S. 97-107) und Sondie-
rungen auf der Höhlenburg von Istein (Ders., Eine Grottenburg am Isteiner Klotz, in: Chateau
Gaillard 13, 1986, Caen 1987, S. 189-201).