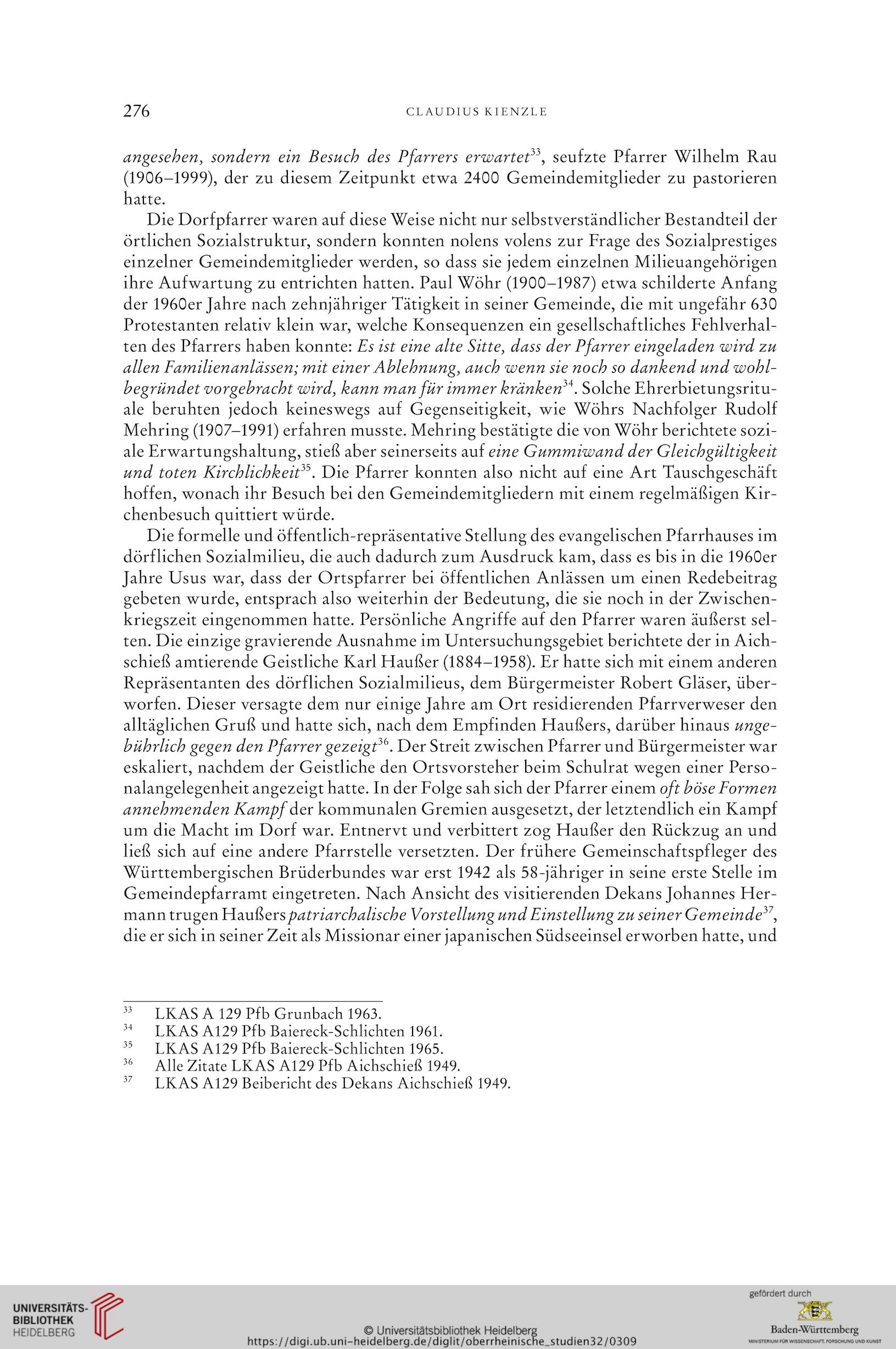CLAUDIUS KIENZLE
276
angesehen, sondern ein Besuch des Pfarrers erwartet33 34 35, seufzte Pfarrer Wilhelm Rau
(1906-1999), der zu diesem Zeitpunkt etwa 2400 Gemeindemitglieder zu pastorieren
hatte.
Die Dorfpfarrer waren auf diese Weise nicht nur selbstverständlicher Bestandteil der
örtlichen Sozialstruktur, sondern konnten nolens volens zur Frage des Sozialprestiges
einzelner Gemeindemitglieder werden, so dass sie jedem einzelnen Milieuangehörigen
ihre Aufwartung zu entrichten hatten. Paul Wöhr (1900-1987) etwa schilderte Anfang
der 1960er Jahre nach zehnjähriger Tätigkeit in seiner Gemeinde, die mit ungefähr 630
Protestanten relativ klein war, welche Konsequenzen ein gesellschaftliches Fehlverhal-
ten des Pfarrers haben konnte: Es ist eine alte Sitte, dass der Pfarrer eingeladen wird zu
allen Familienanlässen; mit einer Ablehnung, auch wenn sie noch so dankend und wohl-
begründet vorgebracht wird, kann man für immer kränken3'1’. Solche Ehrerbietungsritu-
ale beruhten jedoch keineswegs auf Gegenseitigkeit, wie Wöhrs Nachfolger Rudolf
Mehring (1907-1991) erfahren musste. Mehring bestätigte die von Wöhr berichtete sozi-
ale Erwartungshaltung, stieß aber seinerseits auf eine Gummiwand der Gleichgültigkeit
und toten Kirchlichkeit33. Die Pfarrer konnten also nicht auf eine Art Tauschgeschäft
hoffen, wonach ihr Besuch bei den Gemeindemitgliedern mit einem regelmäßigen Kir-
chenbesuch quittiert würde.
Die formelle und öffentlich-repräsentative Stellung des evangelischen Pfarrhauses im
dörflichen Sozialmilieu, die auch dadurch zum Ausdruck kam, dass es bis in die 1960er
Jahre Usus war, dass der Ortspfarrer bei öffentlichen Anlässen um einen Redebeitrag
gebeten wurde, entsprach also weiterhin der Bedeutung, die sie noch in der Zwischen-
kriegszeit eingenommen hatte. Persönliche Angriffe auf den Pfarrer waren äußerst sel-
ten. Die einzige gravierende Ausnahme im Untersuchungsgebiet berichtete der in Aich-
schieß amtierende Geistliche Karl Haußer (1884-1958). Er hatte sich mit einem anderen
Repräsentanten des dörflichen Sozialmilieus, dem Bürgermeister Robert Gläser, über-
worfen. Dieser versagte dem nur einige Jahre am Ort residierenden Pfarrverweser den
alltäglichen Gruß und hatte sich, nach dem Empfinden Haußers, darüber hinaus unge-
bührlich gegen den Pfarrer gezeigt36. Der Streit zwischen Pfarrer und Bürgermeister war
eskaliert, nachdem der Geistliche den Ortsvorsteher beim Schulrat wegen einer Perso-
nalangelegenheit angezeigt hatte. In der Folge sah sich der Pfarrer einem oft böse Formen
annehmenden Kampf der kommunalen Gremien ausgesetzt, der letztendlich ein Kampf
um die Macht im Dorf war. Entnervt und verbittert zog Haußer den Rückzug an und
ließ sich auf eine andere Pfarrstelle versetzten. Der frühere Gemeinschaftspfleger des
Württembergischen Brüderbundes war erst 1942 als 58-jähriger in seine erste Stelle im
Gemeindepfarramt eingetreten. Nach Ansicht des visitierenden Dekans Johannes Her-
mann trugen Haußerspatriarchalische Vorstellung und Einstellung zu seiner Gemeinde37,
die er sich in seiner Zeit als Missionar einer japanischen Südseeinsel erworben hatte, und
33 LKAS A 129 Pfb Grünbach 1963.
34 LKAS A129 Pfb Baiereck-Schlichten 1961.
35 LKAS A129 Pfb Baiereck-Schlichten 1965.
36 Alle Zitate LKAS A129 Pfb Aichschieß 1949.
37 LKAS A129 Beibericht des Dekans Aichschieß 1949.
276
angesehen, sondern ein Besuch des Pfarrers erwartet33 34 35, seufzte Pfarrer Wilhelm Rau
(1906-1999), der zu diesem Zeitpunkt etwa 2400 Gemeindemitglieder zu pastorieren
hatte.
Die Dorfpfarrer waren auf diese Weise nicht nur selbstverständlicher Bestandteil der
örtlichen Sozialstruktur, sondern konnten nolens volens zur Frage des Sozialprestiges
einzelner Gemeindemitglieder werden, so dass sie jedem einzelnen Milieuangehörigen
ihre Aufwartung zu entrichten hatten. Paul Wöhr (1900-1987) etwa schilderte Anfang
der 1960er Jahre nach zehnjähriger Tätigkeit in seiner Gemeinde, die mit ungefähr 630
Protestanten relativ klein war, welche Konsequenzen ein gesellschaftliches Fehlverhal-
ten des Pfarrers haben konnte: Es ist eine alte Sitte, dass der Pfarrer eingeladen wird zu
allen Familienanlässen; mit einer Ablehnung, auch wenn sie noch so dankend und wohl-
begründet vorgebracht wird, kann man für immer kränken3'1’. Solche Ehrerbietungsritu-
ale beruhten jedoch keineswegs auf Gegenseitigkeit, wie Wöhrs Nachfolger Rudolf
Mehring (1907-1991) erfahren musste. Mehring bestätigte die von Wöhr berichtete sozi-
ale Erwartungshaltung, stieß aber seinerseits auf eine Gummiwand der Gleichgültigkeit
und toten Kirchlichkeit33. Die Pfarrer konnten also nicht auf eine Art Tauschgeschäft
hoffen, wonach ihr Besuch bei den Gemeindemitgliedern mit einem regelmäßigen Kir-
chenbesuch quittiert würde.
Die formelle und öffentlich-repräsentative Stellung des evangelischen Pfarrhauses im
dörflichen Sozialmilieu, die auch dadurch zum Ausdruck kam, dass es bis in die 1960er
Jahre Usus war, dass der Ortspfarrer bei öffentlichen Anlässen um einen Redebeitrag
gebeten wurde, entsprach also weiterhin der Bedeutung, die sie noch in der Zwischen-
kriegszeit eingenommen hatte. Persönliche Angriffe auf den Pfarrer waren äußerst sel-
ten. Die einzige gravierende Ausnahme im Untersuchungsgebiet berichtete der in Aich-
schieß amtierende Geistliche Karl Haußer (1884-1958). Er hatte sich mit einem anderen
Repräsentanten des dörflichen Sozialmilieus, dem Bürgermeister Robert Gläser, über-
worfen. Dieser versagte dem nur einige Jahre am Ort residierenden Pfarrverweser den
alltäglichen Gruß und hatte sich, nach dem Empfinden Haußers, darüber hinaus unge-
bührlich gegen den Pfarrer gezeigt36. Der Streit zwischen Pfarrer und Bürgermeister war
eskaliert, nachdem der Geistliche den Ortsvorsteher beim Schulrat wegen einer Perso-
nalangelegenheit angezeigt hatte. In der Folge sah sich der Pfarrer einem oft böse Formen
annehmenden Kampf der kommunalen Gremien ausgesetzt, der letztendlich ein Kampf
um die Macht im Dorf war. Entnervt und verbittert zog Haußer den Rückzug an und
ließ sich auf eine andere Pfarrstelle versetzten. Der frühere Gemeinschaftspfleger des
Württembergischen Brüderbundes war erst 1942 als 58-jähriger in seine erste Stelle im
Gemeindepfarramt eingetreten. Nach Ansicht des visitierenden Dekans Johannes Her-
mann trugen Haußerspatriarchalische Vorstellung und Einstellung zu seiner Gemeinde37,
die er sich in seiner Zeit als Missionar einer japanischen Südseeinsel erworben hatte, und
33 LKAS A 129 Pfb Grünbach 1963.
34 LKAS A129 Pfb Baiereck-Schlichten 1961.
35 LKAS A129 Pfb Baiereck-Schlichten 1965.
36 Alle Zitate LKAS A129 Pfb Aichschieß 1949.
37 LKAS A129 Beibericht des Dekans Aichschieß 1949.