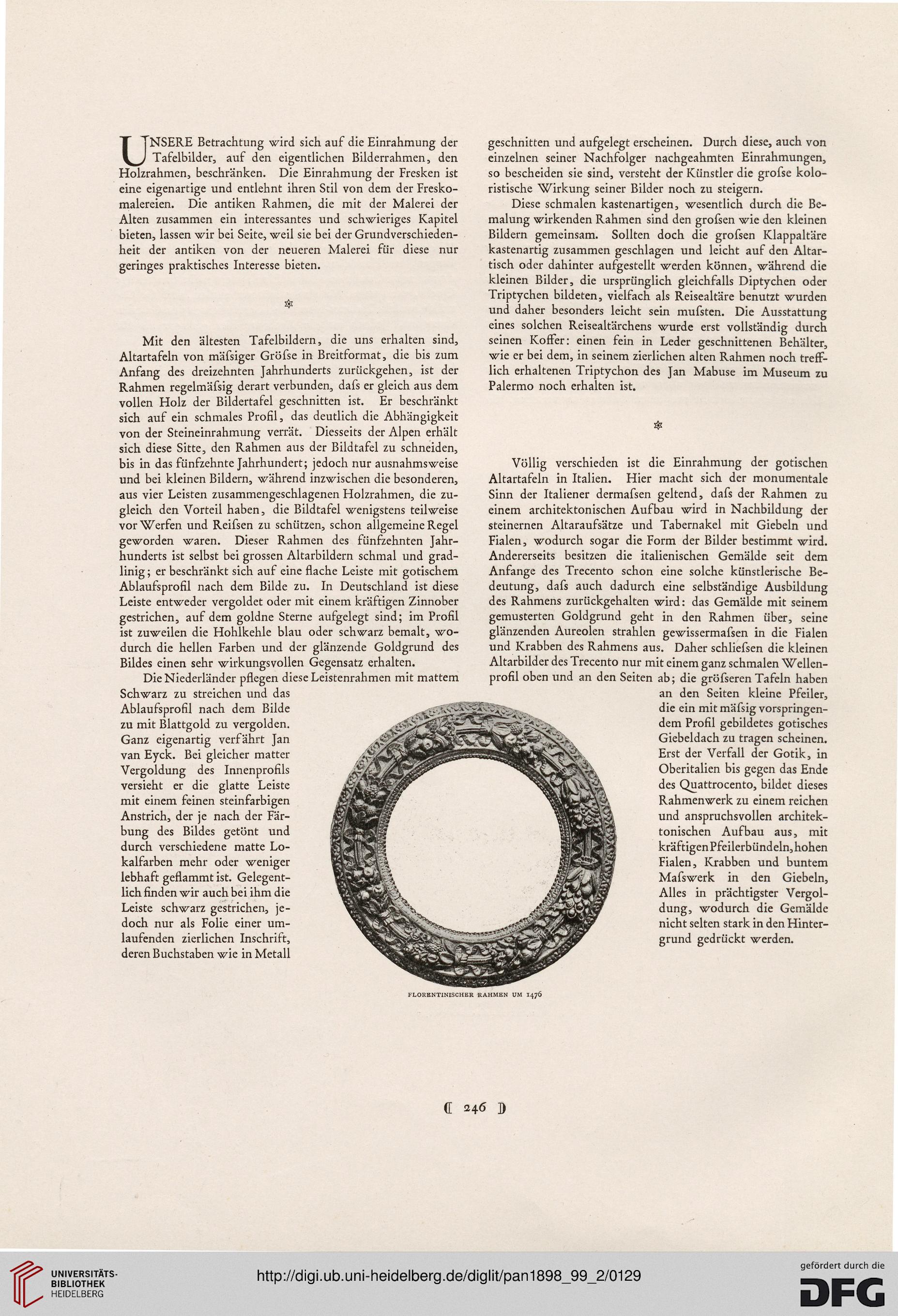UNSERE Betrachtung wird sich auf die Einrahmung der
Tafelbilder, auf den eigentlichen Bilderrahmen, den
Holzrahmen, beschränken. Die Einrahmung der Fresken ist
eine eigenartige und entlehnt ihren Stil von dem der Fresko-
malereien. Die antiken Rahmen, die mit der Malerei der
Alten zusammen ein interessantes und schwieriges Kapitel
bieten, lassen wir bei Seite, weil sie bei der Grundverschieden-
heit der antiken von der neueren Malerei für diese nur
geringes praktisches Interesse bieten.
Mit den ältesten Tafelbildern, die uns erhalten sind,
Altartafeln von mäfsiger Gröfse in Breitformat, die bis zum
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zurückgehen, ist der
Rahmen regelmäfsig derart verbunden, dafs er gleich aus dem
vollen Holz der Bildertafel geschnitten ist. Er beschränkt
sich auf ein schmales Profil, das deutlich die Abhängigkeit
von der Steineinrahmung verrät. Diesseits der Alpen erhält
sich diese Sitte, den Rahmen aus der Bildtafel zu schneiden,
bis in das fünfzehnte Jahrhundert; jedoch nur ausnahmsweise
und bei kleinen Bildern, während inzwischen die besonderen,
aus vier Leisten zusammengeschlagenen Holzrahmen, die zu-
gleich den Vorteil haben, die Bildtafel wenigstens teilweise
vor Werfen und Reifsen zu schützen, schon allgemeine Regel
geworden waren. Dieser Rahmen des fünfzehnten Jahr-
hunderts ist selbst bei grossen Altarbildern schmal und grad-
linig ; er beschränkt sich auf eine flache Leiste mit gotischem
Ablaufsprofil nach dem Bilde zu. In Deutschland ist diese
Leiste entweder vergoldet oder mit einem kräftigen Zinnober
gestrichen, auf dem goldne Sterne aufgelegt sind; im Profil
ist zuweilen die Hohlkehle blau oder schwarz bemalt, wo-
durch die hellen Farben und der glänzende Goldgrund des
Bildes einen sehr wirkungsvollen Gegensatz erhalten.
Die Niederländer pflegen diese Leistenrahmen mit mattem
Schwarz zu streichen und das
Ablaufsprofil nach dem Bilde
zu mit Blattgold zu vergolden.
Ganz eigenartig verfährt Jan
van Eyck. Bei gleicher matter
Vergoldung des Innenprofils
versieht er die glatte Leiste
mit einem feinen steinfarbigen
Anstrich, der je nach der Fär-
bung des Bildes getönt und
durch verschiedene matte Lo-
kalfarben mehr oder weniger
lebhaft geflammt ist. Gelegent-
lich finden wir auch bei ihm die
Leiste schwarz gestrichen, je-
doch nur als Folie einer um-
laufenden zierlichen Inschrift,
deren Buchstaben wie in Metall
geschnitten und aufgelegt erscheinen. Durch diese, auch von
einzelnen seiner Nachfolger nachgeahmten Einrahmungen,
so bescheiden sie sind, versteht der Künstler die grofse kolo-
ristische Wirkung seiner Bilder noch zu steigern.
Diese schmalen kastenartigen, wesentlich durch die Be-
malung wirkenden Rahmen sind den grofsen wie den kleinen
Bildern gemeinsam. Sollten doch die grofsen Klappaltäre
kastenartig zusammen geschlagen und leicht auf den Altar-
tisch oder dahinter aufgestellt werden können, während die
kleinen Bilder, die ursprünglich gleichfalls Diptychen oder
Triptychen bildeten, vielfach als Reisealtäre benutzt wurden
und daher besonders leicht sein mufsten. Die Ausstattung
eines solchen Reisealtärchens wurde erst vollständig durch
seinen Koffer: einen fein in Leder geschnittenen Behälter,
wie er bei dem, in seinem zierlichen alten Rahmen noch treff-
lich erhaltenen Triptychon des Jan Mabuse im Museum zu
Palermo noch erhalten ist.
Völlig verschieden ist die Einrahmung der gotischen
Altartafeln in Italien. Hier macht sich der monumentale
Sinn der Italiener dermafsen geltend, dafs der Rahmen zu
einem architektonischen Aufbau wird in Nachbildung der
steinernen Altaraufsätze und Tabernakel mit Giebeln und
Fialen, wodurch sogar die Form der Bilder bestimmt wird.
Andererseits besitzen die italienischen Gemälde seit dem
Anfange des Trecento schon eine solche künstlerische Be-
deutung, dafs auch dadurch eine selbständige Ausbildung
des Rahmens zurückgehalten wird: das Gemälde mit seinem
gemusterten Goldgrund geht in den Rahmen über, seine
glänzenden Aureolen strahlen gewissermafsen in die Fialen
und Krabben des Rahmens aus. Daher schliefsen die kleinen
Altarbilder des Trecento nur mit einem ganz schmalen Wellen-
profil oben und an den Seiten ab; die gröfseren Tafeln haben
an den Seiten kleine Pfeiler,
iil»iL. die ein mit mäfsig vorspringen-
dem Profil gebildetes gotisches
Giebeldach zu tragen scheinen.
Erst der Verfall der Gotik, in
Oberitalien bis gegen das Ende
des Quattrocento, bildet dieses
Rahmenwerk zu einem reichen
und anspruchsvollen architek-
tonischen Aufbau aus, mit
kräftigen Pfeilerbünd ein, hohen
Fialen, Krabben und buntem
Mafswerk in den Giebeln,
Alles in prächtigster Vergol-
dung, wodurch die Gemälde
nicht selten stark in den Hinter-
grund gedrückt werden.
FLORENTINISCHER RAHMEN UM 1476
C 246 I)
Tafelbilder, auf den eigentlichen Bilderrahmen, den
Holzrahmen, beschränken. Die Einrahmung der Fresken ist
eine eigenartige und entlehnt ihren Stil von dem der Fresko-
malereien. Die antiken Rahmen, die mit der Malerei der
Alten zusammen ein interessantes und schwieriges Kapitel
bieten, lassen wir bei Seite, weil sie bei der Grundverschieden-
heit der antiken von der neueren Malerei für diese nur
geringes praktisches Interesse bieten.
Mit den ältesten Tafelbildern, die uns erhalten sind,
Altartafeln von mäfsiger Gröfse in Breitformat, die bis zum
Anfang des dreizehnten Jahrhunderts zurückgehen, ist der
Rahmen regelmäfsig derart verbunden, dafs er gleich aus dem
vollen Holz der Bildertafel geschnitten ist. Er beschränkt
sich auf ein schmales Profil, das deutlich die Abhängigkeit
von der Steineinrahmung verrät. Diesseits der Alpen erhält
sich diese Sitte, den Rahmen aus der Bildtafel zu schneiden,
bis in das fünfzehnte Jahrhundert; jedoch nur ausnahmsweise
und bei kleinen Bildern, während inzwischen die besonderen,
aus vier Leisten zusammengeschlagenen Holzrahmen, die zu-
gleich den Vorteil haben, die Bildtafel wenigstens teilweise
vor Werfen und Reifsen zu schützen, schon allgemeine Regel
geworden waren. Dieser Rahmen des fünfzehnten Jahr-
hunderts ist selbst bei grossen Altarbildern schmal und grad-
linig ; er beschränkt sich auf eine flache Leiste mit gotischem
Ablaufsprofil nach dem Bilde zu. In Deutschland ist diese
Leiste entweder vergoldet oder mit einem kräftigen Zinnober
gestrichen, auf dem goldne Sterne aufgelegt sind; im Profil
ist zuweilen die Hohlkehle blau oder schwarz bemalt, wo-
durch die hellen Farben und der glänzende Goldgrund des
Bildes einen sehr wirkungsvollen Gegensatz erhalten.
Die Niederländer pflegen diese Leistenrahmen mit mattem
Schwarz zu streichen und das
Ablaufsprofil nach dem Bilde
zu mit Blattgold zu vergolden.
Ganz eigenartig verfährt Jan
van Eyck. Bei gleicher matter
Vergoldung des Innenprofils
versieht er die glatte Leiste
mit einem feinen steinfarbigen
Anstrich, der je nach der Fär-
bung des Bildes getönt und
durch verschiedene matte Lo-
kalfarben mehr oder weniger
lebhaft geflammt ist. Gelegent-
lich finden wir auch bei ihm die
Leiste schwarz gestrichen, je-
doch nur als Folie einer um-
laufenden zierlichen Inschrift,
deren Buchstaben wie in Metall
geschnitten und aufgelegt erscheinen. Durch diese, auch von
einzelnen seiner Nachfolger nachgeahmten Einrahmungen,
so bescheiden sie sind, versteht der Künstler die grofse kolo-
ristische Wirkung seiner Bilder noch zu steigern.
Diese schmalen kastenartigen, wesentlich durch die Be-
malung wirkenden Rahmen sind den grofsen wie den kleinen
Bildern gemeinsam. Sollten doch die grofsen Klappaltäre
kastenartig zusammen geschlagen und leicht auf den Altar-
tisch oder dahinter aufgestellt werden können, während die
kleinen Bilder, die ursprünglich gleichfalls Diptychen oder
Triptychen bildeten, vielfach als Reisealtäre benutzt wurden
und daher besonders leicht sein mufsten. Die Ausstattung
eines solchen Reisealtärchens wurde erst vollständig durch
seinen Koffer: einen fein in Leder geschnittenen Behälter,
wie er bei dem, in seinem zierlichen alten Rahmen noch treff-
lich erhaltenen Triptychon des Jan Mabuse im Museum zu
Palermo noch erhalten ist.
Völlig verschieden ist die Einrahmung der gotischen
Altartafeln in Italien. Hier macht sich der monumentale
Sinn der Italiener dermafsen geltend, dafs der Rahmen zu
einem architektonischen Aufbau wird in Nachbildung der
steinernen Altaraufsätze und Tabernakel mit Giebeln und
Fialen, wodurch sogar die Form der Bilder bestimmt wird.
Andererseits besitzen die italienischen Gemälde seit dem
Anfange des Trecento schon eine solche künstlerische Be-
deutung, dafs auch dadurch eine selbständige Ausbildung
des Rahmens zurückgehalten wird: das Gemälde mit seinem
gemusterten Goldgrund geht in den Rahmen über, seine
glänzenden Aureolen strahlen gewissermafsen in die Fialen
und Krabben des Rahmens aus. Daher schliefsen die kleinen
Altarbilder des Trecento nur mit einem ganz schmalen Wellen-
profil oben und an den Seiten ab; die gröfseren Tafeln haben
an den Seiten kleine Pfeiler,
iil»iL. die ein mit mäfsig vorspringen-
dem Profil gebildetes gotisches
Giebeldach zu tragen scheinen.
Erst der Verfall der Gotik, in
Oberitalien bis gegen das Ende
des Quattrocento, bildet dieses
Rahmenwerk zu einem reichen
und anspruchsvollen architek-
tonischen Aufbau aus, mit
kräftigen Pfeilerbünd ein, hohen
Fialen, Krabben und buntem
Mafswerk in den Giebeln,
Alles in prächtigster Vergol-
dung, wodurch die Gemälde
nicht selten stark in den Hinter-
grund gedrückt werden.
FLORENTINISCHER RAHMEN UM 1476
C 246 I)