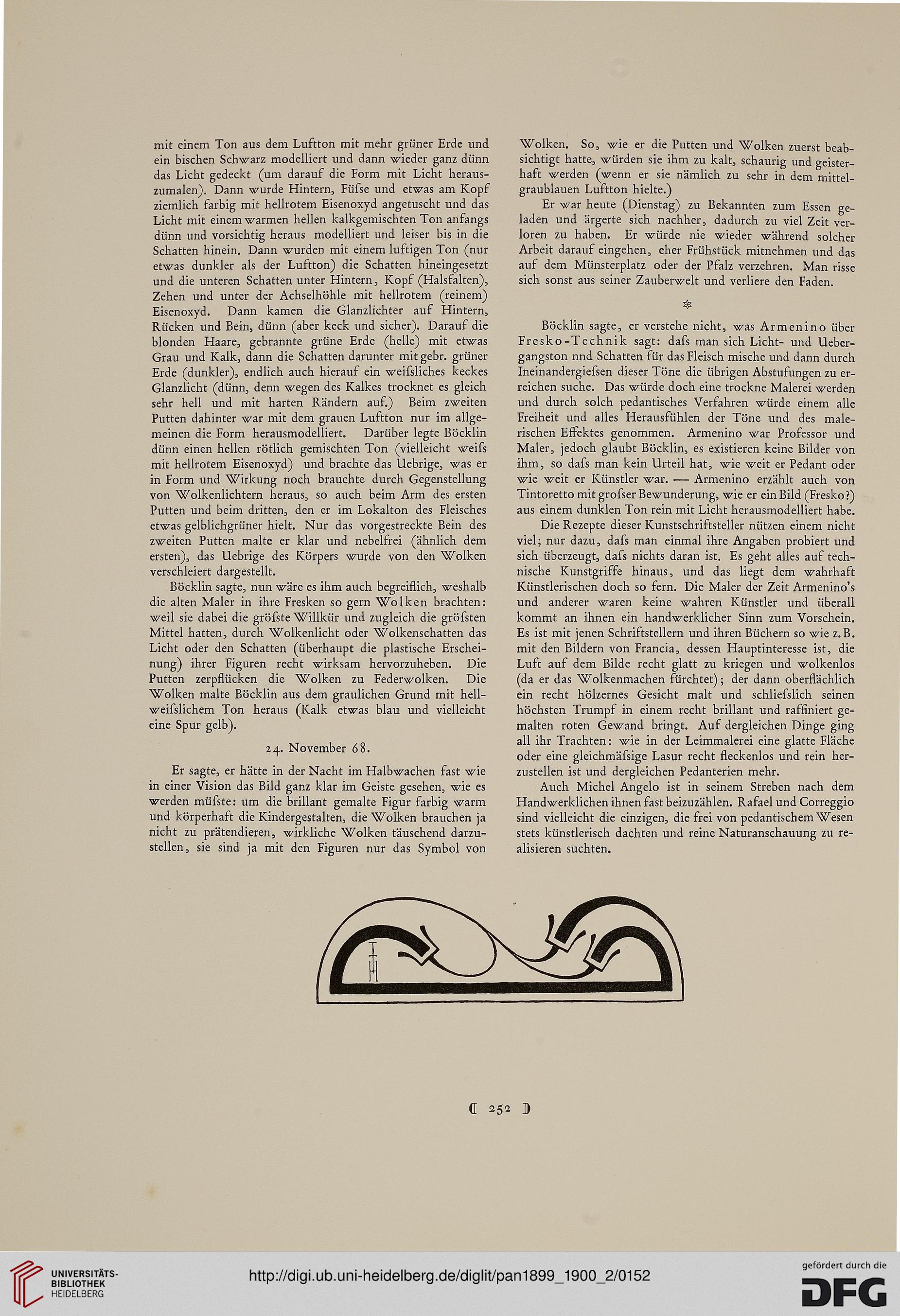mit einem Ton aus dem Luftton mit mehr grüner Erde und
ein bischen Schwarz modelliert und dann wieder ganz dünn
das Licht gedeckt (um darauf die Form mit Licht heraus-
zumalen). Dann wurde Hintern, Füfse und etwas am Kopf
ziemlich farbig mit hellrotem Eisenoxyd angetuscht und das
Licht mit einem warmen hellen kalkgemischten Ton anfangs
dünn und vorsichtig heraus modelliert und leiser bis in die
Schatten hinein. Dann wurden mit einem luftigen Ton (nur
etwas dunkler als der Luftton) die Schatten hineingesetzt
und die unteren Schatten unter Hintern, Kopf (Halsfalten),
Zehen und unter der Achselhöhle mit hellrotem (reinem)
Eisenoxyd. Dann kamen die Glanzlichter auf Hintern,
Rücken und Bein, dünn (aber keck und sicher). Darauf die
blonden Haare, gebrannte grüne Erde (helle) mit etwas
Grau und Kalk, dann die Schatten darunter mit gebr. grüner
Erde (dunkler), endlich auch hierauf ein weifsliches keckes
Glanzlicht (dünn, denn wegen des Kalkes trocknet es gleich
sehr hell und mit harten Rändern auf.) Beim zweiten
Putten dahinter war mit dem grauen Luftton nur im allge-
meinen die Form herausmodelliert. Darüber legte Böcklin
dünn einen hellen rötlich gemischten Ton (vielleicht weifs
mit hellrotem Eisenoxyd) und brachte das Uebrige, was er
in Form und Wirkung noch brauchte durch Gegenstellung
von Wolkenlichtern heraus, so auch beim Arm des ersten
Putten und beim dritten, den er im Lokalton des Fleisches
etwas gelblichgrüner hielt. Nur das vorgestreckte Bein des
zweiten Putten malte er klar und nebelfrei (ähnlich dem
ersten), das Uebrige des Körpers wurde von den Wolken
verschleiert dargestellt.
Böcklin sagte, nun wäre es ihm auch begreiflich, weshalb
die alten Maler in ihre Fresken so gern Wolken brachten:
weil sie dabei die gröfste Willkür und zugleich die gröfsten
Mittel hatten, durch Wolkenlicht oder Wolkenschatten das
Licht oder den Schatten (überhaupt die plastische Erschei-
nung) ihrer Figuren recht wirksam hervorzuheben. Die
Putten zerpflücken die Wolken zu Federwolken. Die
Wolken malte Böcklin aus dem graulichen Grund mit hell-
weifslichem Ton heraus (Kalk etwas blau und vielleicht
eine Spur gelb).
24. November 68.
Er sagte, er hätte in der Nacht im Halbwachen fast wie
in einer Vision das Bild ganz klar im Geiste gesehen, wie es
werden müfste: um die brillant gemalte Figur farbig warm
und körperhaft die Kindergestalten, die Wolken brauchen ja
nicht zu prätendieren, wirkliche Wolken täuschend darzu-
stellen, sie sind ja mit den Figuren nur das Symbol von
Wolken. So, wie er die Putten und Wolken zuerst beab-
sichtigt hatte, würden sie ihm zu kalt, schaurig und geister-
haft werden (wenn er sie nämlich zu sehr in dem mittel-
graublauen Luftton hielte.)
Er war heute (Dienstag) zu Bekannten zum Essen ge-
laden und ärgerte sich nachher, dadurch zu viel Zeit ver-
loren zu haben. Er würde nie wieder während solcher
Arbeit darauf eingehen, eher Frühstück mitnehmen und das
auf dem Münsterplatz oder der Pfalz verzehren. Man risse
sich sonst aus seiner Zauberwelt und verliere den Faden.
Böcklin sagte, er verstehe nicht, was Armen in o über
Fresko-Technik sagt: dafs man sich Licht- und Ueber-
gangston nnd Schatten für das Fleisch mische und dann durch
Ineinandergiefsen dieser Töne die übrigen Abstufungen zu er-
reichen suche. Das würde doch eine trockne Malerei werden
und durch solch pedantisches Verfahren würde einem alle
Freiheit und alles Herausfühlen der Töne und des male-
rischen Effektes genommen. Armenino war Professor und
Maler, jedoch glaubt Böcklin, es existieren keine Bilder von
ihm, so dafs man kein Urteil hat, wie weit er Pedant oder
wie weit er Künstler war. — Armenino erzählt auch von
Tintoretto mit grofser Bewunderung, wie er ein Bild (Fresko?)
aus einem dunklen Ton rein mit Licht herausmodelliert habe.
Die Rezepte dieser Kunstschriftsteller nützen einem nicht
viel; nur dazu, dafs man einmal ihre Angaben probiert und
sich überzeugt, dafs nichts daran ist. Es geht alles auf tech-
nische Kunstgriffe hinaus, und das liegt dem wahrhaft
Künstlerischen doch so fern. Die Maler der Zeit Armenino's
und anderer waren keine wahren Künstler und überall
kommt an ihnen ein handwerklicher Sinn zum Vorschein.
Es ist mit jenen Schriftstellern und ihren Büchern so wie z.B.
mit den Bildern von Francia, dessen Hauptinteresse ist, die
Luft auf dem Bilde recht glatt zu kriegen und wolkenlos
(da er das Wolkenmachen fürchtet); der dann oberflächlich
ein recht hölzernes Gesicht malt und schliefslich seinen
höchsten Trumpf in einem recht brillant und raffiniert ge-
malten roten Gewand bringt. Auf dergleichen Dinge ging
all ihr Trachten: wie in der Leimmalerei eine glatte Fläche
oder eine gleichmäfsige Lasur recht fleckenlos und rein her-
zustellen ist und dergleichen Pedanterien mehr.
Auch Michel Angelo ist in seinem Streben nach dem
Handwerklichen ihnen fast beizuzählen. Rafael und Correggio
sind vielleicht die einzigen, die frei von pedantischem Wesen
stets künstlerisch dachten und reine Naturanschauung zu re-
alisieren suchten.
C 252 3
ein bischen Schwarz modelliert und dann wieder ganz dünn
das Licht gedeckt (um darauf die Form mit Licht heraus-
zumalen). Dann wurde Hintern, Füfse und etwas am Kopf
ziemlich farbig mit hellrotem Eisenoxyd angetuscht und das
Licht mit einem warmen hellen kalkgemischten Ton anfangs
dünn und vorsichtig heraus modelliert und leiser bis in die
Schatten hinein. Dann wurden mit einem luftigen Ton (nur
etwas dunkler als der Luftton) die Schatten hineingesetzt
und die unteren Schatten unter Hintern, Kopf (Halsfalten),
Zehen und unter der Achselhöhle mit hellrotem (reinem)
Eisenoxyd. Dann kamen die Glanzlichter auf Hintern,
Rücken und Bein, dünn (aber keck und sicher). Darauf die
blonden Haare, gebrannte grüne Erde (helle) mit etwas
Grau und Kalk, dann die Schatten darunter mit gebr. grüner
Erde (dunkler), endlich auch hierauf ein weifsliches keckes
Glanzlicht (dünn, denn wegen des Kalkes trocknet es gleich
sehr hell und mit harten Rändern auf.) Beim zweiten
Putten dahinter war mit dem grauen Luftton nur im allge-
meinen die Form herausmodelliert. Darüber legte Böcklin
dünn einen hellen rötlich gemischten Ton (vielleicht weifs
mit hellrotem Eisenoxyd) und brachte das Uebrige, was er
in Form und Wirkung noch brauchte durch Gegenstellung
von Wolkenlichtern heraus, so auch beim Arm des ersten
Putten und beim dritten, den er im Lokalton des Fleisches
etwas gelblichgrüner hielt. Nur das vorgestreckte Bein des
zweiten Putten malte er klar und nebelfrei (ähnlich dem
ersten), das Uebrige des Körpers wurde von den Wolken
verschleiert dargestellt.
Böcklin sagte, nun wäre es ihm auch begreiflich, weshalb
die alten Maler in ihre Fresken so gern Wolken brachten:
weil sie dabei die gröfste Willkür und zugleich die gröfsten
Mittel hatten, durch Wolkenlicht oder Wolkenschatten das
Licht oder den Schatten (überhaupt die plastische Erschei-
nung) ihrer Figuren recht wirksam hervorzuheben. Die
Putten zerpflücken die Wolken zu Federwolken. Die
Wolken malte Böcklin aus dem graulichen Grund mit hell-
weifslichem Ton heraus (Kalk etwas blau und vielleicht
eine Spur gelb).
24. November 68.
Er sagte, er hätte in der Nacht im Halbwachen fast wie
in einer Vision das Bild ganz klar im Geiste gesehen, wie es
werden müfste: um die brillant gemalte Figur farbig warm
und körperhaft die Kindergestalten, die Wolken brauchen ja
nicht zu prätendieren, wirkliche Wolken täuschend darzu-
stellen, sie sind ja mit den Figuren nur das Symbol von
Wolken. So, wie er die Putten und Wolken zuerst beab-
sichtigt hatte, würden sie ihm zu kalt, schaurig und geister-
haft werden (wenn er sie nämlich zu sehr in dem mittel-
graublauen Luftton hielte.)
Er war heute (Dienstag) zu Bekannten zum Essen ge-
laden und ärgerte sich nachher, dadurch zu viel Zeit ver-
loren zu haben. Er würde nie wieder während solcher
Arbeit darauf eingehen, eher Frühstück mitnehmen und das
auf dem Münsterplatz oder der Pfalz verzehren. Man risse
sich sonst aus seiner Zauberwelt und verliere den Faden.
Böcklin sagte, er verstehe nicht, was Armen in o über
Fresko-Technik sagt: dafs man sich Licht- und Ueber-
gangston nnd Schatten für das Fleisch mische und dann durch
Ineinandergiefsen dieser Töne die übrigen Abstufungen zu er-
reichen suche. Das würde doch eine trockne Malerei werden
und durch solch pedantisches Verfahren würde einem alle
Freiheit und alles Herausfühlen der Töne und des male-
rischen Effektes genommen. Armenino war Professor und
Maler, jedoch glaubt Böcklin, es existieren keine Bilder von
ihm, so dafs man kein Urteil hat, wie weit er Pedant oder
wie weit er Künstler war. — Armenino erzählt auch von
Tintoretto mit grofser Bewunderung, wie er ein Bild (Fresko?)
aus einem dunklen Ton rein mit Licht herausmodelliert habe.
Die Rezepte dieser Kunstschriftsteller nützen einem nicht
viel; nur dazu, dafs man einmal ihre Angaben probiert und
sich überzeugt, dafs nichts daran ist. Es geht alles auf tech-
nische Kunstgriffe hinaus, und das liegt dem wahrhaft
Künstlerischen doch so fern. Die Maler der Zeit Armenino's
und anderer waren keine wahren Künstler und überall
kommt an ihnen ein handwerklicher Sinn zum Vorschein.
Es ist mit jenen Schriftstellern und ihren Büchern so wie z.B.
mit den Bildern von Francia, dessen Hauptinteresse ist, die
Luft auf dem Bilde recht glatt zu kriegen und wolkenlos
(da er das Wolkenmachen fürchtet); der dann oberflächlich
ein recht hölzernes Gesicht malt und schliefslich seinen
höchsten Trumpf in einem recht brillant und raffiniert ge-
malten roten Gewand bringt. Auf dergleichen Dinge ging
all ihr Trachten: wie in der Leimmalerei eine glatte Fläche
oder eine gleichmäfsige Lasur recht fleckenlos und rein her-
zustellen ist und dergleichen Pedanterien mehr.
Auch Michel Angelo ist in seinem Streben nach dem
Handwerklichen ihnen fast beizuzählen. Rafael und Correggio
sind vielleicht die einzigen, die frei von pedantischem Wesen
stets künstlerisch dachten und reine Naturanschauung zu re-
alisieren suchten.
C 252 3