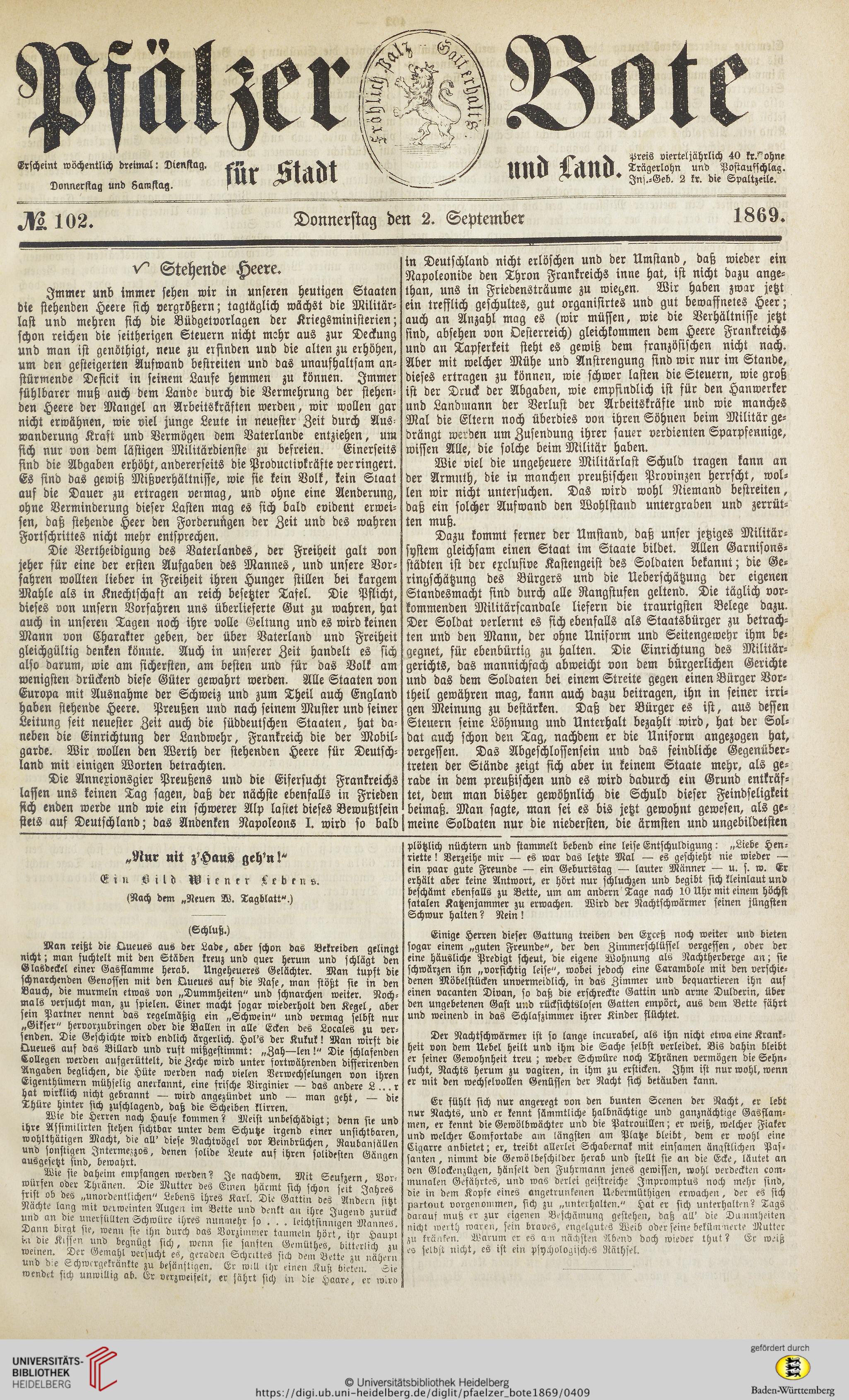/sv Preis vierteljährlich 40 kr.^ohne
miü LÄ.11U. Trägerlohn und Postaufschlag.
J^.,Geb. 2 kr. die Spaltzeile.
für Stadt
Donnerstag und Samstag.
1869.
Donnerstag den 2. September
H02.
Stehende Heere.
Immer unb immer sehen wir in unseren heutigen Staaten
die stehenden Heere sich vergrößern; tagtäglich wächst die Militär-
last und mehren sich die Budgetvorlagen der Kriegsministerien;
schon reichen die seitherigen Steuern nicht mehr aus zur Deckung
und man ist genöthigt, neue zu erfinden und die alten zu erhöhen,
um den gesteigerten Aufwand bestreiten und das unaufhaltsam an-
stürmende Deficit in seinem Laufe hemmen zu können. Immer
fühlbarer muß auch dem Lande durch die Vermehrung der stehen-
den Heere der Mangel an Arbeitskräften werden, wir wollen gar
nicht erwähnen, wie viel junge Leute in neuester Zeit durch Aus-
wanderung Kraft und Vermögen dem Vaterlande entziehen, um
sich nur von dem lästigen Militärdienste zu befreien. Einerseits
find die Abgaben erhöht, andererseits die Productivkräfte verringert.
Es sind das gewiß Mißverhältnisse, wie sie kein Volk, kein Staat
auf die Dauer zu ertragen vermag, und ohne eine Aenderung,
ohne Verminderung dieser Lasten mag es sich bald evident erwei-
sen, daß stehende Heer den Forderuügen der Zeit und des wahren
Fortschrittes nicht mehr entsprechen.
Die Verteidigung des Vaterlandes, der Freiheit galt von
jeher für eine der ersten Aufgaben des Mannes, und unsere Vor-
fahren wollten lieber in Freiheit ihren Hunger stillen bei kargem
Mahle als in Knechtschaft an reich besetzter Tafel. Die Pflicht,
dieses von unfern Vorfahren uns überlieferte Gut zu wahren, hat
auch in unseren Tagen noch ihre volle Geltung und es wird keinen
Mann von Charakter geben, der über Vaterland und Freiheit
gleichgültig denken könnte. Auch in unserer Zeit handelt es sich
also darum, wie am sichersten, am besten und für das Volk am
wenigsten drückend diese Güter gewahrt werden. Alle Staaten von
Europa mit Ausnahme der Schweiz und Zum Theil auch England
haben stehende Heere. Preußen und nach seinem Muster und seiner
Leitung seit neuester Zeit auch die süddeutschen Staaten, hat da-
neben die Einrichtung der Landwehr, Frankreich die der Mobil-
garde. Wir wollen den Werth der stehenden Heere für Deutsch-
land mit einigen Worten betrachten.
Die Annexionsgier Preußens und die Eifersucht Frankreichs
lassen uns keinen Tag sagen, daß der nächste ebenfalls in Frieden
sich enden werde und wie ein schwerer Alp lastet dieses Bewußtsein
stets auf Deutschland; das Andenken Napoleons I. wird so bald
in Deutschland nicht erlöschen und der Umstand, daß wieder ein
Napoleonide den Thron Frankreichs inne hat, ist nicht dazu ange-
than, uns in Friedensträume zu wiegen. Wir haben zwar jetzt
ein trefflich geschultes, gut organistrtes und gut bewaffnetes Heer;
auch an Anzahl mag es (wir müssen, wie die Verhältnisse jetzt
sind, absehen von Oesterreich) gleichkommen dem Heere Frankreichs
und an Tapferkeit steht es gewiß dem französischen nicht nach.
Aber mit welcher Mühe und Anstrengung sind wir nur im Stande,
dieses ertragen zu können, wie schwer lasten die Steuern, wie groß
ist der Druck der Abgaben, wie empfindlich ist für den Hanwerker
und Landmann der Verlust der Arbeitskräfte und wie manches
Mal die Eltern noch überdies von ihren Söhnen beim Militär ge-
drängt werden um Zusendung ihrer sauer verdienten Sparpfennige,
wissen Alle, die solche beim Militär haben.
Wie viel die ungeheuere Militärlast Schuld tragen kann an
der Armnth, die in manchen preußischen Provinzen herrscht, wol-
len wir nicht untersuchen. Das wird wohl Niemand bestreiten,
daß ein solcher Aufwand den Wohlstand untergraben und zerrüt-
ten muß.
Dazu kommt ferner der Umstand, daß unser jetziges Militär-
system gleichsam einen Staat im Staate bildet. Allen Garnisons-
städten ist der exclusive Kastengeist des Soldaten bekannt; die Ge-
ringschätzung des Bürgers und die Uebsrschätzung der eigenen
Standesmacht sind durch alle Rangstufen geltend. Die täglich vor-
kommenden Militärscandale liefern die traurigsten Belege dazu.
Der Soldat verlernt es sich ebenfalls als Staatsbürger zu betrach-
ten und den Mann, der ohne Uniform und Seitengewehr ihm be-
gegnet, für ebenbürtig Zu halten. Die Einrichtung des Militär-
gerichts, das mannichfach abweicht von dem bürgerlichen Gerichte
und das dem Soldaten bei einem Streite gegen einen Bürger Vor-
theil gewähren mag, kann auch dazu beitragen, ihn in seiner irri-
gen Meinung zu bestärken. Daß der Bürger es ist, aus dessen
Steuern seine Löhnung und Unterhalt bezahlt wird, hat der Sol-
dat auch schon den Tag, nachdem er die Uniform angezogen hat,
vergessen. Das Abgeschlossensein und das feindliche Gegenüber-
treten der Stände zeigt sich aber in keinem Staate mehr, als ge-
rade in dem preußischen und es wird dadurch ein Grund entkräf-
tet, dem man bisher gewöhnlich die Schuld dieser Feindseligkeit
beimaß. Man sagte, man sei es bis jetzt gewohnt gewesen, als ge-
meine Soldaten nur die niedersten, die ärmsten und ungebildetsten
„Nur nit z Haus geh n!"
Gin Bild Wiener Lebens.
(Nach dem „Neuen W. Tagblatt".)
aus i
Stäben kreuz und quer herum und schlägt den
Man reißt die Queues
nicht; man fuchtelt mit den
Glasdeckel einer Gasflamme _ __
schnarchenden Genossen mit den Queues auf die Nase, man stößt sie in den
Bauch, die murmeln etwas von „Dummheiten" und schnarchen weiter. Noch-
mals versucht man, zu spielen. Einer macht sogar wiederholt den Kegel, aber
nennt das regelmäßig ein „Schwein" und vermag selbst nur
„Glkser" hervorzubringen oder die Ballen in alle Ecken des Locales zu ver-
senden. Die Geschichte wird endlich ärgerlich. Hol's der Kukuk! Man wirft die
Queues auf das Billard und ruft mißgestimmt: „Zah—len!" Die schlafenden
Lollegen werden aufgerüttelt, die Zeche wird unter fortwährenden differirenden
Angaben beglichen, die Hüte werden nach vielen Verwechselungen von ihren
Elgenthümern mühselig anerkannt, eine frische Virginier — das andere L...r
hat wirklich nicht gebrannt — wird angezündet und — man geht, — die
sich zuschlagend, daß die Scheiben klirren.
die Herren nach Hause kommen? Meist unbeschädigt; denn sie und
stehen sichtbar unter dem Schutze irgend einer unsichtbaren,
wohlthatlgen Macht, die all' diese Nachtvögel vor Beinbrüchen, Raubansällen
Wie sie daheim empfangen werden? Je nachdem. Mit Seufzern Vor-
wurfen oder Thränen. Die Mutter des Einen härmt sich schon seit Jahres
ftlst ob des „unordentlichen" Lebens ihres Karl. Die Gattin des Andern sitzt
Nachte lang mit verweinten Augen im Bette und denkt an ihre Jugend zurück
unerfüllten Schwüre ihres nunmehr so . . . leichtsinrugen Mannes.
Dann bngt sie, wenn sie ihn durch das Vorzimmer taumeln hört, ihr Haupl
va die Kissen und begnügt sich, wenn sie sanften Gemüthes, bitterlich zu
Gemahl versucht es, geraden Schrittes sich dem Bette zu nähen,
ru besänftigen. Er will ihr einen Kuß bieten. Sie
wendet sich unwillig ab. Er verzweifelt, er fährt sich m die Haare, er werd
(Schluß.)
der Lade, aber schon das Bekreiden gelingt
herab. Ungeheueres Gelächter. Man tupft die
plötzlich nüchtern und stammelt bebend eine leise Entschuldigung: „Liebe Hen-
riette ! Verzeihe mir — es war das letzte Mal — es geschieht nie wieder —
ein paar gute Freunde — ein Geburtstag — lauter Männer u. s. w. Gr
erhält aber keine Antwort, er hört nur schluchzen und begibt sich kleinlaut und
beschämt ebenfalls zu Bette, um am andern Tage nach 10 Uhr mit einem höchst
fatalen Katzenjammer zu erwachen. Wird der Nachtschwärmer seinen jüngsten
Schwur halten? Nein?
Einige Herren dieser Gattung treiben den Exceß noch weiter und bieten
sogar einem „guten Freunde", der den Zimmerschlüssel vergessen, oder der
eine häusliche Predigt scheut, die eigene Wohnung als Nachtherberge an; sie
schwärzen ihn „vorsichtig leise", wobei jedoch eine Carambole mit den verschie-
denen Möbelstücken unvermeidlich, in das Zimmer und bequartiersn ihn auf
einen vacanten Divan, so daß die erschreckte Gattin und arme Dulderin, über
den ungebetenen Gast und rücksichtslosen Gatten empört, aus dem Bette fährt
und weinend in das Schlafzimmer ihrer Kinder flüchtet.
Der Nachtschwärmer ist so lange incurabel, als ihn nicht etwa eine Krank-
heit von dem Uebel heilt und ihm die Sache selbst verleidet. Bis dahin bleibt
er seiner Gewohnheit treu ; weder Schwüre noch Thränen vermögen die Sehn-
sucht, Nachts herum zu vagiren, in ihm zu ersticken. Ihm ist nur wohl, wenn
er nut den wechselvollen Genüssen der Nacht sich betäuben kann.
Er fühlt sich nur angeregt von den bunten Scenen der Nacht, er lebt
nur Nachts, und er kennt sämmtliche halbnächtige und ganznächtige Gasflam-
men, er kennt die Gewölbwächter und die Patrouillen; er weiß, welcher Fiaker
und welcher Comfortabe am längsten am Platze bleibt, dem er wohl eine
Cigarre anbietet; er, treibt allerlei Schabernak mit einsamen ängstlichen Pas-
santen , nimmt die Gewölbeschilder herab und stellt sie an die Ecke, läutet an
den Glockenzügen, hänselt den Fuhrmann jenes gewissen, wohl verdeckten com-
munalen Gefährtes, und was derlei geistreiche Impromptus noch mehr sind,
die in dem Kopfe eines angetrunkenen Uebermüthigen erwachen, der es sich
portout vorgenommen, sich zu „unterhalten." Hat er sich unterhalten? Tags
darauf muß er zur eigenen Beschämung gestehen, daß all' die Dummheiten
nicht werth waren, sein braves, engelgutes Weib oder seine bekümmerte Mutter
zu kränken. Warum er es a n nächsten Abend doch wieder thut? Er weiß
es selbst nicht, es ist ein psychologisches Näthsel.
miü LÄ.11U. Trägerlohn und Postaufschlag.
J^.,Geb. 2 kr. die Spaltzeile.
für Stadt
Donnerstag und Samstag.
1869.
Donnerstag den 2. September
H02.
Stehende Heere.
Immer unb immer sehen wir in unseren heutigen Staaten
die stehenden Heere sich vergrößern; tagtäglich wächst die Militär-
last und mehren sich die Budgetvorlagen der Kriegsministerien;
schon reichen die seitherigen Steuern nicht mehr aus zur Deckung
und man ist genöthigt, neue zu erfinden und die alten zu erhöhen,
um den gesteigerten Aufwand bestreiten und das unaufhaltsam an-
stürmende Deficit in seinem Laufe hemmen zu können. Immer
fühlbarer muß auch dem Lande durch die Vermehrung der stehen-
den Heere der Mangel an Arbeitskräften werden, wir wollen gar
nicht erwähnen, wie viel junge Leute in neuester Zeit durch Aus-
wanderung Kraft und Vermögen dem Vaterlande entziehen, um
sich nur von dem lästigen Militärdienste zu befreien. Einerseits
find die Abgaben erhöht, andererseits die Productivkräfte verringert.
Es sind das gewiß Mißverhältnisse, wie sie kein Volk, kein Staat
auf die Dauer zu ertragen vermag, und ohne eine Aenderung,
ohne Verminderung dieser Lasten mag es sich bald evident erwei-
sen, daß stehende Heer den Forderuügen der Zeit und des wahren
Fortschrittes nicht mehr entsprechen.
Die Verteidigung des Vaterlandes, der Freiheit galt von
jeher für eine der ersten Aufgaben des Mannes, und unsere Vor-
fahren wollten lieber in Freiheit ihren Hunger stillen bei kargem
Mahle als in Knechtschaft an reich besetzter Tafel. Die Pflicht,
dieses von unfern Vorfahren uns überlieferte Gut zu wahren, hat
auch in unseren Tagen noch ihre volle Geltung und es wird keinen
Mann von Charakter geben, der über Vaterland und Freiheit
gleichgültig denken könnte. Auch in unserer Zeit handelt es sich
also darum, wie am sichersten, am besten und für das Volk am
wenigsten drückend diese Güter gewahrt werden. Alle Staaten von
Europa mit Ausnahme der Schweiz und Zum Theil auch England
haben stehende Heere. Preußen und nach seinem Muster und seiner
Leitung seit neuester Zeit auch die süddeutschen Staaten, hat da-
neben die Einrichtung der Landwehr, Frankreich die der Mobil-
garde. Wir wollen den Werth der stehenden Heere für Deutsch-
land mit einigen Worten betrachten.
Die Annexionsgier Preußens und die Eifersucht Frankreichs
lassen uns keinen Tag sagen, daß der nächste ebenfalls in Frieden
sich enden werde und wie ein schwerer Alp lastet dieses Bewußtsein
stets auf Deutschland; das Andenken Napoleons I. wird so bald
in Deutschland nicht erlöschen und der Umstand, daß wieder ein
Napoleonide den Thron Frankreichs inne hat, ist nicht dazu ange-
than, uns in Friedensträume zu wiegen. Wir haben zwar jetzt
ein trefflich geschultes, gut organistrtes und gut bewaffnetes Heer;
auch an Anzahl mag es (wir müssen, wie die Verhältnisse jetzt
sind, absehen von Oesterreich) gleichkommen dem Heere Frankreichs
und an Tapferkeit steht es gewiß dem französischen nicht nach.
Aber mit welcher Mühe und Anstrengung sind wir nur im Stande,
dieses ertragen zu können, wie schwer lasten die Steuern, wie groß
ist der Druck der Abgaben, wie empfindlich ist für den Hanwerker
und Landmann der Verlust der Arbeitskräfte und wie manches
Mal die Eltern noch überdies von ihren Söhnen beim Militär ge-
drängt werden um Zusendung ihrer sauer verdienten Sparpfennige,
wissen Alle, die solche beim Militär haben.
Wie viel die ungeheuere Militärlast Schuld tragen kann an
der Armnth, die in manchen preußischen Provinzen herrscht, wol-
len wir nicht untersuchen. Das wird wohl Niemand bestreiten,
daß ein solcher Aufwand den Wohlstand untergraben und zerrüt-
ten muß.
Dazu kommt ferner der Umstand, daß unser jetziges Militär-
system gleichsam einen Staat im Staate bildet. Allen Garnisons-
städten ist der exclusive Kastengeist des Soldaten bekannt; die Ge-
ringschätzung des Bürgers und die Uebsrschätzung der eigenen
Standesmacht sind durch alle Rangstufen geltend. Die täglich vor-
kommenden Militärscandale liefern die traurigsten Belege dazu.
Der Soldat verlernt es sich ebenfalls als Staatsbürger zu betrach-
ten und den Mann, der ohne Uniform und Seitengewehr ihm be-
gegnet, für ebenbürtig Zu halten. Die Einrichtung des Militär-
gerichts, das mannichfach abweicht von dem bürgerlichen Gerichte
und das dem Soldaten bei einem Streite gegen einen Bürger Vor-
theil gewähren mag, kann auch dazu beitragen, ihn in seiner irri-
gen Meinung zu bestärken. Daß der Bürger es ist, aus dessen
Steuern seine Löhnung und Unterhalt bezahlt wird, hat der Sol-
dat auch schon den Tag, nachdem er die Uniform angezogen hat,
vergessen. Das Abgeschlossensein und das feindliche Gegenüber-
treten der Stände zeigt sich aber in keinem Staate mehr, als ge-
rade in dem preußischen und es wird dadurch ein Grund entkräf-
tet, dem man bisher gewöhnlich die Schuld dieser Feindseligkeit
beimaß. Man sagte, man sei es bis jetzt gewohnt gewesen, als ge-
meine Soldaten nur die niedersten, die ärmsten und ungebildetsten
„Nur nit z Haus geh n!"
Gin Bild Wiener Lebens.
(Nach dem „Neuen W. Tagblatt".)
aus i
Stäben kreuz und quer herum und schlägt den
Man reißt die Queues
nicht; man fuchtelt mit den
Glasdeckel einer Gasflamme _ __
schnarchenden Genossen mit den Queues auf die Nase, man stößt sie in den
Bauch, die murmeln etwas von „Dummheiten" und schnarchen weiter. Noch-
mals versucht man, zu spielen. Einer macht sogar wiederholt den Kegel, aber
nennt das regelmäßig ein „Schwein" und vermag selbst nur
„Glkser" hervorzubringen oder die Ballen in alle Ecken des Locales zu ver-
senden. Die Geschichte wird endlich ärgerlich. Hol's der Kukuk! Man wirft die
Queues auf das Billard und ruft mißgestimmt: „Zah—len!" Die schlafenden
Lollegen werden aufgerüttelt, die Zeche wird unter fortwährenden differirenden
Angaben beglichen, die Hüte werden nach vielen Verwechselungen von ihren
Elgenthümern mühselig anerkannt, eine frische Virginier — das andere L...r
hat wirklich nicht gebrannt — wird angezündet und — man geht, — die
sich zuschlagend, daß die Scheiben klirren.
die Herren nach Hause kommen? Meist unbeschädigt; denn sie und
stehen sichtbar unter dem Schutze irgend einer unsichtbaren,
wohlthatlgen Macht, die all' diese Nachtvögel vor Beinbrüchen, Raubansällen
Wie sie daheim empfangen werden? Je nachdem. Mit Seufzern Vor-
wurfen oder Thränen. Die Mutter des Einen härmt sich schon seit Jahres
ftlst ob des „unordentlichen" Lebens ihres Karl. Die Gattin des Andern sitzt
Nachte lang mit verweinten Augen im Bette und denkt an ihre Jugend zurück
unerfüllten Schwüre ihres nunmehr so . . . leichtsinrugen Mannes.
Dann bngt sie, wenn sie ihn durch das Vorzimmer taumeln hört, ihr Haupl
va die Kissen und begnügt sich, wenn sie sanften Gemüthes, bitterlich zu
Gemahl versucht es, geraden Schrittes sich dem Bette zu nähen,
ru besänftigen. Er will ihr einen Kuß bieten. Sie
wendet sich unwillig ab. Er verzweifelt, er fährt sich m die Haare, er werd
(Schluß.)
der Lade, aber schon das Bekreiden gelingt
herab. Ungeheueres Gelächter. Man tupft die
plötzlich nüchtern und stammelt bebend eine leise Entschuldigung: „Liebe Hen-
riette ! Verzeihe mir — es war das letzte Mal — es geschieht nie wieder —
ein paar gute Freunde — ein Geburtstag — lauter Männer u. s. w. Gr
erhält aber keine Antwort, er hört nur schluchzen und begibt sich kleinlaut und
beschämt ebenfalls zu Bette, um am andern Tage nach 10 Uhr mit einem höchst
fatalen Katzenjammer zu erwachen. Wird der Nachtschwärmer seinen jüngsten
Schwur halten? Nein?
Einige Herren dieser Gattung treiben den Exceß noch weiter und bieten
sogar einem „guten Freunde", der den Zimmerschlüssel vergessen, oder der
eine häusliche Predigt scheut, die eigene Wohnung als Nachtherberge an; sie
schwärzen ihn „vorsichtig leise", wobei jedoch eine Carambole mit den verschie-
denen Möbelstücken unvermeidlich, in das Zimmer und bequartiersn ihn auf
einen vacanten Divan, so daß die erschreckte Gattin und arme Dulderin, über
den ungebetenen Gast und rücksichtslosen Gatten empört, aus dem Bette fährt
und weinend in das Schlafzimmer ihrer Kinder flüchtet.
Der Nachtschwärmer ist so lange incurabel, als ihn nicht etwa eine Krank-
heit von dem Uebel heilt und ihm die Sache selbst verleidet. Bis dahin bleibt
er seiner Gewohnheit treu ; weder Schwüre noch Thränen vermögen die Sehn-
sucht, Nachts herum zu vagiren, in ihm zu ersticken. Ihm ist nur wohl, wenn
er nut den wechselvollen Genüssen der Nacht sich betäuben kann.
Er fühlt sich nur angeregt von den bunten Scenen der Nacht, er lebt
nur Nachts, und er kennt sämmtliche halbnächtige und ganznächtige Gasflam-
men, er kennt die Gewölbwächter und die Patrouillen; er weiß, welcher Fiaker
und welcher Comfortabe am längsten am Platze bleibt, dem er wohl eine
Cigarre anbietet; er, treibt allerlei Schabernak mit einsamen ängstlichen Pas-
santen , nimmt die Gewölbeschilder herab und stellt sie an die Ecke, läutet an
den Glockenzügen, hänselt den Fuhrmann jenes gewissen, wohl verdeckten com-
munalen Gefährtes, und was derlei geistreiche Impromptus noch mehr sind,
die in dem Kopfe eines angetrunkenen Uebermüthigen erwachen, der es sich
portout vorgenommen, sich zu „unterhalten." Hat er sich unterhalten? Tags
darauf muß er zur eigenen Beschämung gestehen, daß all' die Dummheiten
nicht werth waren, sein braves, engelgutes Weib oder seine bekümmerte Mutter
zu kränken. Warum er es a n nächsten Abend doch wieder thut? Er weiß
es selbst nicht, es ist ein psychologisches Näthsel.