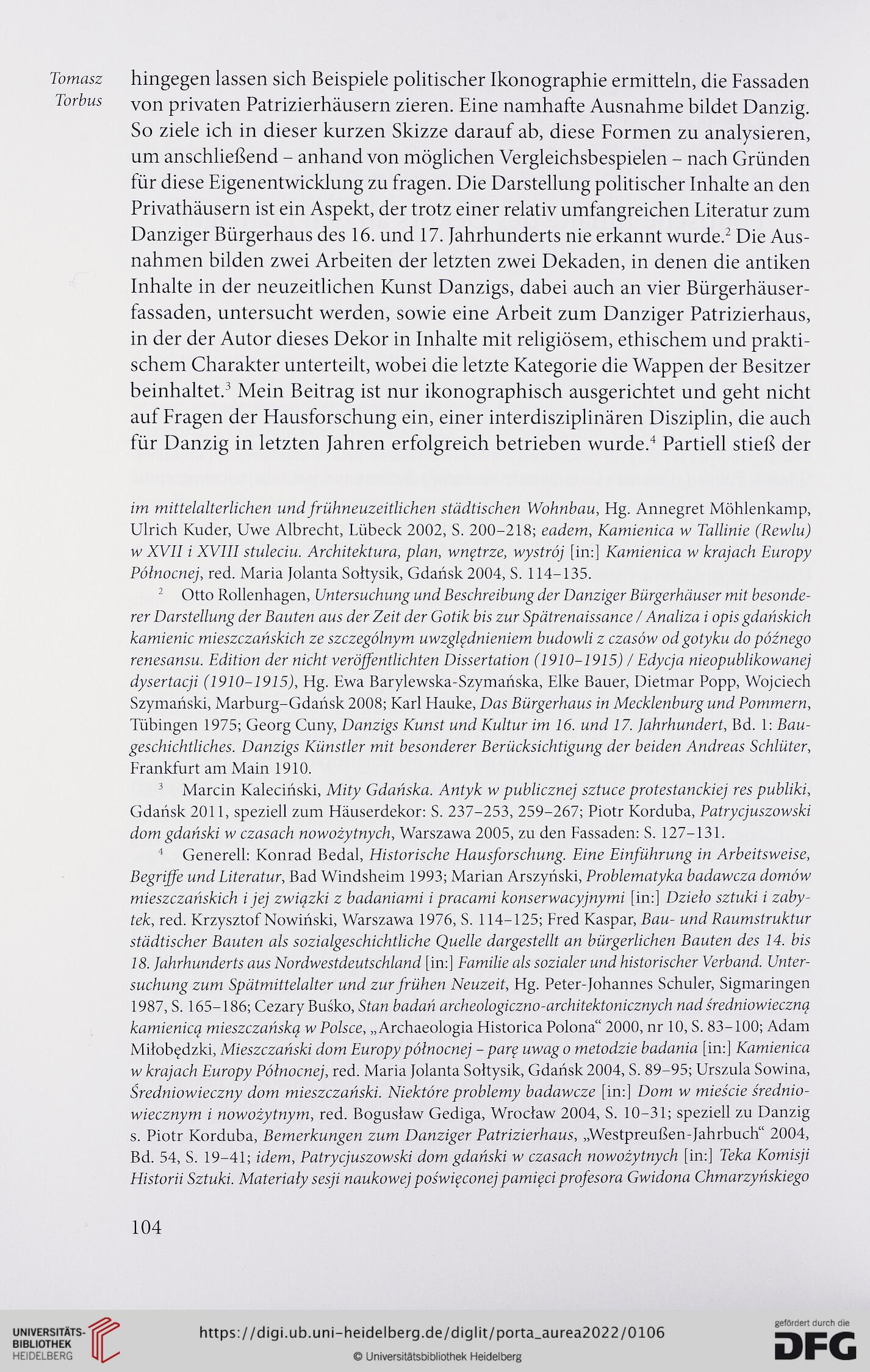Tomasz
Torb us
hingegen lassen sich Beispiele politischer Ikonographie ermitteln, die Fassaden
von privaten Patrizierhäusern zieren. Eine namhafte Ausnahme bildet Danzig.
So ziele ich in dieser kurzen Skizze darauf ab, diese Formen zu analysieren,
um anschließend - anhand von möglichen Vergleichsbespielen - nach Gründen
für diese Eigenentwicklung zu fragen. Die Darstellung politischer Inhalte an den
Privathäusern ist ein Aspekt, der trotz einer relativ umfangreichen Literatur zum
Danziger Bürgerhaus des 16. und 17. Jahrhunderts nie erkannt wurde.2 Die Aus-
nahmen bilden zwei Arbeiten der letzten zwei Dekaden, in denen die antiken
Inhalte in der neuzeitlichen Kunst Danzigs, dabei auch an vier Bürgerhäuser-
fassaden, untersucht werden, sowie eine Arbeit zum Danziger Patrizierhaus,
in der der Autor dieses Dekor in Inhalte mit religiösem, ethischem und prakti-
schem Charakter unterteilt, wobei die letzte Kategorie die Wappen der Besitzer
beinhaltet.3 Mein Beitrag ist nur ikonographisch ausgerichtet und geht nicht
auf Fragen der Hausforschung ein, einer interdisziplinären Disziplin, die auch
für Danzig in letzten Jahren erfolgreich betrieben wurde.4 Partiell stieß der
im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen städtischen Wohnbau, Hg. Annegret Möhlenkamp,
Ulrich Kuder, Uwe Albrecht, Lübeck 2002, S. 200-218; eadem, Kamienica w Tallinie (Rewlu)
w XVII i XVIII stuleciu. Architektura, plan, wnętrze, wystrój [in:] Kamienica w krajach Europy
Północnej, red. Maria Jolanta Sołtysik, Gdańsk 2004, S. 114-135.
2 Otto Rollenhagen, Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser mit besonde-
rer Darstellung der Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur Spätrenaissance / Analiza i opis gdańskich
kamienic mieszczańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli z czasów od gotyku do późnego
renesansu. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910-1915) / Edycja nieopublikowanej
dysertacji (1910-1915), Hg. Ewa Barylewska-Szymańska, Elke Bauer, Dietmar Popp, Wojciech
Szymański, Marburg-Gdańsk 2008; Karl Hauke, Das Bürgerhaus in Mecklenburg und Pommern,
Tübingen 1975; Georg Cuny, Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. 1: Bau-
geschichtliches. Danzigs Künstler mit besonderer Berücksichtigung der beiden Andreas Schlüter,
Frankfurt am Main 1910.
3 Marcin Kaleciński, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki,
Gdańsk 2011, speziell zum Häuserdekor: S. 237-253, 259-267; Piotr Korduba, Patrycjuszowski
dom gdański w czasach nowożytnych, Warszawa 2005, zu den Fassaden: S. 127-131.
4 Generell: Konrad Bedal, Historische Hausforschung. Eine Einführung in Arbeitsweise,
Begriffe und Literatur, Bad Windsheim 1993; Marian Arszyński, Problematyka badawcza domów
mieszczańskich i jej związki z badaniami i pracami konserwacyjnymi [in:] Dzieło sztuki i zaby-
tek, red. Krzysztof Nowiński, Warszawa 1976, S. 114-125; Fred Kaspar, Bau- und Raumstruktur
städtischer Bauten als sozialgeschichtliche Quelle dargestellt an bürgerlichen Bauten des 14. bis
18. Jahrhunderts aus Nordwestdeutschland [in:] Familie als sozialer und historischer Verband. Unter-
suchung zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit, Hg. Peter-Johannes Schuler, Sigmaringen
1987, S. 165-186; Cezary Buśko, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad średniowieczną
kamienicą mieszczańską w Polsce, „Archaeologia Historica Polona“ 2000, nr 10, S. 83-100; Adam
Miłobędzki, Mieszczański dom Europy północnej - parę uwago metodzie badania [in:] Kamienica
w krajach Europy Północnej, red. Maria Jolanta Sołtysik, Gdańsk 2004, S. 89-95; Urszula Sowina,
Średniowieczny dom mieszczański. Niektóre problemy badawcze [in:] Dom w mieście średnio-
wiecznym i nowożytnym, red. Bogusław Gediga, Wrocław 2004, S. 10-31; speziell zu Danzig
s. Piotr Korduba, Bemerkungen zum Danziger Patrizierhaus, „Westpreußen-Jahrbuch“ 2004,
Bd. 54, S. 19-41; idem, Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych [in:] Teka Komisji
Historii Sztuki. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Gwidona Chmarzyńskiego
104
Torb us
hingegen lassen sich Beispiele politischer Ikonographie ermitteln, die Fassaden
von privaten Patrizierhäusern zieren. Eine namhafte Ausnahme bildet Danzig.
So ziele ich in dieser kurzen Skizze darauf ab, diese Formen zu analysieren,
um anschließend - anhand von möglichen Vergleichsbespielen - nach Gründen
für diese Eigenentwicklung zu fragen. Die Darstellung politischer Inhalte an den
Privathäusern ist ein Aspekt, der trotz einer relativ umfangreichen Literatur zum
Danziger Bürgerhaus des 16. und 17. Jahrhunderts nie erkannt wurde.2 Die Aus-
nahmen bilden zwei Arbeiten der letzten zwei Dekaden, in denen die antiken
Inhalte in der neuzeitlichen Kunst Danzigs, dabei auch an vier Bürgerhäuser-
fassaden, untersucht werden, sowie eine Arbeit zum Danziger Patrizierhaus,
in der der Autor dieses Dekor in Inhalte mit religiösem, ethischem und prakti-
schem Charakter unterteilt, wobei die letzte Kategorie die Wappen der Besitzer
beinhaltet.3 Mein Beitrag ist nur ikonographisch ausgerichtet und geht nicht
auf Fragen der Hausforschung ein, einer interdisziplinären Disziplin, die auch
für Danzig in letzten Jahren erfolgreich betrieben wurde.4 Partiell stieß der
im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen städtischen Wohnbau, Hg. Annegret Möhlenkamp,
Ulrich Kuder, Uwe Albrecht, Lübeck 2002, S. 200-218; eadem, Kamienica w Tallinie (Rewlu)
w XVII i XVIII stuleciu. Architektura, plan, wnętrze, wystrój [in:] Kamienica w krajach Europy
Północnej, red. Maria Jolanta Sołtysik, Gdańsk 2004, S. 114-135.
2 Otto Rollenhagen, Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser mit besonde-
rer Darstellung der Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur Spätrenaissance / Analiza i opis gdańskich
kamienic mieszczańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli z czasów od gotyku do późnego
renesansu. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910-1915) / Edycja nieopublikowanej
dysertacji (1910-1915), Hg. Ewa Barylewska-Szymańska, Elke Bauer, Dietmar Popp, Wojciech
Szymański, Marburg-Gdańsk 2008; Karl Hauke, Das Bürgerhaus in Mecklenburg und Pommern,
Tübingen 1975; Georg Cuny, Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert, Bd. 1: Bau-
geschichtliches. Danzigs Künstler mit besonderer Berücksichtigung der beiden Andreas Schlüter,
Frankfurt am Main 1910.
3 Marcin Kaleciński, Mity Gdańska. Antyk w publicznej sztuce protestanckiej res publiki,
Gdańsk 2011, speziell zum Häuserdekor: S. 237-253, 259-267; Piotr Korduba, Patrycjuszowski
dom gdański w czasach nowożytnych, Warszawa 2005, zu den Fassaden: S. 127-131.
4 Generell: Konrad Bedal, Historische Hausforschung. Eine Einführung in Arbeitsweise,
Begriffe und Literatur, Bad Windsheim 1993; Marian Arszyński, Problematyka badawcza domów
mieszczańskich i jej związki z badaniami i pracami konserwacyjnymi [in:] Dzieło sztuki i zaby-
tek, red. Krzysztof Nowiński, Warszawa 1976, S. 114-125; Fred Kaspar, Bau- und Raumstruktur
städtischer Bauten als sozialgeschichtliche Quelle dargestellt an bürgerlichen Bauten des 14. bis
18. Jahrhunderts aus Nordwestdeutschland [in:] Familie als sozialer und historischer Verband. Unter-
suchung zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit, Hg. Peter-Johannes Schuler, Sigmaringen
1987, S. 165-186; Cezary Buśko, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad średniowieczną
kamienicą mieszczańską w Polsce, „Archaeologia Historica Polona“ 2000, nr 10, S. 83-100; Adam
Miłobędzki, Mieszczański dom Europy północnej - parę uwago metodzie badania [in:] Kamienica
w krajach Europy Północnej, red. Maria Jolanta Sołtysik, Gdańsk 2004, S. 89-95; Urszula Sowina,
Średniowieczny dom mieszczański. Niektóre problemy badawcze [in:] Dom w mieście średnio-
wiecznym i nowożytnym, red. Bogusław Gediga, Wrocław 2004, S. 10-31; speziell zu Danzig
s. Piotr Korduba, Bemerkungen zum Danziger Patrizierhaus, „Westpreußen-Jahrbuch“ 2004,
Bd. 54, S. 19-41; idem, Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych [in:] Teka Komisji
Historii Sztuki. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci profesora Gwidona Chmarzyńskiego
104