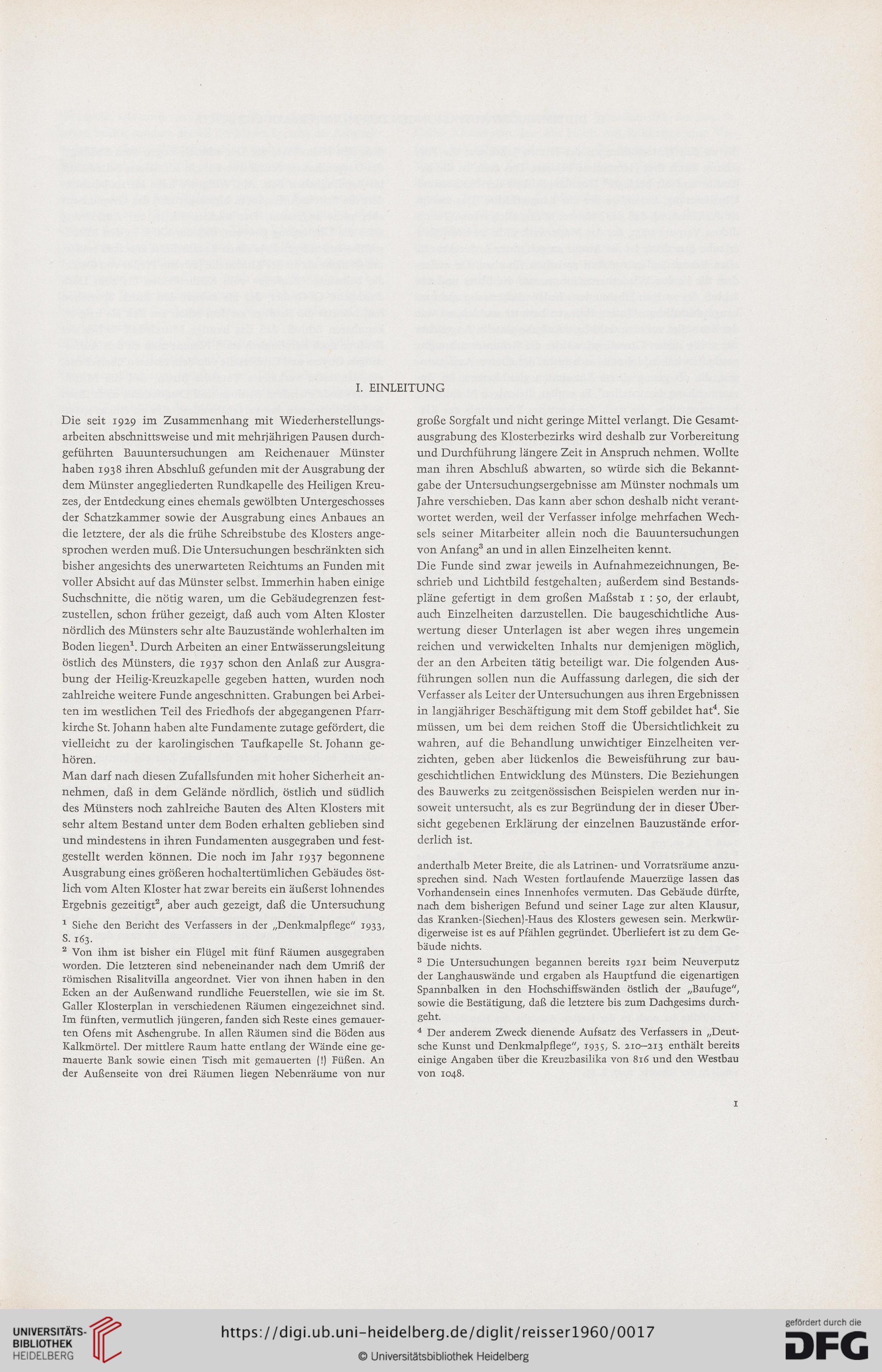I. EINLEITUNG
Die seit 192.9 im Zusammenhang mit Wiederherstellungs-
arbeiten abschnittsweise und mit mehrjährigen Pausen durch-
geführten Bauuntersuchungen am Reichenauer Münster
haben 1938 ihren Abschluß gefunden mit der Ausgrabung der
dem Münster angegliederten Rundkapelle des Heiligen Kreu-
zes, der Entdeckung eines ehemals gewölbten Untergeschosses
der Schatzkammer sowie der Ausgrabung eines Anbaues an
die letztere, der als die frühe Schreibstube des Klosters ange-
sprochen werden muß. Die Untersuchungen beschränkten sich
bisher angesichts des unerwarteten Reichtums an Funden mit
voller Absicht auf das Münster selbst. Immerhin haben einige
Suchschnitte, die nötig waren, um die Gebäudegrenzen fest-
zustellen, schon früher gezeigt, daß auch vom Alten Kloster
nördlich des Münsters sehr alte Bauzustände wohlerhalten im
Boden liegen1. Durch Arbeiten an einer Entwässerungsleitung
östlich des Münsters, die 1937 schon den Anlaß zur Ausgra-
bung der Heilig-Kreuzkapelle gegeben hatten, wurden noch
zahlreiche weitere Funde angeschnitten. Grabungen bei Arbei-
ten im westlichen Teil des Friedhofs der abgegangenen Pfarr-
kirche St. Johann haben alte Fundamente zutage gefördert, die
vielleicht zu der karolingischen Taufkapelle St. Johann ge-
hören.
Man darf nach diesen Zufallsfunden mit hoher Sicherheit an-
nehmen, daß in dem Gelände nördlich, östlich und südlich
des Münsters noch zahlreiche Bauten des Alten Klosters mit
sehr altem Bestand unter dem Boden erhalten geblieben sind
und mindestens in ihren Fundamenten ausgegraben und fest-
gestellt werden können. Die noch im Jahr 1937 begonnene
Ausgrabung eines größeren hochaltertümlichen Gebäudes öst-
lich vom Alten Kloster hat zwar bereits ein äußerst lohnendes
Ergebnis gezeitigt2, aber auch gezeigt, daß die Untersuchung
1 Siehe den Bericht des Verfassers in der „Denkmalpflege" T933,
S. 163.
2 Von ihm ist bisher ein Flügel mit fünf Räumen ausgegraben
worden. Die letzteren sind nebeneinander nach dem Umriß der
römischen Risalitvilla angeordnet. Vier von ihnen haben in den
Ecken an der Außenwand rundliche Feuerstellen, wie sie im St.
Galier Klosterplan in verschiedenen Räumen eingezeichnet sind.
Im fünften, vermutlich jüngeren, fanden sich Reste eines gemauer-
ten Ofens mit Aschengrube. In allen Räumen sind die Böden aus
Kalkmörtel. Der mittlere Raum hatte entlang der Wände eine ge-
mauerte Bank sowie einen Tisch mit gemauerten (!) Füßen. An
der Außenseite von drei Räumen liegen Nebenräume von nur
große Sorgfalt und nicht geringe Mittel verlangt. Die Gesamt-
ausgrabung des Klosterbezirks wird deshalb zur Vorbereitung
und Durchführung längere Zeit in Anspruch nehmen. Wollte
man ihren Abschluß abwarten, so würde sich die Bekannt-
gabe der Untersuchungsergebnisse am Münster nochmals um
Jahre verschieben. Das kann aber schon deshalb nicht verant-
wortet werden, weil der Verfasser infolge mehrfachen Wech-
sels seiner Mitarbeiter allein noch die Bauuntersuchungen
von Anfang3 an und in allen Einzelheiten kennt.
Die Funde sind zwar jeweils in Aufnahmezeichnungen, Be-
schrieb und Lichtbild festgehalten; außerdem sind Bestands-
pläne gefertigt in dem großen Maßstab 1 : 50, der erlaubt,
auch Einzelheiten darzustellen. Die baugeschichtliche Aus-
wertung dieser Unterlagen ist aber wegen ihres ungemein
reichen und verwickelten Inhalts nur demjenigen möglich,
der an den Arbeiten tätig beteiligt war. Die folgenden Aus-
führungen sollen nun die Auffassung darlegen, die sich der
Verfasser als Leiter der Untersuchungen aus ihren Ergebnissen
in langjähriger Beschäftigung mit dem Stoff gebildet hat4. Sie
müssen, um bei dem reichen Stoff die Übersichtlichkeit zu
wahren, auf die Behandlung unwichtiger Einzelheiten ver-
zichten, geben aber lückenlos die Beweisführung zur bau-
geschichtlichen Entwicklung des Münsters. Die Beziehungen
des Bauwerks zu zeitgenössischen Beispielen werden nur in-
soweit untersucht, als es zur Begründung der in dieser Über-
sicht gegebenen Erklärung der einzelnen Bauzustände erfor-
derlich ist.
anderthalb Meter Breite, die als Latrinen- und Vorratsräume anzu-
sprechen sind. Nach Westen fortlaufende Mauerzüge lassen das
Vorhandensein eines Innenhofes vermuten. Das Gebäude dürfte,
nach dem bisherigen Befund und seiner Lage zur alten Klausur,
das Kranken-(Siechen)-Haus des Klosters gewesen sein. Merkwür-
digerweise ist es auf Pfählen gegründet. Überliefert ist zu dem Ge-
bäude nichts.
3 Die Untersuchungen begannen bereits 1921 beim Neuverputz
der Langhauswände und ergaben als Hauptfund die eigenartigen
Spannbalken in den Hochschiffswänden östlich der „Baufuge",
sowie die Bestätigung, daß die letztere bis zum Dachgesims durch-
geht.
4 Der anderem Zweck dienende Aufsatz des Verfassers in „Deut-
sche Kunst und Denkmalpflege", 2935, S. 210—213 enthält bereits
einige Angaben über die Kreuzbasilika von 816 und den Westbau
von 1048.
1
Die seit 192.9 im Zusammenhang mit Wiederherstellungs-
arbeiten abschnittsweise und mit mehrjährigen Pausen durch-
geführten Bauuntersuchungen am Reichenauer Münster
haben 1938 ihren Abschluß gefunden mit der Ausgrabung der
dem Münster angegliederten Rundkapelle des Heiligen Kreu-
zes, der Entdeckung eines ehemals gewölbten Untergeschosses
der Schatzkammer sowie der Ausgrabung eines Anbaues an
die letztere, der als die frühe Schreibstube des Klosters ange-
sprochen werden muß. Die Untersuchungen beschränkten sich
bisher angesichts des unerwarteten Reichtums an Funden mit
voller Absicht auf das Münster selbst. Immerhin haben einige
Suchschnitte, die nötig waren, um die Gebäudegrenzen fest-
zustellen, schon früher gezeigt, daß auch vom Alten Kloster
nördlich des Münsters sehr alte Bauzustände wohlerhalten im
Boden liegen1. Durch Arbeiten an einer Entwässerungsleitung
östlich des Münsters, die 1937 schon den Anlaß zur Ausgra-
bung der Heilig-Kreuzkapelle gegeben hatten, wurden noch
zahlreiche weitere Funde angeschnitten. Grabungen bei Arbei-
ten im westlichen Teil des Friedhofs der abgegangenen Pfarr-
kirche St. Johann haben alte Fundamente zutage gefördert, die
vielleicht zu der karolingischen Taufkapelle St. Johann ge-
hören.
Man darf nach diesen Zufallsfunden mit hoher Sicherheit an-
nehmen, daß in dem Gelände nördlich, östlich und südlich
des Münsters noch zahlreiche Bauten des Alten Klosters mit
sehr altem Bestand unter dem Boden erhalten geblieben sind
und mindestens in ihren Fundamenten ausgegraben und fest-
gestellt werden können. Die noch im Jahr 1937 begonnene
Ausgrabung eines größeren hochaltertümlichen Gebäudes öst-
lich vom Alten Kloster hat zwar bereits ein äußerst lohnendes
Ergebnis gezeitigt2, aber auch gezeigt, daß die Untersuchung
1 Siehe den Bericht des Verfassers in der „Denkmalpflege" T933,
S. 163.
2 Von ihm ist bisher ein Flügel mit fünf Räumen ausgegraben
worden. Die letzteren sind nebeneinander nach dem Umriß der
römischen Risalitvilla angeordnet. Vier von ihnen haben in den
Ecken an der Außenwand rundliche Feuerstellen, wie sie im St.
Galier Klosterplan in verschiedenen Räumen eingezeichnet sind.
Im fünften, vermutlich jüngeren, fanden sich Reste eines gemauer-
ten Ofens mit Aschengrube. In allen Räumen sind die Böden aus
Kalkmörtel. Der mittlere Raum hatte entlang der Wände eine ge-
mauerte Bank sowie einen Tisch mit gemauerten (!) Füßen. An
der Außenseite von drei Räumen liegen Nebenräume von nur
große Sorgfalt und nicht geringe Mittel verlangt. Die Gesamt-
ausgrabung des Klosterbezirks wird deshalb zur Vorbereitung
und Durchführung längere Zeit in Anspruch nehmen. Wollte
man ihren Abschluß abwarten, so würde sich die Bekannt-
gabe der Untersuchungsergebnisse am Münster nochmals um
Jahre verschieben. Das kann aber schon deshalb nicht verant-
wortet werden, weil der Verfasser infolge mehrfachen Wech-
sels seiner Mitarbeiter allein noch die Bauuntersuchungen
von Anfang3 an und in allen Einzelheiten kennt.
Die Funde sind zwar jeweils in Aufnahmezeichnungen, Be-
schrieb und Lichtbild festgehalten; außerdem sind Bestands-
pläne gefertigt in dem großen Maßstab 1 : 50, der erlaubt,
auch Einzelheiten darzustellen. Die baugeschichtliche Aus-
wertung dieser Unterlagen ist aber wegen ihres ungemein
reichen und verwickelten Inhalts nur demjenigen möglich,
der an den Arbeiten tätig beteiligt war. Die folgenden Aus-
führungen sollen nun die Auffassung darlegen, die sich der
Verfasser als Leiter der Untersuchungen aus ihren Ergebnissen
in langjähriger Beschäftigung mit dem Stoff gebildet hat4. Sie
müssen, um bei dem reichen Stoff die Übersichtlichkeit zu
wahren, auf die Behandlung unwichtiger Einzelheiten ver-
zichten, geben aber lückenlos die Beweisführung zur bau-
geschichtlichen Entwicklung des Münsters. Die Beziehungen
des Bauwerks zu zeitgenössischen Beispielen werden nur in-
soweit untersucht, als es zur Begründung der in dieser Über-
sicht gegebenen Erklärung der einzelnen Bauzustände erfor-
derlich ist.
anderthalb Meter Breite, die als Latrinen- und Vorratsräume anzu-
sprechen sind. Nach Westen fortlaufende Mauerzüge lassen das
Vorhandensein eines Innenhofes vermuten. Das Gebäude dürfte,
nach dem bisherigen Befund und seiner Lage zur alten Klausur,
das Kranken-(Siechen)-Haus des Klosters gewesen sein. Merkwür-
digerweise ist es auf Pfählen gegründet. Überliefert ist zu dem Ge-
bäude nichts.
3 Die Untersuchungen begannen bereits 1921 beim Neuverputz
der Langhauswände und ergaben als Hauptfund die eigenartigen
Spannbalken in den Hochschiffswänden östlich der „Baufuge",
sowie die Bestätigung, daß die letztere bis zum Dachgesims durch-
geht.
4 Der anderem Zweck dienende Aufsatz des Verfassers in „Deut-
sche Kunst und Denkmalpflege", 2935, S. 210—213 enthält bereits
einige Angaben über die Kreuzbasilika von 816 und den Westbau
von 1048.
1